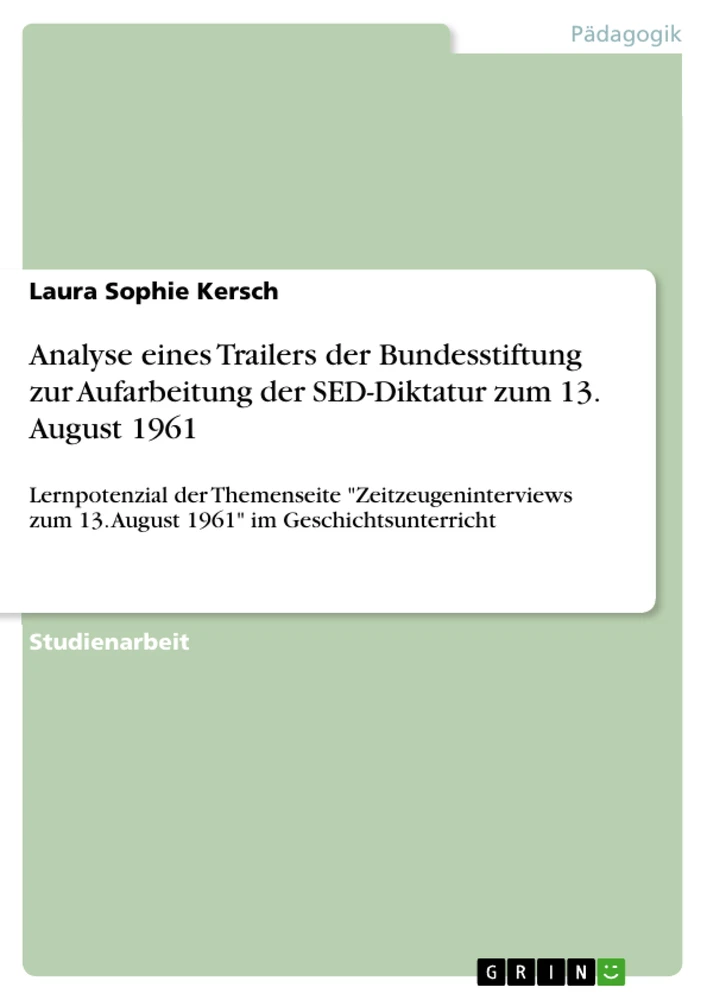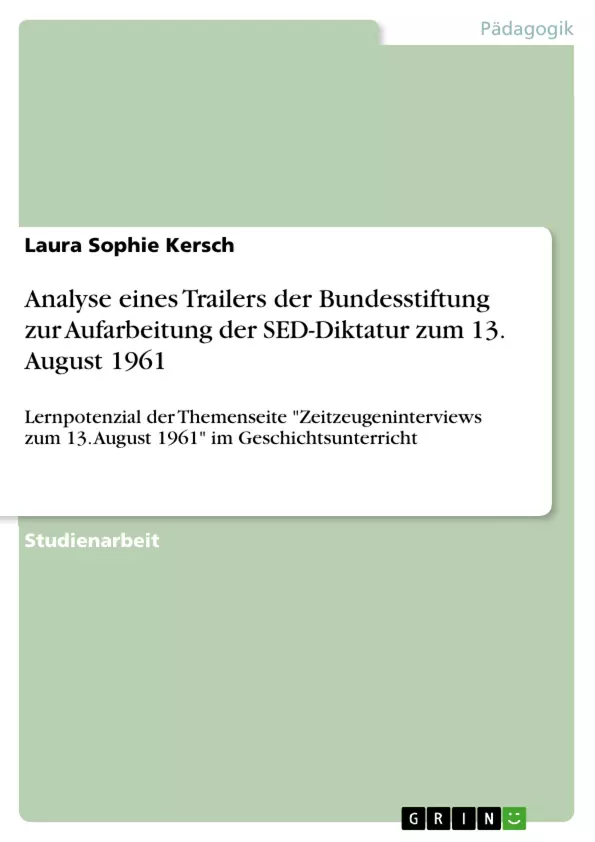In dieser Arbeit wird zentral nach dem Lernpotenzial der Themenseite „Zeitzeugeninterviews zum 13. August 1961“ gefragt. Eingangs lässt sich somit vor dem Hintergrund der vorherigen Überlegungen folgende Arbeitshypothese aufstellen: Es ist sinnvoll, Zeitzeugenvideos im Geschichtsunterricht einzusetzen. Mithilfe dieser Repräsentationsform können insbesondere Kompetenzen historischen Denkens gefördert werden. Die Arbeit mit Videos bietet den Vorteil, dass die Lernenden dem Zeitzeugenbericht distanzierter und vermutlich kritischer gegenüberstehen. Zudem können Zeitzeugeninterviews am einfachsten mit großer Effektivität und mit einem niedrigen Maß an Vorbereitungszeit im Geschichtsunterricht eingesetzt werden. Trotz alledem erfordert dies eine umfassende Nachprüfung und Abgleich mit anderen Quellen und vor allem eine Einordnung in den Gesamtkontext des historischen Zusammenhanges.
Oral History ist eine anerkannte und breit angewandte Methode, aber auch nicht unumstritten. Zum Kern der Oral History gehören lebensgeschichtliche Interviews, die in den Geschichtsunterricht integriert werden können. Der Einsatz von Video-Interviews im schulischen Bereich ist besonders geeignet, um den Kernlehrplan für das Fach Geschichte der Sekundarstufen I und II in Nordrhein-Westfalen zu erfüllen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
- Kontroversen
- Zeitzeugenportal
- Analyse eines Trailers der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur zum 13. August 1961
- Funktion als Werbetrailer
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Zeitzeugenaussagen
- Lernpotenzial der Themenseite „Zeitzeugeninterviews zum 13. August 1961“ für einen Einsatz im Geschichtsunterricht
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Lernpotenzial der Themenseite „Zeitzeugeninterviews zum 13. August 1961“ der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur für den Einsatz im Geschichtsunterricht. Die Arbeit analysiert einen Trailer der Stiftung und untersucht, wie Zeitzeugeninterviews im Geschichtsunterricht eingesetzt werden können, um Kompetenzen historischen Denkens zu fördern.
- Die Rolle von Zeitzeugeninterviews in der Geschichtskulturforschung und die Kritik an ihrer Verwendung.
- Die Analyse des Trailers der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur zum 13. August 1961.
- Die Möglichkeiten und Herausforderungen des Einsatzes von Zeitzeugenvideos im Geschichtsunterricht.
- Die Effektivität von Zeitzeugeninterviews bei der Vermittlung historischer Inhalte und die Förderung von historischem Denken.
- Die Notwendigkeit der kritischen Einordnung von Zeitzeugenberichten in den historischen Kontext.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Arbeitshypothese und stellt den Aufbau der Arbeit dar. Sie beleuchtet die Bedeutung von Zeitzeugeninterviews im Geschichtsunterricht und die Kritik an der Verwendung von Oral History.
Das zweite Kapitel stellt die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur vor, beleuchtet Kontroversen um die Zusammenarbeit der Stiftung mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung und beschreibt das Zeitzeugenportal der Stiftung.
Das dritte Kapitel analysiert einen Trailer der Bundesstiftung zum 13. August 1961. Es untersucht die Funktion des Trailers als Werbetrailer und analysiert die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Zeitzeugenaussagen.
Schlüsselwörter
Zeitzeugeninterviews, Geschichtsunterricht, Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Oral History, historisches Denken, Lernpotenzial, Trailer-Analyse, 13. August 1961, Mauerbau, SED-Diktatur.
Häufig gestellte Fragen
Welches Lernpotenzial bieten Zeitzeugenvideos im Geschichtsunterricht?
Zeitzeugenvideos fördern die Kompetenzen historischen Denkens, ermöglichen eine distanzierte Analyse und machen Geschichte durch persönliche Berichte greifbarer.
Was thematisiert der Trailer zum 13. August 1961?
Der Trailer der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur zeigt verschiedene Zeitzeugenberichte zum Mauerbau und dient als Einstieg in die Thematik.
Welche Kritik gibt es an der Methode „Oral History“?
Kritiker weisen darauf hin, dass Erinnerungen subjektiv sind und durch den zeitlichen Abstand sowie spätere Erfahrungen verzerrt werden können.
Wie sollten Zeitzeugeninterviews im Unterricht eingesetzt werden?
Sie erfordern eine umfassende Nachprüfung, einen Abgleich mit anderen Quellen und eine Einordnung in den historischen Gesamtkontext.
Was ist das Ziel der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur?
Ziel ist die wissenschaftliche und gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der Geschichte der DDR und den Folgen der SED-Herrschaft.
- Citar trabajo
- Laura Sophie Kersch (Autor), 2018, Analyse eines Trailers der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur zum 13. August 1961, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/452071