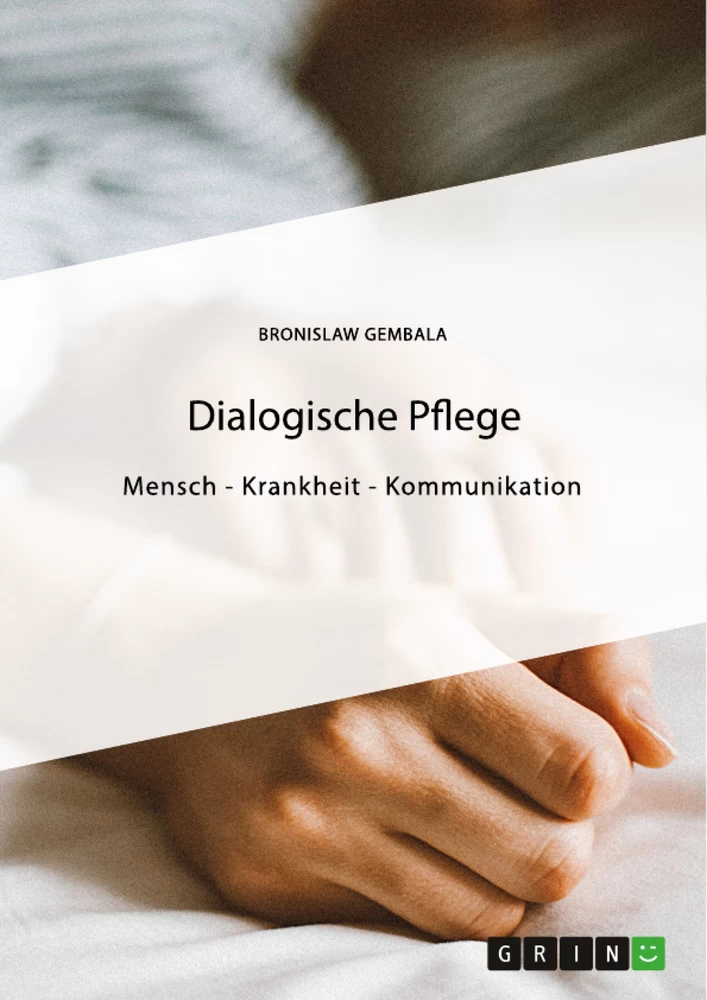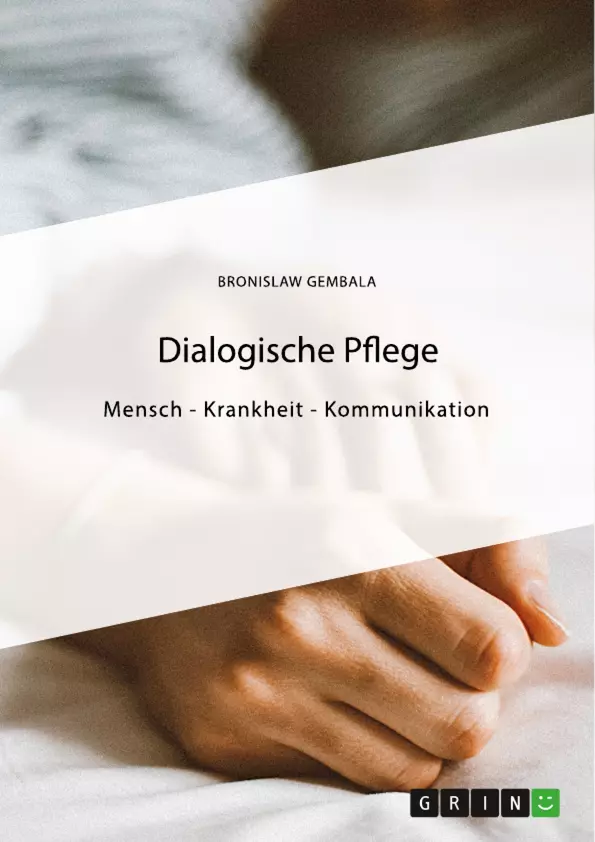Ein kranker, schwerstkranker oder sterbender Mensch bringt ebenso sehr wie ein gesunder Mensch bleibende Werte in die Gesellschaft ein. Dennoch wird dieser Beitrag meistens nicht oder nur sehr eingeschränkt wahrgenommen.
Dieses Buch zeigt deshalb die tatsächliche Rolle eines kranken Menschen in der Gesellschaft auf. Dabei betrachtet es zunächst die unterschiedlichen Einstellungen kranker Menschen in ihrer Krankheit und wie das unmittelbare Umfeld auf sie reagiert. So kommt der Autor zu einem praktischen Kommunikationsmodell für Pflegekräfte.
Der kranke und sterbende Mensch ist und kann, in der Familie und im Gesundheitswesen selbst, ein Schöpfer neuer personalen Interaktionen (Dialogprozesse) sein. In diesem Zusammenhang sind dem Autor zwei Faktoren von besonderer Wichtigkeit: die Rolle der Familie und ihre Einstellung zu kranken Menschen.
Es ist ein wichtiges Ziel pflegerischen Tuns, Andere wahrzunehmen, zu beobachten und zu beurteilen. Häufig hilft einer Pflegekraft die Mimik eines Patienten bei dieser Beurteilung. Der Gesichtsausdruck eines Patienten kann beispielsweise die Intensität von Schmerzen anzeigen (die manchmal von dem abweicht, was er sagt), und seine Gesten können die Art seiner inneren körperlichen Empfindungen veranschaulichen.
Im pflegerischen Bereich könnte es sein, dass sich die Genauigkeit der pflegerischen Beobachtung verbessern würde, wenn man der nonverbalen Kommunikation mehr Beachtung schenken würde. Die engere Einbeziehung der nonverbalen Kommunikation in den Pflegealltag wird die Gestaltung der Pflegebeziehung und des Dialogprozesses noch ein wenig besser und effektiver machen. Das Verständnis für die Art und Weise, in welcher der individuelle Pflegebedürftige kommuniziert, veranlasst eine intensivpflegerische Betreuung, die nicht nur medizinisch notwendige Maßnahmen ausführt, sondern den Patienten in seiner individuellen Bedarfssituation umfassender berücksichtigt und damit seiner Würde gerecht wird.
Inhaltsverzeichnis
- Zur Einführung
- Teil I:
- 1.1. Mensch - Krankheit
- 1.2. Homo creator - schöpferischer Mensch in der Krankheit
- 1.3. Die Allgemeinheit der Krankheit
- 1.4. Die Dramaturgie des Krankheitsprozesses
- 1.4.1. Die positiven (schöpferischen) Haltungen
- 1.4.1.1. Der Geber
- 1.4.1.2. Der Samariter
- 1.4.1.3. Der Helfer
- 1.4.1.4. Der Verschwörer
- 1.4.1.5. Der Suchende
- 1.4.1.6. Der Soldat
- 1.4.1.7. Der Künstler
- 1.4.1.8. Der Held
- 1.4.2. Die negativen (egoistischen) Haltungen
- 1.4.2.1. Der Nehmer
- 1.4.2.2. Der Hypochonder
- 1.4.2.3. Der Nörgler
- 1.4.2.4. Der Rühmliche
- 1.4.2.5. Der Statist
- 1.4.2.6. Der Bettler
- 1.4.2.7. Der Profi
- 1.4.2.8. Der Scheinheilige
- 1.5. Der kranke Mensch als Wertekreator im Gesundheitswesen
- 1.6. Der kranke Mensch als Wertekreator neuer Beziehungen
- 1.7. Der kranke Mensch als Wertekreator in der Familie
- 1.7.1. Die Einstellungen zu kranken Menschen innerhalb der Familie
- 1.7.1.1. Die Hilfe
- 1.7.1.2. Das Fehlen an gleichbleibendem Interesse
- 1.7.1.3. Die Müdigkeit durch einen langen Krankheitsprozess
- 1.7.1.4. Die Gleichgültigkeit
- 1.7.1.5. Die Ablehnung
- 1.7.1.6. Die Gewinnabschöpfung aus der Krankheit eines Familienmitgliedes
- 1.7.1. Die Einstellungen zu kranken Menschen innerhalb der Familie
- Teil II: Nonverbale Kommunikation in der außerklinischen Intensivpflege und Beatmung
- 2.1. Außerklinische Intensivpflege als Beziehung
- 2.2. Kommunikation und ihr Stellenwert in Modellen und Theorien der Pflege
- 2.3. Annäherung an die nonverbale Kommunikation
- 2.4. Aspekte nonverbaler Kommunikation in ihrer Pflegerelevanz
- 2.4.A. Besondere Pflegesituationen
- 2.4.A.1. Emotionen
- 2.4.A.2. Depressionen
- 2.4.A.3. Sterbebegleitung
- 2.4.B. Einflussfaktoren bei Dekodierung nonverbaler Signale
- 2.4.B.1. Persönlichkeitsunterschiede
- 2.4.B.2. Geschlechtliche Unterschiede
- 2.4.B.3. Kulturelle Unterschiede
- 2.4.1. Nonverbal-vokaler Bereich
- 2.4.2. Bereich der Kinesik
- 2.4.2.1. Gesichtsausdruck und Mimik
- 2.4.2.2. Blickverhalten
- 2.4.2.3. Körperhaltung
- 2.4.2.4. Körperkontakt und Berührung
- 2.4.2.5. Gestik und körperliche Bewegungen
- 2.4.3. Proxemik
- 2.4.4. Bereich der Artefakte und Kleidung
- 2.4.A. Besondere Pflegesituationen
- 2.5. Nonverbale Sprachkomponente in Bezug auf das Modell der fördernden Prozesspflege (ABEDL®)
- 2.5.1. Kommunizieren können
- 2.5.2. Sich bewegen können
- 2.5.3. Vitale Funktionen des Lebens aufrechterhalten können
- 2.5.4. Sich pflegen können
- 2.5.5. Essen und Trinken können
- 2.5.6. Ausscheiden können
- 2.5.7. Sich kleiden können
- 2.5.8. Ruhen, schlafen und entspannen können
- 2.5.9. Sich beschäftigen lernen und sich entwickeln können
- 2.5.10. Sich als Mann oder Frau fühlen und verhalten können
- 2.5.11. Für eine sichere und fördernde Umgebung sorgen können
- 2.5.12. Soziale Bereiche des Lebens sichern und Beziehungen gestalten können
- 2.5.13. Mit existentiellen Erfahrungen des Lebens umgehen können
- 2.5.14. Auswirkung physiologischer Signale auf die Pflege
- 2.6. Empfehlungen
- Teil III: Tabellen, Grafiken, Präsentation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle des kranken Menschen als Wertekreator in verschiedenen Kontexten, insbesondere im Gesundheitswesen und in der Familie. Sie beleuchtet die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten, die sich aus der Krankheitssituation für den Menschen ergeben, und analysiert die Bedeutung nonverbaler Kommunikation in der außerklinischen Intensivpflege und Beatmung.
- Der kranke Mensch als Akteur und Gestalter seiner eigenen Lebenswelt
- Die Bedeutung von Werten und Einstellungen im Umgang mit Krankheit und Pflege
- Die Rolle nonverbaler Kommunikation in der Pflege
- Die Herausforderungen und Möglichkeiten der außerklinischen Intensivpflege und Beatmung
- Die Bedeutung von interdisziplinärer Zusammenarbeit in der Pflege
Zusammenfassung der Kapitel
- Zur Einführung: Die Einleitung stellt die grundlegende Fragestellung und die Relevanz des Themas vor. Sie skizziert die methodische Vorgehensweise und die theoretischen Grundlagen der Arbeit.
- Teil I: Mensch - Krankheit: Die Kapitel in diesem Teil befassen sich mit dem kranken Menschen als schöpferischem Individuum und analysieren die verschiedenen Haltungen, die er in der Krankheit annehmen kann. Sie beleuchten die Bedeutung des Menschen als Wertekreator im Gesundheitswesen und in der Familie.
- Teil II: Nonverbale Kommunikation in der außerklinischen Intensivpflege und Beatmung: Dieser Teil widmet sich der Analyse nonverbaler Kommunikation in der Pflege, insbesondere im Kontext der außerklinischen Intensivpflege und Beatmung. Es werden verschiedene Aspekte nonverbaler Kommunikation, wie Gesichtsausdruck, Blickverhalten und Körpersprache, im Hinblick auf ihre Pflegerelevanz beleuchtet.
Schlüsselwörter
Kranker Mensch, Wertekreator, Krankheitsprozess, Nonverbale Kommunikation, Außerklinische Intensivpflege, Beatmung, Pflege, Beziehung, Pflegerelevanz, Emotionen, Sterbebegleitung, ABEDL® Modell.
- Citation du texte
- Bronislaw Gembala (Auteur), 2019, Dialogische Pflege, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/455191