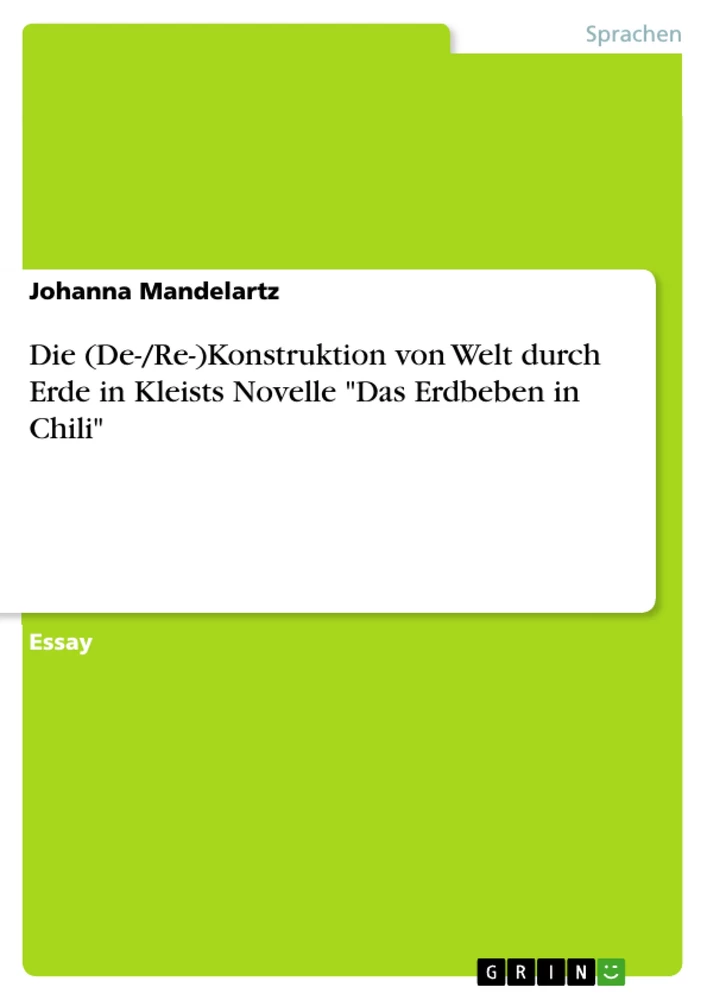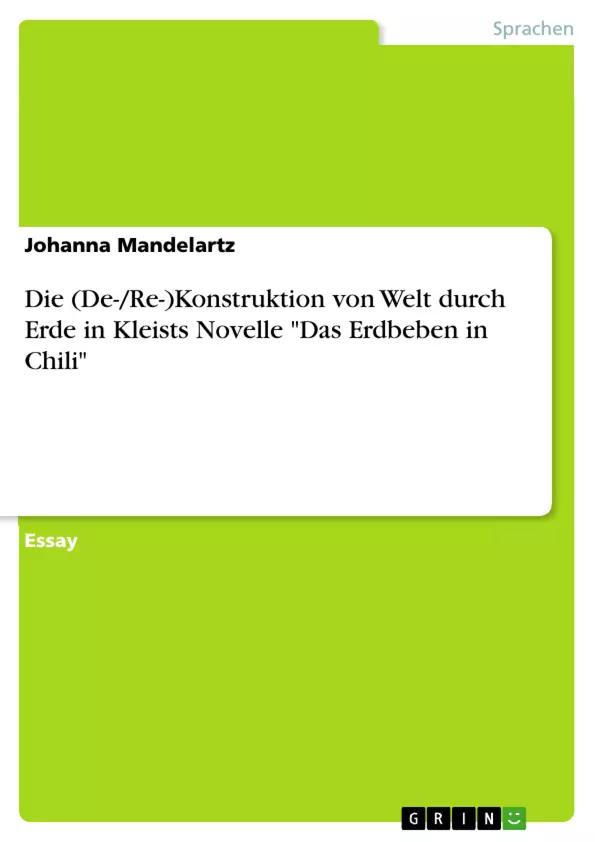Kleists Novelle "Das Erdbeben in Chili", ursprünglich im Jahre 1807 unter dem Titel Jeronimo und Josephe im Morgenblatt für gebildete Stände erschienen und erst drei Jahre darauf unter dem heute bekannteren Titel in Kleists Erzählungen veröffentlicht, behandelt das unerhörte Ereignis eines Erdbebens in der chilenischen Hauptstadt Santiago und die Auswirkungen, die dieses Beben auf das Leben eines Liebespaares und auf das Verhalten der Bürger der Stadt hat.
Im Folgenden soll untersucht werden, wie in der Erzählung die Erschütterung der Erde zur Konstruktion, Dekonstruktion und Rekonstruktion von Welt führt.
„Erde“ ist ein geographischer Begriff, der hier in erster Linie den Boden unter den Füßen der Menschen bezeichnet und damit auch ihre Form (tektonische Platten) mit einschließt.
Der Begriff „Welt“ ist in diesem Zusammenhang vor allem als soziales Gefüge zu verstehen: die Welt Santiago, bestehend aus den Bewohnern der Stadt, hat bestimmte Verhaltensregeln und Glaubensgrundsätze, sie teilen eine Sprache und eine Religion. Doch gibt es in Santiago nicht nur eine große Stadt-Welt, sondern auch kleinere Welten, die die große in verschiedene Teile spalten, wie etwa die Welt der Edelleute, zu denen die Familie Donna Josephes gehört, die Welt der einfacheren Menschen, der ihr Lehrer und Geliebter Jeronimo angehört, oder die Welt des Karmeliterklosters, das isoliert von den anderen sozialen Welten existieren soll und in dem besondere Verhaltensregeln gelten.
Kleists Novelle Das Erdbeben in Chili, ursprünglich im Jahre 1807 unter dem Titel Jeronimo und Josephe im Morgenblatt für gebildete Stände erschienen und erst drei Jahre darauf unter dem heute bekannteren Titel in Kleists Erzählungen veröffentlicht, behandelt das unerhörte Ereignis eines Erdbebens in der chilenischen Hauptstadt Santiago und die Auswirkungen, die dieses Beben auf das Leben eines Liebespaares und auf das Verhalten der Bürger der Stadt hat.
1 Im Folgenden soll untersucht werden, wie in der Erzählung die Erschütterung der Erde zur Konstruktion, Dekonstruktion und Rekonstruktion von Welt führt.
„Erde“ ist ein geographischer Begriff, der hier in erster Linie den Boden unter den Füßen der Menschen bezeichnet und damit auch ihre Form (tektonische Platten) mit einschließt.
Der Begriff „Welt“ ist in diesem Zusammenhang vor allem als soziales Gefüge zu verstehen: die Welt Santiago, bestehend aus den Bewohnern der Stadt, hat bestimmte Verhaltensregeln und Glaubensgrundsätze, sie teilen eine Sprache und eine Religion. Doch gibt es in Santiago nicht nur eine große Stadt-Welt, sondern auch kleinere Welten, die die große in verschiedene Teile spalten, wie etwa die Welt der Edelleute, zu denen die Familie Donna Josephes gehört, die Welt der einfacheren Menschen, der ihr Lehrer und Geliebter Jeronimo angehört, oder die Welt des Karmeliterklosters, das isoliert von den anderen sozialen Welten existieren soll und in dem besondere Verhaltensregeln gelten.
Bei dem beschriebenen Erdbeben handelt es sich um ein reales Ereignis: 1647 wurde die Stadt tatsächlich von einem Beben der Stärke 8.5 auf der Richterskala und der Intensität 11 (auf einer Skala von 1 bis 12) erschüttert, das ca. 1000 Tote forderte, viele Gebäude zerstörte und extremen finanziellen Schaden anrichtete.2
Kleists Beschäftigung mit dem Thema dürfte dennoch eher von einem aktuelleren Ereignis inspiriert worden sein: 1755 wurde Lissabon von einem Beben der Stärke 8.8 und der Intensität 11 erschüttert, das zusätzlich einen Tsunami auslöste. Das Erdbeben von Lissabon gilt als „one of the most destructive shocks of all times“3. Die Stärke und Intensität der beiden Beben sind durchaus vergleichbar, bei der Anzahl der Toten gibt es allerdings große Unterschiede: In Portugal starben ca. 50.000 Menschen.4
Damit war das Lissabonner Erdbeben nicht nur für Geographen, sondern auch für Theologen, Philosophen und Literaten einer der größten Schocks der Geschichte und bot zahlreichen Dichtern Anlass, sich mit der Frage der Theodizee auseinanderzusetzen. Diese spielt zwar auch bei Kleist eine Rolle, wird aber vom Erzähler eher als humanozentrischer und unsinniger Blick auf Naturkatastrophen dargestellt denn als berechtigte oder gar beantwortbare Frage.5 Uns soll es ohnehin um etwas anderes gehen, nämlich dem, was nach dem Erdbeben mit der Welt bzw. den Welten passiert, denen Jeronimo und Josephe angehören.
Die beiden Protagonisten gehören unterschiedlichen Schichten und damit auch Lebenswelten an; Jeronimo Rugera ist ein einfacher Hauslehrer, Josephe trägt ein „Donna“ vor ihrem Namen, was ihre Zugehörigkeit zur Oberschicht signalisiert. Ihr Vater Don Henrico Asteron ist ein wohlhabender Edelmann.6
In der Welt Santiago gibt es klare soziale Regeln darüber, inwieweit die verschiedenen Schichten miteinander in Kontakt treten können: Es ist vollkommen zulässig, einen nicht-adligen gebildeten Mann als Lehrer anzustellen. So gelangt Jeronimo in den Haushalt der Familie Asteron. Sind Mann und Frau aus unterschiedlichen Ständen aber „zärtlich“7 miteinander, so ist dies Grund zur Entrüstung.8
Die beiden Welten dürfen einander zwar berühren, aber sich nicht (wie es etwa bei der Geburt eines Kindes, dem Resultat einer Liebesbeziehung, der Fall wäre) miteinander vermischen, da die Gesellschaft bereits klar aufgeteilt ist und für eine neue, aus Teilen der bisherigen Welten zusammengesetzte Welt kein Platz wäre. Don Henrico Asteron muss daher als Familienoberhaupt für den Erhalt seiner Welt sorgen und schickt seine Tochter in ein Kloster, nachdem er von ihrem „zärtlichen Einverständnis“9 mit dem Hauslehrer erfährt. Er glaubt, die Verbindung seiner Tochter zu Jeronimo und besonders die damit verbundene Gefahr sexuellen Kontakts und einer daraus resultierenden Schwangerschaft verhindern zu können, indem er sie der (vom Rest der Gesellschaft isolierten) Welt der Karmeliterinnen anvertraut, bei denen das Gesetz der Keuschheit gilt. Es steht zu vermuten, dass Josephe dieser Unterbringung nicht oder nur widerwillig zustimmt. Sie wird als Störfaktor aus ihrer Ursprungswelt entfernt, um diese vor einer Vermengung mit einer anderen Welt zu schützen.
Dank eines nicht weiter erklärten „Zufall[s]“10 gelingt es Jeronimo, trotzdem Kontakt zu ihr herzustellen, ins Kloster einzudringen und dort Sex mit ihr zu haben. Die Welt des Klosters ist also längst nicht so abgeschirmt, wie es von ihr erwartet wird.
Josephe wird schwanger, was erst bemerkt wird, als die Wehen einsetzen. Sie wird als „Sünderin“11 ins Gefängnis geworfen (eine weitere isolierte Welt, die dazu dienen soll, die anderen sozialen Welten von Störfaktoren wie Josephe oder Jeronimo zu befreien), bringt das mit Jeronimo gezeugte Kind dort zur Welt, und kurz darauf wird ihr Todesurteil ausgesprochen. Das Kind wird den Nonnen des Klosters anvertraut und bleibt damit zunächst in der isolierten Welt des Klosters, das schon in Josephes Fall als eine Art Quarantänestation und Schutz der restlichen Bevölkerung fungiert hat. Durch die Isolation kann es dort weder die Welt der Edelleute noch die des Hauslehrers stören.
Ausschlaggebend für Josephes Verurteilung zum Tode ist nicht die Tatsache, dass sie als unverheiratete Frau Sex hat, sondern die Tatsache, dass sie dies als Nonne tut: es ist „das klösterliche Gesetz“,12 das auf sie angewendet wird. Sie ist aber nur im Kloster, weil sie durch ihre Beziehung die Vermischung ihrer Welt mit der Jeronimos riskiert hat; das Todesurteil ist also eine Folge der Grenzüberschreitung zwischen verschiedenen sozialen Klassen.
Hätte man bei Josephe ein „zärtliches Einverständnis“ mit einem Mann ihres Standes entdeckt, so hätte man die beiden – sofern der Mann noch ledig wäre – wohl schnell verheiratet oder, falls der Mann bereits verheiratet sein sollte, Josephe mit einem anderen vermählt, sodass sie, geschützt durch eine anerkannte Ehe, auch mit dem Geliebten weiter diskret verkehren könnte. Eine solche Verbindung könnte höchstens für übles Gerede sorgen und den zwei beteiligten Personen schaden, nicht aber eine Bedrohung der Adelsschicht an sich darstellen.
Auch Jeronimo (der durch den Geschlechtsverkehr mit Josephe ebenfalls die Grenze zwischen den Gesellschaftsschichten verletzt hat) landet später im Gefängnis.
Entsprechend wird die bevorstehende Hinrichtung Josephes von den „frommen Töchter[n] der Stadt“13 als „göttliche[] Rache“ verstanden.
Genau an dem Tag, an dem Josephe exekutiert werden soll und an dem Jeronimo sich erhängen will, wird Santiago von dem Erdbeben erschüttert. Dabei wird das Gefängnis ebenso zerstört wie das Karmeliterinnenkloster, die Kathedrale, der Palast des Vizekönigs, der Gerichtshof und das Haus von Josephes Vater.14 Durch das Erdbeben werden damit geradezu systematisch alle Instanzen sozialer Kontrolle mitsamt ihrer architektonischen Repräsentationen ausgeschaltet: Mit dem Gefängnis geht das Druckmittel der Exekutive unter, denn sie kann niemanden mehr verhaften und einsperren. Das Kloster bricht ebenso zusammen wie die Kathedrale und der Palast des Vizekönigs, die Orte der geistlichen und weltlichen Legislative.15 Die Personen, die in diesen Instanzen Entscheidungen treffen, werden durch das Erdbeben entweder getötet oder durch die Desinformation und das Chaos entmachtet, das das Beben auslöst: Eine Wache verlangt auf Befehl des Vizekönigs die Räumung einer Kirche, doch der Befehl wird nicht befolgt mit der Begründung, „es gäbe keinen Vizekönig von Chili mehr“16 (eine Falschinformation). Es werden zwar Galgen aufgebaut, um Diebe zu bestrafen, doch werden in der allgemeinen Unordnung Unschuldige erhängt.17 Der Erzbischof ist tot, die Äbtissin ebenfalls.18
[...]
1 Vgl. Kittler, Friedrich A.: Diskursanalyse. Ein Erdbeben in Chili und Preußen. In: Wellbery, D.E. (Hrsg): Positionen der Literaturwissenschaft. Acht Modellanalysen am Beispiel von Kleists „Das Erdbeben in Chili“. München: C.H. Beck (1987), S. 25f.
2 National Geographical Data Center, Significant Earthquake Search, Sorted by Date, Year 1647: (Hyperlink: http://www.ngdc.noaa.gov/nndc/struts/results?bt_0=&st_0=&type_17=EXACT&query_17=None+Selected&op_12=eq&v_12=CHILE&type_12=Or&query_14=None+Selected&type_3=Like&query_3=&st_1=&bt_2=&st_2=&bt_1=&bt_4=6.0&st_4=9.9&bt_5=&st_5=&bt_6=&st_6=&bt_7=&st_7=&bt_8=&st_8=&bt_9=&st_9=&bt_10=&st_10=&type_11=Exact&query_11=&type_16=Exact&query_16=&display_look=1&t=101650&s=1&submit_all=Search+Database; zuletzt aufgerufen am 4.02.2014)
3 National Geophysical Data Center, Comments for the Tsunami Event (Hyperlink: http://www.ngdc.noaa.gov/nndc/struts/results?eq_0=1339&t=101650&s=18&d=99,91,95,93&nd=display; zuletzt aufgerufen am 4.02.2014)
4 NGDC, http://www.ngdc.noaa.gov/nndc/struts/results?bt_0=&st_0=&type_17=EXACT&query_17=130&op_12=eq&v_12=PORTUGAL&type_12=Or&query_14=None+Selected&type_3=Like&query_3=&st_1=&bt_2=&st_2=&bt_1=&bt_4=&st_4=&bt_5=&st_5=&bt_6=&st_6=&bt_7=&st_7=&bt_8=&st_8=&bt_9=&st_9=&bt_10=&st_10=&type_11=Exact&query_11=&type_16=Exact&query_16=&bt_18=&st_18=&ge_19=&le_19=&display_look=1&t=101650&s=1&submit_all=Search+Database
5 Jeronimo dankt Gott erst für seine Rettung, nur um ihn gleich darauf für „fürchterlich“ (S. 147) zu halten, je nachdem, was ihm gerade durch den Kopf geht. Später bei einer Predigt wird das Ereignis vom Chorherren als Strafe Gottes für das „Sittenverderbnis der Stadt“ (S. 155) gedeutet, für das er Jeronimo und Josephe als Beispiele nennt. Da eben diese beiden aber das Erdbeben im Gegensatz zu zahlreichen, vermeintlich moralisch aufrechten und religiösen Bürgern wie dem Erzbischof oder den Karmeliterinnen überlebt haben, ist auch dieser Vorschlag mit dem Wissen des Lesers nicht logisch nachvollziehbar. Das Erdbeben kann also keinen vernünftigen gottgegebenen Grund haben.
6 Vgl. S. 144.
7 S. 144.
8 S. 144.
9 S. 144.
10 S. 144.
11 S. 144.
12 S. 145.
13 S. 145.
14 S. 146-149.
15 Auch das Kloster muss hier zur Legislative zählen, da zu Beginn explizit erwähnt wird, Josephe habe „das klösterliche Gesetz“ (S.145) gebrochen.
16 S. 151.
17 S. 152.
18 S. 148.
Häufig gestellte Fragen
Wovon handelt Kleists Novelle „Das Erdbeben in Chili“?
Sie behandelt ein verheerendes Erdbeben in Santiago de Chile im Jahr 1647 und dessen Auswirkungen auf das verbotene Liebesverhältnis zwischen Jeronimo und Josephe.
Was symbolisiert das Erdbeben in der Erzählung?
Das Beben führt zur Dekonstruktion der sozialen „Welt“, indem es systematisch Instanzen der Kontrolle wie Gefängnisse, Klöster und Paläste zerstört.
Warum wird Josephe zum Tode verurteilt?
Sie hat als Nonne im Kloster ein Kind zur Welt gebracht, was als schwerer Verstoß gegen die klösterlichen Gesetze und die soziale Ordnung gewertet wird.
Welche Rolle spielt die soziale Schicht der Protagonisten?
Jeronimo ist ein einfacher Hauslehrer, Josephe gehört dem Adel an. Ihre Liebe gilt als Grenzüberschreitung, die die starren sozialen Welten Santiagos bedroht.
Was ist die „Theodizee-Frage“ im Kontext des Erdbebens?
Es ist die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes angesichts solcher Katastrophen. Kleist zeigt, wie Menschen die Katastrophe oft fälschlicherweise als göttliche Rache interpretieren.
- Citar trabajo
- Johanna Mandelartz (Autor), 2014, Die (De-/Re-)Konstruktion von Welt durch Erde in Kleists Novelle "Das Erdbeben in Chili", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/455728