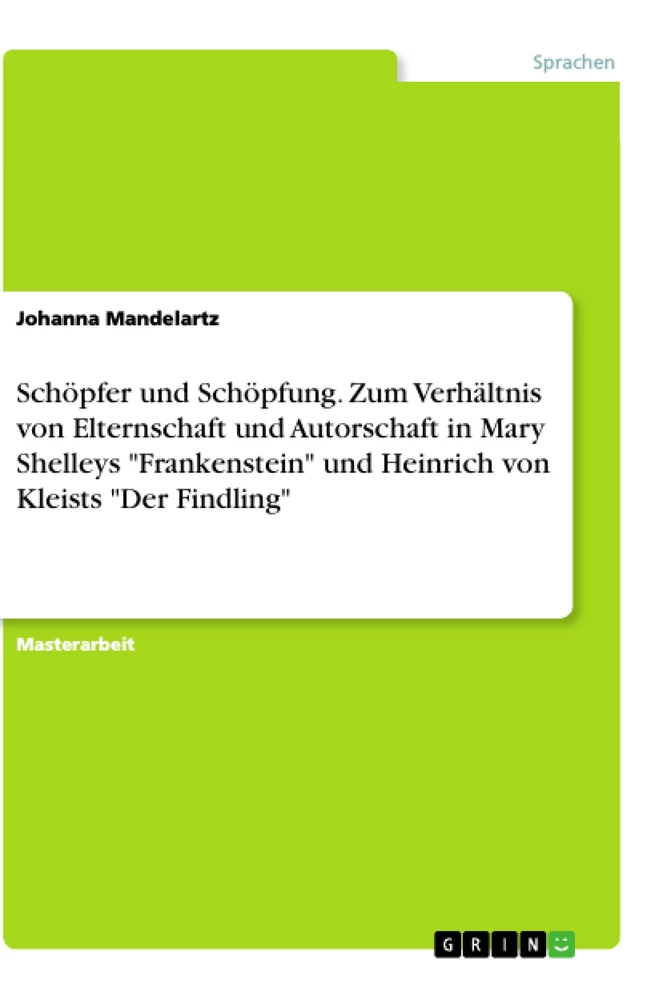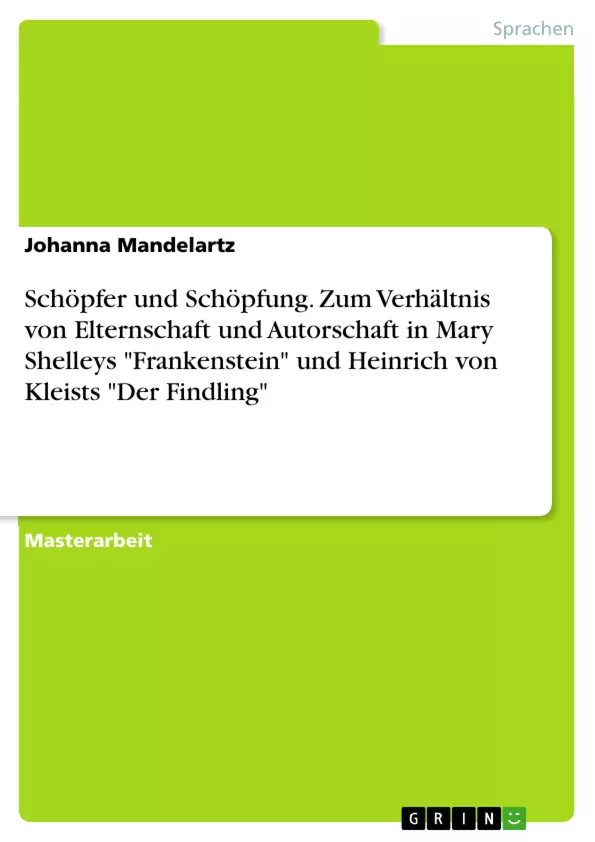Im Verlauf dieser Arbeit möchte ich einige Fragen beantworten, die sich einerseits auf die konkret in den Texten dargestellte Elternschaft, andererseits auf deren mögliche Interpretation als Autorschaftsmodell beziehen. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Eltern-Kind-Beziehung, wie sie in den Texten dargestellt wird, vom Autor des Textes als Aussage über die Beziehung zwischen Autor und Werk gedacht ist, der Text also die Umstände und Gründe seiner eigenen Entstehung und Existenz reflektiert. Die behandelte Literatur ist selbstreflexiv. Daher werden auch Erwähnungen von Schriftstücken in den Texten genauer untersucht. Frankenstein und Der Findling werden dabei zunächst unabhängig voneinander untersucht, damit sich die Zusammenhänge innerhalb des jeweiligen Textes deutlicher abzeichnen. Dabei sollen folgende Fragen beantwortet werden:
1. Welchen „Zweck“ hat Elternschaft diesen Texten zufolge für Eltern, weshalb entscheiden sie sich trotz der damit verbundenen Mühen und Kosten dafür, Kinder großzuziehen?
2. Welche möglichen Gründe liegen der „künstlichen“ Vaterschaft von Antonio Piachi und Victor Frankenstein zugrunde?
3. Wie unterscheidet sich die künstliche Herstellung des Elternschaftsverhältnisses von der natürlichen?
4. Wirken sich diese Unterschiede auf die Eltern-Kind-Beziehung aus und wenn ja, in welcher Form?
5. Ist künstliche Elternschaft im Hinblick auf die angestrebten Zwecke der Eltern als geeigneter Ersatz zu betrachten?
6. Was bezwecken Autoren diesem Modell zufolge mit dem Erschaffen von Werken?
7. Wie entsteht diesem Modell zufolge ein literarisches Werk? Wer ist an seiner Entstehung beteiligt?
8. Wie verhalten sich dem dargestellten Autorschaftsmodell zufolge Autor und Text zueinander, nachdem das Werk fertiggestellt wurde und welche Rolle spielt die Artifizialität, die der Autorschaft eigen ist, dabei?
9. Wie beantwortet das dargestellte Autorschaftsmodell die Frage, ob die Autoren mit ihrem Zielvorhaben beim Verfassen der Werke Erfolg haben?
10. Welche Vorstellung von Schöpfung liegt diesem Modell zugrunde?
11. Was haben die Autorschaftsmodelle, die Frankenstein und Der Findling zugrundeliegen, gemeinsam, was unterscheidet sie?
12. Welche Auswirkungen haben Schrift-Erzeugnisse auf den Verlauf der Handlung und welche Bedeutung tragen sie für die Einschätzung des Romans bzw. der Novelle für den Leser?
Inhaltsverzeichnis
- Elternschaft und Autorschaft: Eine jahrtausendealte Tradition.
- Elternschaft und Autorschaft in 'Frankenstein' und 'Der Findling'.
- Vorgehen
- Fragestellungen
- Zur Einordnung in den historischen Kontext: Elternschaft und Autorschaft zu Beginn des 19. Jahrhunderts
- Elternschaft im 19. Jahrhundert: Vom 'Haus' zur Kernfamilie
- Autorschaft und Rechtsverständnis: Entwicklung des Urheberrechts bis zum 19. Jahrhundert
- Elternschaft als Autorschaft in 'Der Findling'
- Elternschaftskonstellationen in 'Der Findling'
- Das Findlingsmodell von Autorschaft
- Elternschaft als Autorschaft in 'Frankenstein'
- Elternschaftskonstellationen in 'Frankenstein'
- Das Frankensteinmodell von Autorschaft
- 'Frankenstein' und 'Der Findling': Gemeinsamkeiten und Unterschiede der präsentierten Autorschaftsmodelle
- Künstlich generierte Elternschaft in 'Frankenstein' und 'Der Findling'
- Autorschaft als notwendig scheiternde Elternschaft?
- Schrift-Erzeugnisse in 'Frankenstein' und 'Der Findling': Vom Erzeugnis zum Zeugen
- Die Aufhebung der Vernichtung durch Fortschreibung und Rezeption
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit dem Verhältnis von Elternschaft und Autorschaft, indem sie die beiden Romane 'Frankenstein' von Mary Shelley und 'Der Findling' von Heinrich von Kleist analysiert. Ziel ist es, die verschiedenen Aspekte der elterlichen und autorschaftlichen Schöpfung in den beiden Texten zu untersuchen und die von ihnen präsentierten Modelle von Autorschaft zu vergleichen.
- Die historische Entwicklung von Elternschaft und Autorschaft im 19. Jahrhundert
- Die Rolle der Sprache und der Schöpfung in den beiden Texten
- Die verschiedenen Konstellationen von Elternschaft in 'Frankenstein' und 'Der Findling'
- Der Einfluss der elterlichen Verantwortung auf die autorschaftliche Schöpfung
- Die Rezeption und Weiterentwicklung der beiden Werke
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel untersucht die historische Entwicklung von Elternschaft und Autorschaft im 19. Jahrhundert, indem es den Wandel von der Großfamilie zur Kernfamilie und die Entstehung des Urheberrechts beleuchtet. Im zweiten Kapitel werden die verschiedenen Konstellationen von Elternschaft in 'Der Findling' analysiert, um anschließend das Findlingsmodell von Autorschaft zu erarbeiten. Das dritte Kapitel untersucht die Elternschaftskonstellationen in 'Frankenstein' und entwickelt daraus das Frankensteinmodell von Autorschaft. Das vierte Kapitel vergleicht die beiden Modelle von Autorschaft und analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Es wird auch auf die Rolle der künstlich generierten Elternschaft in beiden Texten eingegangen. Im fünften Kapitel wird die These der "Autorschaft als notwendig scheiternde Elternschaft" diskutiert. Das sechste Kapitel analysiert die Schrift-Erzeugnisse in 'Frankenstein' und 'Der Findling' und untersucht ihre Rolle als Zeugnisse ihrer jeweiligen Schöpfung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Elternschaft, Autorschaft, Schöpfung, Sprache, 'Frankenstein', 'Der Findling', 19. Jahrhundert, historische Kontext, Familienmodelle, Urheberrecht, Modellanalyse, Rezeption und Weiterentwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Elternschaft und Autorschaft in dieser Analyse zusammen?
Die Arbeit interpretiert die Eltern-Kind-Beziehung in den Texten als Metapher für das Verhältnis zwischen Autor und Werk (Schöpfer und Schöpfung).
Welche Werke werden miteinander verglichen?
Untersucht werden Mary Shelleys Roman "Frankenstein" und Heinrich von Kleists Novelle "Der Findling".
Was ist das "Frankensteinmodell" von Autorschaft?
Es beschreibt die künstliche Herstellung eines Wesens (oder Werks) und die daraus resultierende Verantwortung sowie das potenzielle Scheitern des Schöpfers an seiner Schöpfung.
Welche Rolle spielen Schrift-Erzeugnisse in den Geschichten?
Schriftstücke (Briefe, Dokumente) fungieren als Zeugen der Schöpfung und reflektieren die Umstände der Existenz des literarischen Werks selbst.
Wie wird die "künstliche Vaterschaft" von Victor Frankenstein und Antonio Piachi bewertet?
Die Arbeit untersucht, ob künstliche Elternschaft ein geeigneter Ersatz für die natürliche ist und welche Zwecke die Väter mit dieser Form der Schöpfung verfolgen.
Inwiefern ist die behandelte Literatur "selbstreflexiv"?
Die Texte reflektieren ihre eigene Entstehung und Existenz durch die Darstellung von Schöpfungsprozessen innerhalb der Handlung.
- Quote paper
- Johanna Mandelartz (Author), 2015, Schöpfer und Schöpfung. Zum Verhältnis von Elternschaft und Autorschaft in Mary Shelleys "Frankenstein" und Heinrich von Kleists "Der Findling", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/455788