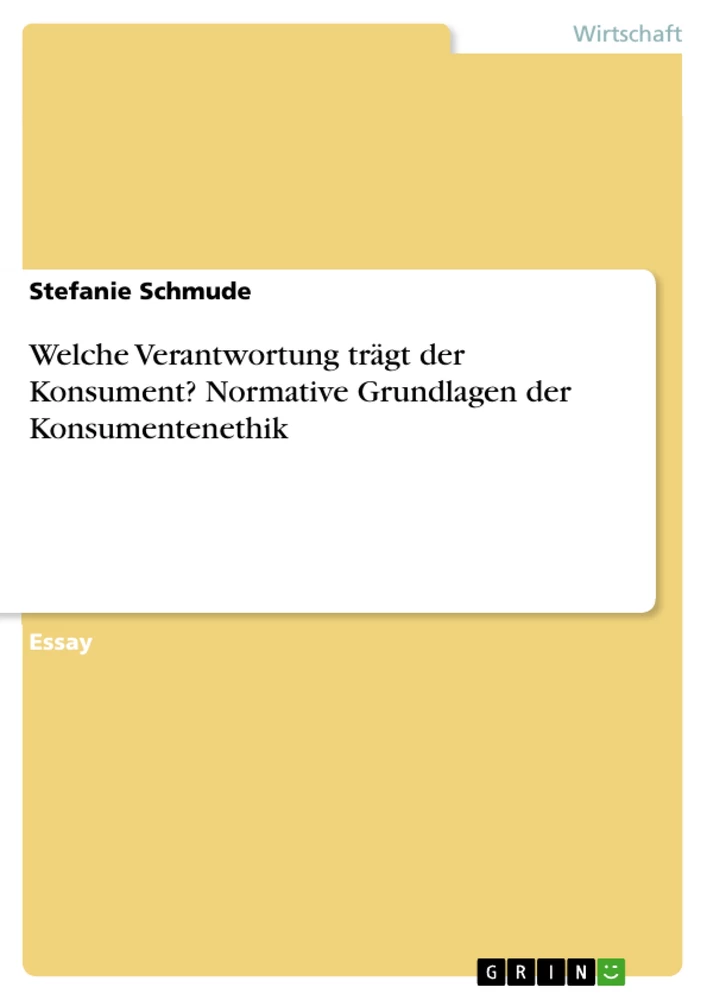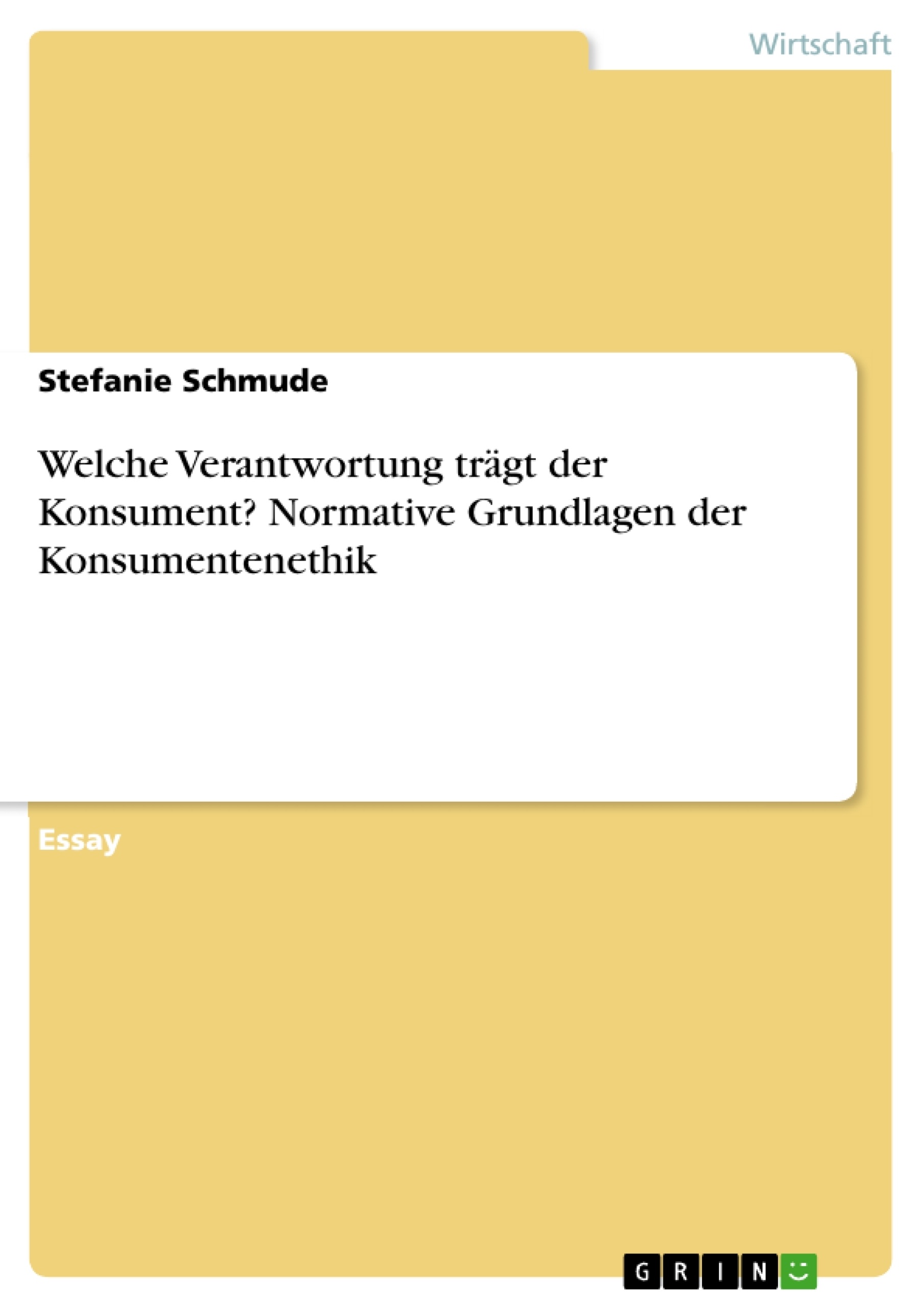Der vorliegende Essay betrachtet das Thema Konsum aus einer ethischen Perspektive und beleuchtet dazu die Konzepte der Konsumentenverantwortung (Consumer Social Responsibility) und der Unternehmensverantwortung (Corporate Social Responsibility).
Zuerst wird das Konzept der Konsumentenverantwortung dargelegt. Das Prinzip der Konsumentenverantwortung beruht auf drei normativen Grundlagen, die Michael Neuner als die Norm der Fürsorgeverantwortung des Konsumenten für sich selbst, die Norm der Naturverträglichkeit und die Norm der Sozialverträglichkeit definiert.
Die Unternehmensverantwortung unterscheidet sich von der Konsumentenverantwortung darin, dass die Unternehmen eine kollektive moralische Verantwortung besitzen, die sich unabhängig von der individuellen Verantwortung der Mitglieder dem Unternehmen zuschreiben lässt.
Inhaltsverzeichnis
- Drei normative Grundlagen der Konsumentenverantwortung
- Die Fürsorgeverantwortung des Konsumenten für sich selbst
- Die Norm der Naturverträglichkeit
- Die Norm der Sozialverträglichkeit
- Die Konzepte der Konsumentenverantwortung (Consumer Social Responsibility) und der Unternehmensverantwortung (Corporate Social Responsibility)
- Unterschiede zwischen Konsumenten- und Unternehmensverantwortung
- Die Verschränkung von Konsumentenverantwortung und Unternehmensverantwortung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Dokument analysiert das Prinzip der Konsumentenverantwortung, indem es drei normative Grundlagen, nämlich die Fürsorgeverantwortung, die Naturverträglichkeit und die Sozialverträglichkeit, untersucht. Es werden die Konzepte der Konsumentenverantwortung (Consumer Social Responsibility) und der Unternehmensverantwortung (Corporate Social Responsibility) miteinander verglichen und die Verschränkung beider Konzepte im Hinblick auf nachhaltigen Konsum beleuchtet.
- Die drei normativen Grundlagen der Konsumentenverantwortung
- Die Unterschiede zwischen Konsumenten- und Unternehmensverantwortung
- Die Bedeutung der moralischen Verantwortung im Kontext von Konsum und Unternehmen
- Die Verschränkung von Konsumenten- und Unternehmensverantwortung für nachhaltigen Konsum
- Die Rolle des "Consumer Citizen" im Hinblick auf verantwortungsvolles Konsumverhalten
Zusammenfassung der Kapitel
Drei normative Grundlagen der Konsumentenverantwortung
Dieser Abschnitt definiert die drei normativen Grundlagen der Konsumentenverantwortung: die Fürsorgeverantwortung des Konsumenten für sich selbst, die Norm der Naturverträglichkeit und die Norm der Sozialverträglichkeit. Er beleuchtet die Bedeutung jeder Norm im Hinblick auf nachhaltigen Konsum und bietet konkrete Beispiele für die Anwendung dieser Normen im Alltag.
Die Konzepte der Konsumentenverantwortung (Consumer Social Responsibility) und der Unternehmensverantwortung (Corporate Social Responsibility)
Dieser Abschnitt analysiert die Unterschiede zwischen Konsumenten- und Unternehmensverantwortung und betont die kollektive moralische Verantwortung von Individuen im Kontext der Konsumentenverantwortung. Er untersucht die spezifische Verantwortungsethische Asymmetrie zwischen Unternehmen und Konsumenten und erläutert die Bedeutung eines bewussten und informierten Konsumverhaltens im Einklang mit individuellen Werthaltungen.
Häufig gestellte Fragen zur Konsumentenethik
Was versteht man unter Konsumentenverantwortung (Consumer Social Responsibility)?
Es beschreibt die ethische Pflicht des Einzelnen, bei Kaufentscheidungen soziale, ökologische und persönliche Konsequenzen zu berücksichtigen.
Welche drei normativen Grundlagen definierte Michael Neuner?
Die Grundlagen sind: 1. Fürsorgeverantwortung für sich selbst, 2. Naturverträglichkeit und 3. Sozialverträglichkeit.
Wie unterscheidet sich Konsumenten- von Unternehmensverantwortung?
Unternehmen tragen eine kollektive moralische Verantwortung (CSR), während die Konsumentenverantwortung auf der individuellen moralischen Entscheidung des Einzelnen basiert.
Was bedeutet die Norm der Naturverträglichkeit?
Sie fordert vom Konsumenten, Produkte zu wählen, die die Umweltressourcen schonen und ökologische Schäden minimieren.
Welche Rolle spielt der „Consumer Citizen“?
Der Consumer Citizen nutzt seine Kaufkraft als politisches Instrument, um durch verantwortungsvolles Konsumverhalten gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen.
- Arbeit zitieren
- Stefanie Schmude (Autor:in), 2013, Welche Verantwortung trägt der Konsument? Normative Grundlagen der Konsumentenethik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/456896