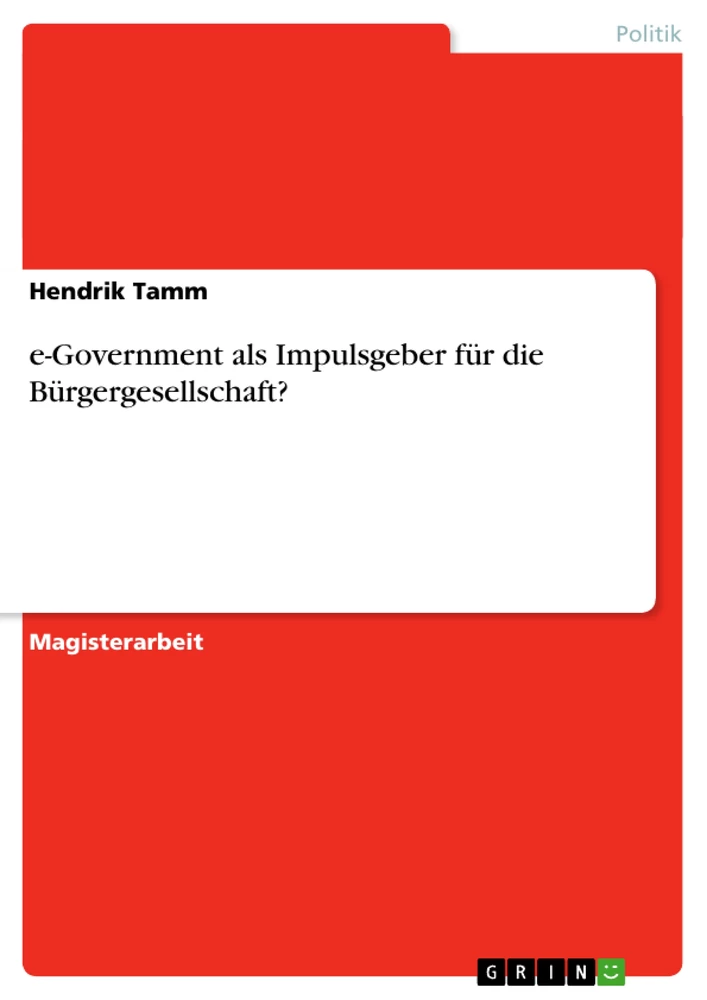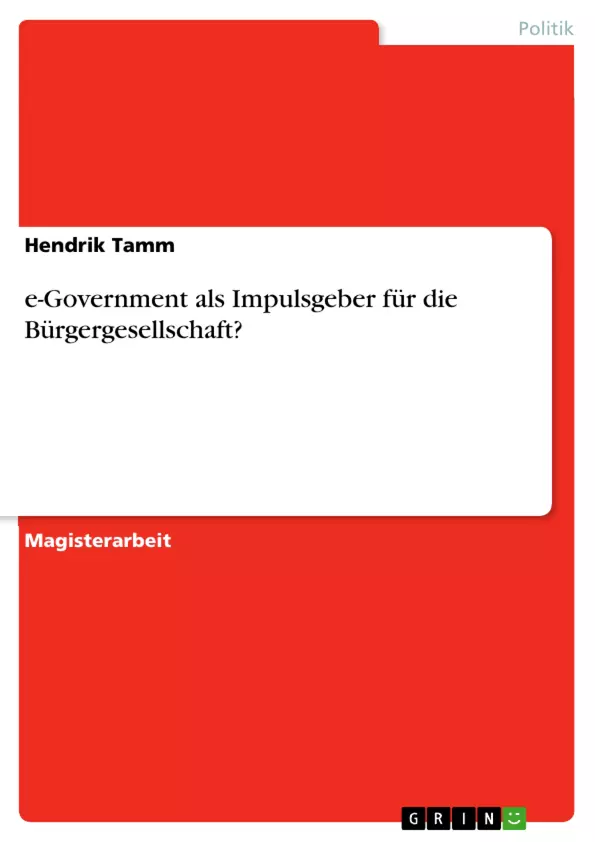Das politische System der Bundesrepublik Deutschland befindet sich in einer Strukturkrise.
Wahlenthaltung und Mitgliederschwund bei politischen Parteien auf der einen sowie überlastete Sozialkassen und anhaltend hohe Arbeitslosenzahlen auf der anderen Seite gehen bei den Bürgern mit einer „Erosion des Vertrauens in ihre repräsentativen Institutionen“ einher. In der aktuellen gesellschaftspolitischen Diskussion wird das Leitbild der Bürgergesellschaft als möglicher Ausweg aus dieser Krise gesehen. Im Gegensatz zum oft angeführten Zerfall sozialer Bindungen, soll sie die Gesellschaft wieder aktivieren und eine verantwortungsvolle Neuverteilung von Aufgaben und Verantwortung zwischen Staat und Gesellschaft ermöglichen.
Dies ist dringend notwendig, da die öffentlichen Haushalte, unter hronischer Finanznot leidend, ihre Aufgabenwahrnehmung in vielen Bereichen überprüfen müssen. Neue
Handlungsspielräume soll in dieser Situation das e-Government schaffen. In Analogie zur Entwicklung des e-Commerces und e-Businesses wird hierbei die Leistungserstellung öffentlicher Aufgaben mittels intensiver Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK-Technologien) grundlegend reorganisiert. Bereits heute nutzen rund 60 Prozent der deutschen Behörden das e-Government, um ihre Aufgaben bürgerfreundlicher,
transparenter sowie effizienter und effektiver durchzuführen.
Als Oberbegriff für das elektronische Regieren und Verwalten beschränkt sich das e-Government jedoch nicht auf die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen, sondern erfasst das gesamte politische System. So werden durch die Veränderungen der Kommunikations- und Interaktionsstrukturen zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung neue Beteiligungsoptionen am politischen Prozess ermöglicht, wie sie auch die Bürgergesellschaft einfordert. e-Government als Impulsgeber für die Bürgergesellschaft? Eine Antwort muss jetzt gegeben werden, da in vielen Städten und Gemeinden die Entscheidung, ob das e-Government primär zur
Verwaltungsreform, zur Verbesserung der Bürgernähe oder einfach als virtuelles Schaufenster genutzt werden soll, noch keineswegs gefallen ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung und Gang der Untersuchung
- THEORETISCHE GRUNDLAGEN
- Demokratietheoretische Grundlagen
- Partizipatorische Demokratietheorie
- Liberale Theorie der Repräsentativdemokratie
- Direkte Demokratie
- Kritische Betrachtung der Demokratietheorien
- Leitbild der Bürgergesellschaft
- Internet und e-Government
- Grundstrukturen des Internets
- e-Government - Eine Begriffsbestimmung
- Nutzerstrukturen des Internets
- Öffentlichkeit und Kommunikation im Internet
- Sicherheit im Internet
- Politische Partizipation und Internet
- Politische Partizipation im repräsentativen System der Bundesrepublik Deutschland
- Politische Partizipation über das Internet
- Internet als bürgergesellschaftliches Medium?
- Internet im politischen Prozess
- Anwendungen politischer Partizipation im e-Government
- Download und FAQ
- Online-Diskussionsforen
- e-Voting
- Bürgernetze
- PRAKTISCHE UMSETZUNG DES e-GOVERNMENTS UND DESSEN AUSWIRKUNGEN
- e-Government in Verwaltung und Politik
- e-Government in der öffentlichen Verwaltung
- e-Government im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung
- Auswirkungen des e-Governments auf Verwaltungsprozesse
- Transparenz im Verwaltungshandeln
- e-Government im Spannungsverhältnis zwischen Verwaltung und Politik
- e-Government mit leeren Kassen
- Politische Steuerung im e-Government
- Handlungsbedarf der Politik
- Zwischenfazit
- Auswirkungen des e-Governments auf die Interaktion zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung
- e-Government als Schnittstelle zwischen Bürgern und Verwaltung
- e-Government als Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung
- e-Government als Schnittstelle zwischen Bürgern und Politik
- Zwischenfazit
- Beispielhafte Darstellung des e-Governments
- e-Government auf Bundes- und Landesebene
- www.bund.de - Das Dienstleistungsportal des Bundes
- www.elektronische-demokratie.de
- e-Government in Nordrhein-Westfalen
- Das virtuelle Rathaus: Stand des e-Governments in den deutschen Kommunen
- Das publikom – Stadtnetz für Münster
- Stadtportal bremen-online
- Landkreis Ostholstein
- Zwischenfazit
- e-GOVERNMENT ALS IMPULSGEBER FÜR DIE BÜRGERGESELLSCHAFT?
- Literaturverzeichnis
- Verwendete Quellen und Studien
- Zitierte Literatur
- Zitierte Gesetze und Verordnungen
- Anhang
- Befragung politischer Entscheidungsträger
- Befragung von Verwaltungsinstitutionen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht die Rolle des e-Governments als Impulsgeber für die Bürgergesellschaft. Sie analysiert die theoretischen Grundlagen von Demokratie und Bürgergesellschaft im Kontext des Internets und des e-Governments.
- Die Auswirkungen des e-Governments auf die politische Partizipation und die Interaktion zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung.
- Die Frage, ob das e-Government tatsächlich die Bürgergesellschaft stärkt und zu einer aktivierenden Bürgerbeteiligung führt.
- Die praktische Umsetzung des e-Governments auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene.
- Die Herausforderungen und Chancen des e-Governments im Hinblick auf Transparenz, Effizienz und Bürgerfreundlichkeit.
- Die kritische Betrachtung der Potenziale und Grenzen des e-Governments als Instrument der politischen Gestaltung.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Fragestellung und den Aufbau der Arbeit vor. Sie erläutert den Forschungsgegenstand und die Relevanz des Themas e-Government im Kontext der Bürgergesellschaft.
- Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel analysiert die relevanten Demokratietheorien und beleuchtet die Rolle des Internets und des e-Governments in der politischen Partizipation und der Gestaltung der Bürgergesellschaft.
- Praktische Umsetzung des e-Governments: Dieses Kapitel untersucht die praktische Umsetzung des e-Governments in Verwaltung und Politik. Es beleuchtet die Auswirkungen auf Verwaltungsprozesse, die Interaktion zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung und die Herausforderungen der politischen Steuerung.
- Beispielhafte Darstellung des e-Governments: Dieses Kapitel bietet einen Einblick in die praktische Umsetzung des e-Governments auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. Es analysiert ausgewählte Beispiele und zeigt den aktuellen Stand des e-Governments in Deutschland.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Schlüsselbegriffe e-Government, Bürgergesellschaft, politische Partizipation, Demokratie, Internet, Verwaltung, Politik, Transparenz, Effizienz und Bürgerfreundlichkeit. Darüber hinaus werden wichtige Themen wie Verwaltungsmodernisierung, Online-Kommunikation, e-Voting, Bürgernetze und die kritische Betrachtung der Potenziale und Grenzen des e-Governments behandelt.
- Quote paper
- Hendrik Tamm (Author), 2001, e-Government als Impulsgeber für die Bürgergesellschaft?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4569