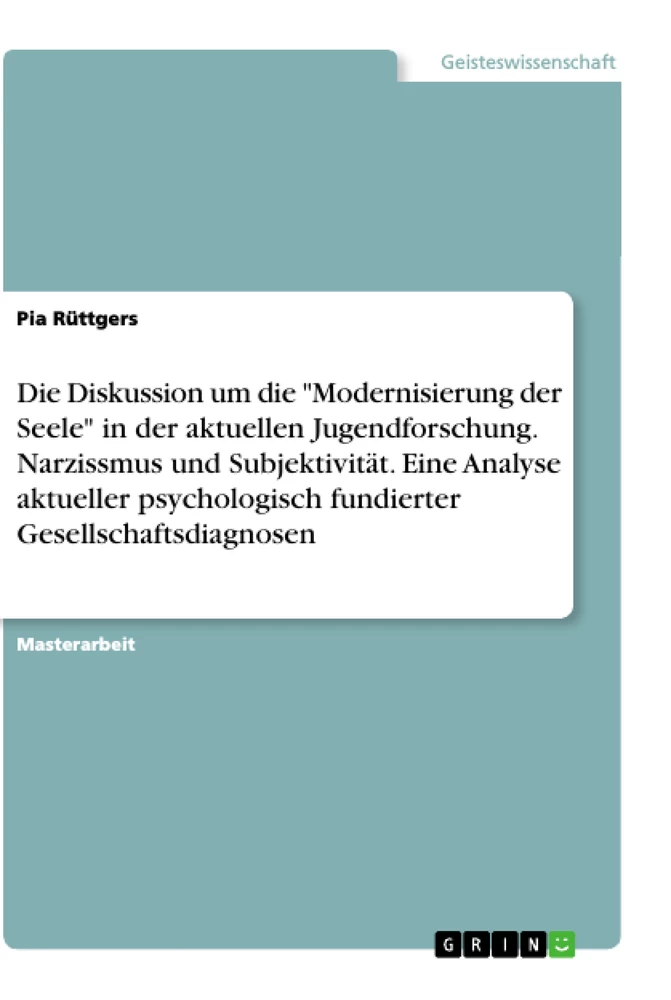Aktuelle Diagnosen über den Zustand der modernen Gesellschaft bereiten zuweilen großes Unbehagen. Insbesondere aus soziologischer Perspektive sehen wir uns häufig gesamtgesellschaftlichen Entwicklungsungetümen ausgesetzt, die nicht nur unsere äußere Lebenswelt, sondern auch unser Innenleben zunehmend „kolonisieren“. So konstatieren zum Beispiel Lessenich et al. in ihrer Kapitalismus-Kritik eine „fundamentale[...] Mobilisierungstendenz der Moderne, welche den lähmenden Fremdzwang repressiver Sozialformation mittels […] politischer Steuerung unablässig […] in ruhelosen Selbstzwang verwandelt und dabei die unauflösbaren Widersprüche der durch jene Kapitalbewegung bestimmten Gesellschaftsformation in die Subjekte hineinverlagert.“
Solche und andere soziologische Gesellschaftsdiagnosen bilden auch den Hintergrund für eine Vielzahl von Beiträgen, die sich in oft kritischer Weise dezidiert mit den Folgen sozialen Wandels für die individuelle Entwicklung und Selbstbildung befassen. Ein Blick auf die Titel der Publikationen zu diesem Thema weckt allerdings den Verdacht einer Dramatisierungstendenz, insbesondere bei Beiträgen, in denen aus entsprechenden Diagnosen offenbar pädagogische Appelle generiert werden. Die gesellschaftlichen Bedingungen von Entwicklung (und Erziehung) werden darin häufig als „gestört“ oder „pathogen“ deklariert und vor dem Hintergrund der Topoi wie 'Entfremdung', 'Identitätslosigkeit' oder 'individueller Pathologie' Ideale menschlicher Entwicklung konstruiert.
In dieser Arbeit sollen zunächst exemplarisch zwei gesellschaftliche „Verfallsdiagnosen“ eingehend analysiert und beurteilt werden. Im zweiten Teil dieser Arbeit wird sich kontrastierend mit einem Beitrag beschäftigt werden, der entgegen der vorangegangenen Verfallsdiagnosen von Gesellschaft und modernen Charakteren die psychischen Folgen gesellschaftlicher Veränderungen auffallend positiv bewertet.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Zwei Beispiele aktueller Verfallsdiagnosen und der Sinn des Sprachspiels narzisstischer Pathologie
- 1.1 H.-J. Maaz: „Der Lilith-Komplex“ und „Die Narzisstische Gesellschaft“
- 1.2 P. V. Zima: „Narzissmus und Ichideal“
- 1.3 Erste Beurteilung und zentrale Begriffe der Beiträge von Maaz und Zima
- 1.4 Psychoanalytische Narzissmus-Theorien
- 1.4.1 'Narzissmus' - Begriffsdefinitionen
- 1.4.2 'Primärer' und 'sekundärer' Narzissmus
- 1.4.3 Zur narzisstischen Pathologie
- 1.4.4 Narzissmus in der Adoleszenz und im mittleren Lebensalter
- 1.4.5 Narzissmus aus der Perspektive von Struktur und Wandel der psychischen Struktur
- 1.5 Eine psychoanalytisch fundierte Kritik der Beiträge von Maaz und Zima
- 1.5.1 Falsche Mütterlichkeit und pathologischer Narzissmus (Maaz)
- 1.5.2 Narzissmus und „echte“ Subjektivität (Zima)
- 1.5.2.1 Narzissmus als Bewusstseinstyp
- 1.5.2.2 Ich-Ideal und Ideal-Ich
- 1.5.2.3 Subjektivität und Narzissmus: ein dialogisches Modell
- 1.5.2.4 Narzissmus als Kompensation für den Verlust individueller Autonomie
- 1.5.2.5 Abschließende Beurteilung von „Narzissmus und Ichideal\" unter dem Fokus von Subjektivität und Beziehungserfahrung
- 1.6 Fazit: Narzissmus und Gesellschaftskritik
- 1.6.1 Verschiedene psychoanalytische Grundannahmen von 'Narzissmus'
- 1.6.2 Narzisstische Individualpathologien und narzisstische Gesellschaftspathologie (Maaz)
- 1.6.3 Argumentativer Brückenschlag vom Niedergang der Werte zum Niedergang von individueller Subjektivität (Zima)
- 1.7 Diskursanalytische Ergänzungen nach A. Ehrenberg
- 1.7.1 'Narzissmus' als Sprachspiel zeitgenössischer demokratischer Gesellschaft
- 1.7.2 'Narzissmus' und die Sorge um den Niedergang republikanischer Werte (Frankreich)
- 1.7.3 'Narzissmus' und die Rückbesinnung auf den Wert individueller Verantwortung (USA)
- 1.7.4 'Narzissmus' als Sprachspiel – Fazit und Kritik
- 1.7.5 Abschließende Beurteilungen der Beiträge von Maaz und Zima unter besonderer Berücksichtigung von '(individueller) Autonomie' und '(gesellschaftlicher) Heteronomie' (nach Ehrenberg)
- 1.7.5.1 Abschließende Beurteilung von „Lilith-Komplex“ und „Die narzisstische Gesellschaft\" (Maaz)
- 1.7.5.2 Abschließende Beurteilung von „Narzissmus und Ich-ideal“ (Zima)
- 1.8 Abschließender Kommentar zur Eignung des psychoanalytischen Narzissmus-Begriffs für zeitgenössische Gesellschaftskritik
- 2. Dornes',,Modernisierung der Seele“
- 2.1 Theoretische Grundannahmen und empirische Befunde zu verbessertern Etern-Kind-Beziehungen der Gegenwart - Darstellung und Kritik
- 2.2 Zu Dornes' These einer Erleichterung adoleszenter Konflikte
- 2.3 Dornes' These einer „Verflüssigung“ der psychischen Struktur – Psychische Widerstandsfähigkeit versus Regression
- 2.4 Dornes' Kritik an gesellschaftlichen Verfallsdiagnosen
- 2.4.1 Allgemeine Kritik im Sinne gestiegener Problemsensibilität
- 2.4.2 Spezifische Kritik an generalisierenden Diagnosen narzisstischer Pathologie
- 2.5 Methodenkritik
- Problem begrifflicher Unschärfen
- 2.6 Dornes' Strukturwandlungsthese - Darstellung und Kritik zur Reichweite der von Dornes rezipierten Befunde und zu dem
- 3. Narzissmus, „,echte“ Subjektivität und die Errettung des (postmodernen) Subjekts?
- 4. Schluss
- Analyse von zwei aktuellen Verfallsdiagnosen: Hans Joachim Maaz und Peter V. Zima
- Einordnung von Maaz' und Zimas Thesen in den Kontext psychoanalytischer Narzissmus-Theorien
- Kritik an den Diagnosen von Maaz und Zima unter Einbezug psychoanalytischer und diskursanalytischer Perspektiven
- Gegenüberstellung der Verfallsdiagnosen mit der „Modernisierung der Seele“-These von M. Dornes
- Diskussion der Bedeutung von „echter“ Subjektivität in der gegenwärtigen Gesellschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit von Pia Rüttgers untersucht die aktuelle Debatte um die „Modernisierung der Seele“ in der Jugendforschung und analysiert, inwiefern sich die Konzepte von Narzissmus und Subjektivität in zeitgenössischen Gesellschaftsdiagnosen manifestieren.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Analyse zweier aktueller Verfallsdiagnosen von Hans Joachim Maaz und Peter V. Zima, die aus psychoanalytischer Perspektive Kritik an gegenwärtigen Entwicklungen üben. Die Autorin untersucht die Argumente beider Autoren im Detail und setzt sie in Bezug zu zentralen Begriffen und Theorien der psychoanalytischen Narzissmus-Forschung. Es werden sowohl die Stärken als auch die Schwächen der Diagnosen von Maaz und Zima herausgearbeitet und eine kritische Beurteilung aus psychoanalytischer Perspektive vorgenommen. Zudem werden diskursanalytische Überlegungen von A. Ehrenberg einbezogen, um die Sinnstrukturen der Narzissmus-Debatte zu beleuchten. Im zweiten Teil der Arbeit wird sich mit dem kontrastierenden Beitrag von M. Dornes beschäftigt, der entgegen den vorangegangenen Verfallsdiagnosen von Gesellschaft und modernen Charakteren die psychischen Folgen gesellschaftlicher Veränderungen positiv bewertet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen Narzissmus, Subjektivität, Gesellschaftskritik, psychoanalytische Theorie, Diskursanalyse, Modernisierung, Jugendforschung, Verfallsdiagnosen und „Modernisierung der Seele“. Darüber hinaus spielen wichtige Konzepte wie „falsche Mütterlichkeit“, „echte Subjektivität“, „Ich-Ideal“ und „individuelle Autonomie“ eine bedeutende Rolle.
- Quote paper
- Pia Rüttgers (Author), 2014, Die Diskussion um die "Modernisierung der Seele" in der aktuellen Jugendforschung. Narzissmus und Subjektivität. Eine Analyse aktueller psychologisch fundierter Gesellschaftsdiagnosen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/457189