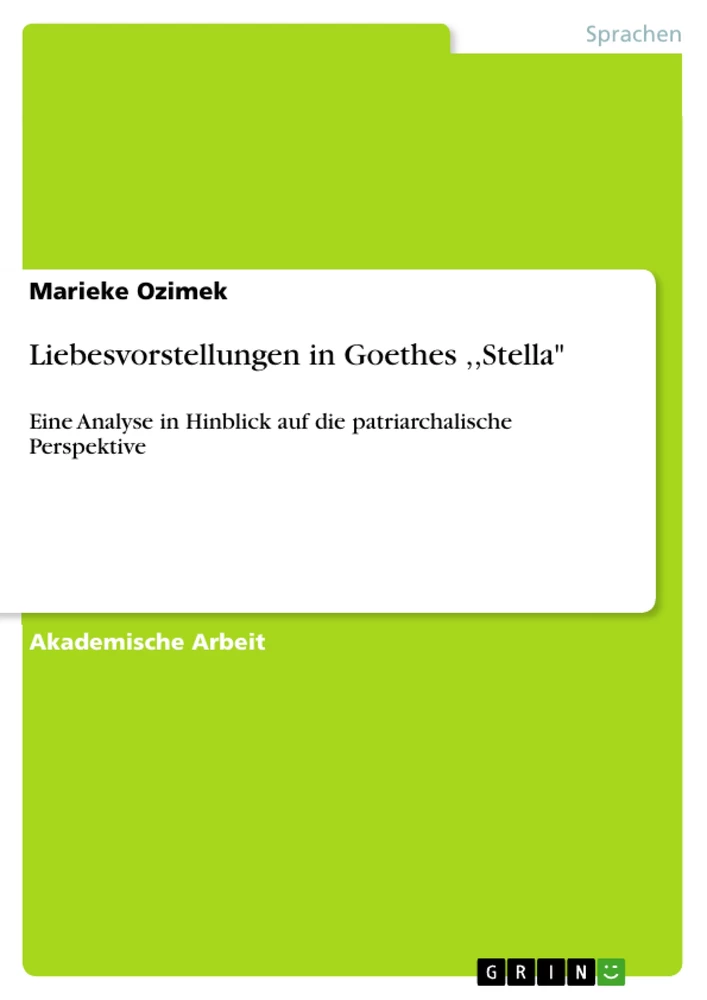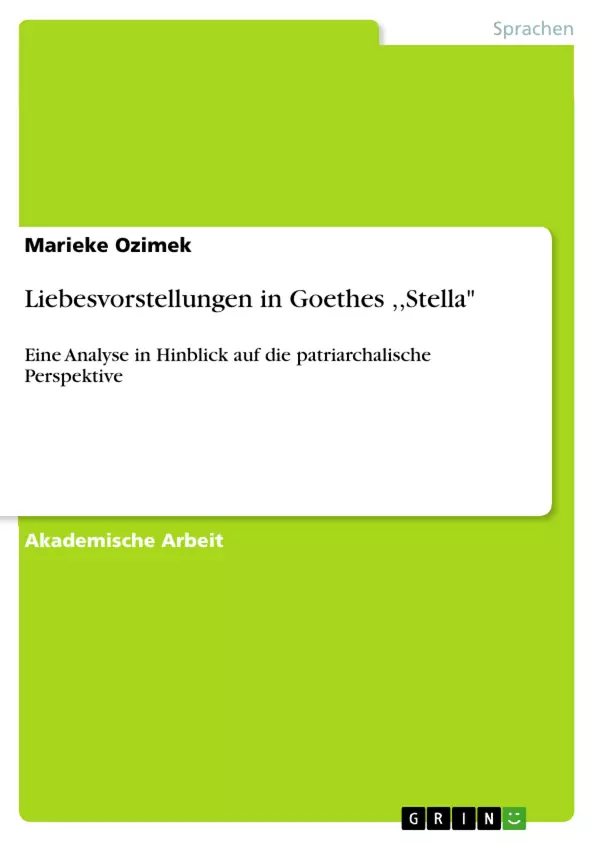In dieser Hausarbeit wird untersucht, inwiefern die unterschiedlichen Liebesvorstellungen in ,,Stella'' den patriarchalischen Charakter des Stücks begünstigen. Dazu werden unterschiedliche Aspekte von ,,Stella'' näher beleuchtet, um zu ermitteln, ob und wenn ja wie die von Goethe vorgenommene Gestaltung dieser Aspekte bzw. Kategorien den männlichen Blickwinkel begünstigt.
Zwei Frauen lieben einen Mann. Dieser verlässt zunächst die eigene Ehefrau für die Geliebte, findet bei ihr allerdings auch keinen Halt. Nach Jahren der Trennung treffen alle drei Akteure zufällig wieder aufeinander und nun könnte ein Jeder, der den weiteren Verlauf der Geschichte nicht kennt, davon ausgehen, dass sich dieses Wiedersehen zumindest durch ein Schamgefühl des Mannes, als auch Vorwürfen der beiden Frauen auszeichnet. Eine so tiefe Kränkung, dass die weiblichen Akteure Cezilie und Stella nichts mehr von dem Ehemann und Geliebten Fernando wissen wollen, wäre somit durchaus nachvollziehbar. Goethes ,,Schauspiel für Liebende'' jedoch präferiert einen dazu völlig divergenten Verlauf der Geschichte, sodass vor allem das Ende der ersten Fassung, das eine Zukunft zu dritt unterbreitet, die Frage aufwirft, ob diese ''Lösung'' so funktionieren kann bzw. ob eine Liebesutopie zugrunde liegt.
In dieser Arbeit wird zunächst wird das Liebesverhältnis zwischen Mann und Frau im 18. Jahrhundert untersucht, um aufzuzeigen, dass die von der Empfindsamkeit propagierte Liebe einen deutlichen Gegensatz zu der Alltagsrealität dargestellt hat. Anschließend soll die bereits zuvor thematisierte Exklusion des Individuums, dessen Theorie auf Niklas Luhmann zurückzuführen ist, kurz dargestellt und auf dieser Grundlage aufgezeigt werden, wie dieser Konflikt Fernandos Verhalten stützt.
Das darauf folgende Kapitel ,,Empfindungen bei Cezilie und Stella'' geht insbesondere auf den divergenten Umgang mit Emotionen und Gefühlen ein, um so herauszuarbeiten, dass trotz der bestehenden Unterschiede zwischen beiden weiblichen Akteuren auch hier wiedereine Bekräftigung der männlichen Verhaltensweise stattfindet. Anschließend werden zusätzlich Lucie und die Postmeisterin analysiert, um zu untersuchen, ob diese beiden Charaktere aufgrund ihres Daseins ohne Mann einen entscheidenden emanzipatorischen Gegensatz zu Stella und Cezilie darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. „Stella\" und die Vorstellung von der Liebe
- 2.1. Liebe zwischen Mann und Frau im 18. Jahrhundert
- 2.2. „Inneres Leben\" vs. „,Äußeres Leben”
- 2.3. Empfindungen bei Cezilie und Stella
- 2.4. Lucie und die Postmeisterin als Gegenpole?
- 2.5. Liebe als Religion
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern die verschiedenen Liebesvorstellungen in Goethes „Stella\" den patriarchalischen Charakter des Stückes begünstigen. Hierfür werden unterschiedliche Aspekte des Stücks, wie die Rolle der Frau in der Gesellschaft des 18. Jahrhunderts, die Darstellung von Emotionen und das Verhältnis von Liebe und Religion, beleuchtet.
- Die Rolle der Frau im 18. Jahrhundert und die Idee der empfindsamen Liebe
- Die Darstellung von Emotionen bei Cezilie und Stella im Kontext des männlichen Blickwinkels
- Die Kontrastierung von Stella und Cezilie mit Lucie und der Postmeisterin
- Der Einfluss religiöser Elemente auf die Liebesvorstellungen in „Stella”
- Die Utopie des „glücklichen“ Dreiecks im Kontext der patriarchalischen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich dem Liebesverhältnis zwischen Mann und Frau im 18. Jahrhundert und zeigt auf, dass die von der Empfindsamkeit propagierte Liebe einen deutlichen Gegensatz zur Alltagsrealität darstellte. Das zweite Kapitel analysiert die unterschiedlichen Emotionen und Empfindungen von Cezilie und Stella, wobei die männliche Perspektive im Mittelpunkt steht. Im dritten Kapitel werden Lucie und die Postmeisterin als potenzielle Gegenpole zu Stella und Cezilie untersucht. Das vierte Kapitel befasst sich mit den religiösen Elementen in „Stella“ und analysiert die Utopie der Dreiecksbeziehung im Kontext des Stückendes.
Schlüsselwörter
Die Arbeit analysiert die unterschiedlichen Liebesvorstellungen in Goethes „Stella“ vor dem Hintergrund der patriarchalischen Strukturen des 18. Jahrhunderts. Schlüsselbegriffe sind Empfindsamkeit, Liebe, Emotionen, Geschlechterrollen, Utopie, Religion, Cezilie, Stella, Fernando.
Welche Liebesvorstellungen thematisiert Goethe in „Stella“?
Das Stück behandelt die empfindsame Liebe des 18. Jahrhunderts und entwirft in der ersten Fassung eine Liebesutopie in Form einer Dreiecksbeziehung zwischen einem Mann und zwei Frauen.
Inwiefern hat „Stella“ einen patriarchalischen Charakter?
Die Arbeit untersucht, wie die Gestaltung der weiblichen Rollen (Cezilie und Stella) und deren bedingungslose Liebe zum Protagonisten Fernando den männlichen Blickwinkel und dessen Verhalten begünstigen.
Wer sind die Gegenpole zu Stella und Cezilie?
Lucie und die Postmeisterin werden als Charaktere analysiert, die aufgrund ihres Lebens ohne Mann einen potenziell emanzipatorischen Gegensatz zu den Hauptfiguren darstellen könnten.
Welche Rolle spielt die Empfindsamkeit im Stück?
Die Empfindsamkeit prägt den Umgang mit Emotionen. Die Arbeit zeigt jedoch auf, dass diese idealisierte Liebe oft im krassen Gegensatz zur gesellschaftlichen Alltagsrealität der Frauen stand.
Wie wird das Ende der ersten Fassung interpretiert?
Das Ende, eine „Zukunft zu dritt“, wird als Liebesutopie hinterfragt, die letztlich die Kränkungen der Frauen ignoriert und die Position des Mannes stützt.