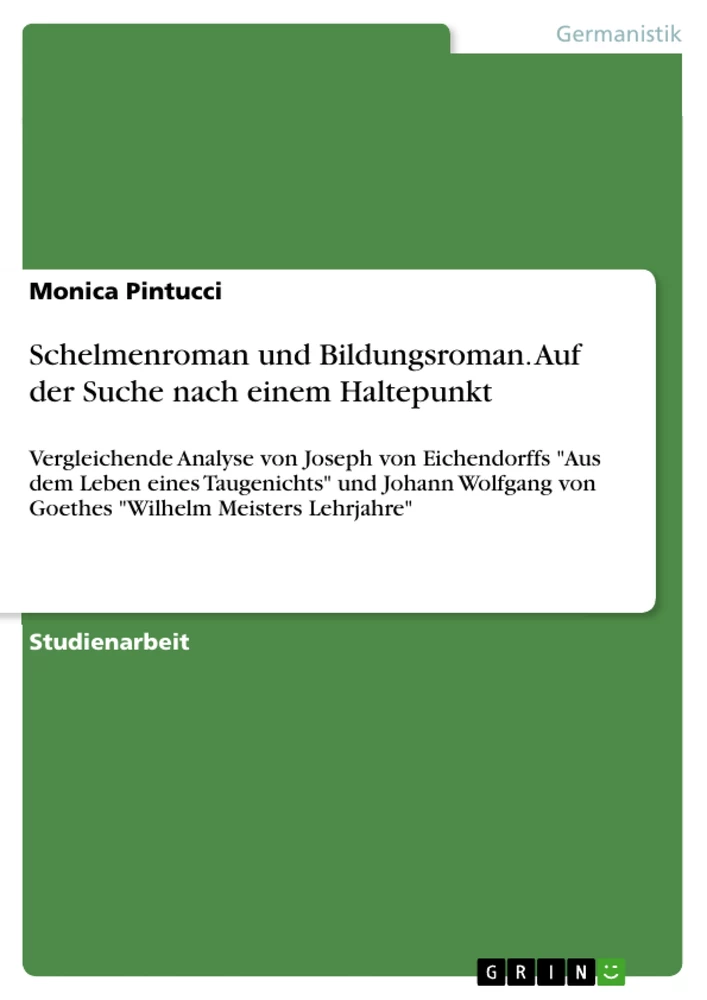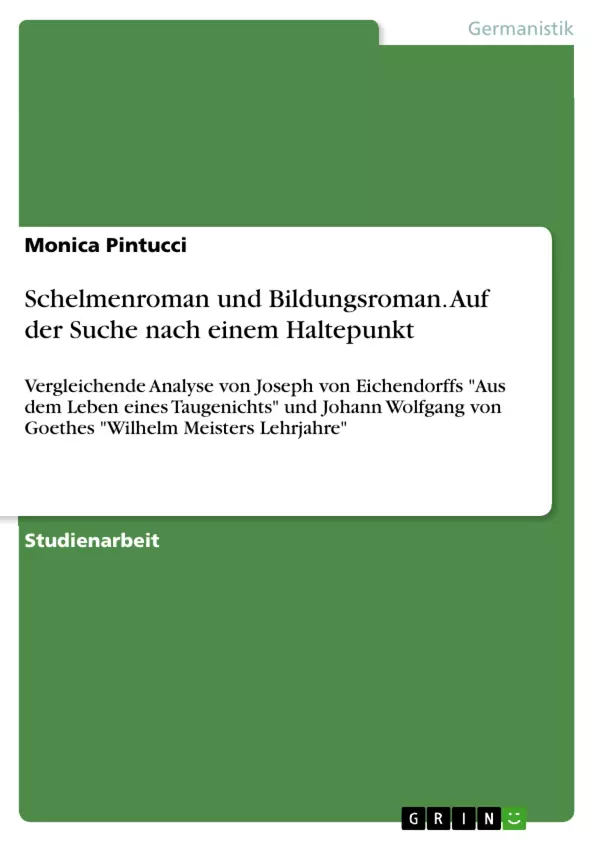Die im Fokus der vorliegenden Studie stehende Analyse von zwei antithetischen Figuren aus der deutschen Literatur. Genauer gesagt, aus zwei unterschiedlichen Romantypen, und zwar Goethes 1795/96 erschienenem "Wilhelm Meister Lehrjahren" und Eichendorffs erstmals im Jahr 1826 erschienenem "Aus dem Leben eines Taugenichts". Sie schildert deren beide gegensätzlichen Naturen und Geisteszustände, die unterschiedlichen Lebensauffassungen von zwei Welten: Einerseits wird der Zustand der Unbeweglichkeit und kindlicher Unmündigkeit, die die Taugenichts-Figur kennzeichnen, untersucht, andererseits wird Wilhelm Meisters geistiger Fortschritt, vom kindlichen Seelenleben zur Selbstvervollkommnung, umständlich beschrieben.
Wenn man die Eichendorffsche Geschichte und deren Ansatz genauer hinschaut, kann man ohnehin nicht so pauschal von einem Roman sprechen, sondern von einer Novelle, die sowohl Züge eines Märchens trägt, indem Eichendorff wiederentdeckte Volksliedmotive aufgriff, als auch durch die einfache und naive Sprache des Taugenichts gekennzeichnet ist.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Die Begriffe Bildungsroman und Schelmenroman
- Kontingenz und Kausalität
- Die Auseinandersetzung zwischen Individuum und Wirklichkeit
- Psychologische Zugänge
- Die Allegorie der kontextgebundenen Wahrnehmung der Wirklichkeit
- Unmündigkeit und Passivität beim Taugenichts
- Vollendete Humanität
- Die Einstellung zur Liebe
- Vom Schein zum Sein
- Erziehendes Werk vs. Märchen
- Die schöne alte Zeit: Natur und Kindheit
- Unmittelbarkeit und Leichtigkeit des Erlebens
- Schönheit vs. Zweckmäßigkeit
- Die bürgerliche Lebensweise
- Handlungen und Ausdruck
- Dialektisches Streben
- Die Fremde
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Studie analysiert die gegensätzlichen Naturen und Geisteszustände der Figuren Wilhelm Meister und des Taugenichts aus Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre und Eichendorffs Aus dem Leben eines Taugenichts. Sie untersucht die unterschiedlichen Lebensauffassungen, die sich in den Romanen widerspiegeln. Die Studie beleuchtet den Gegensatz zwischen kindlicher Unmündigkeit und geistigem Fortschritt, der zwischen den beiden Figuren deutlich wird.
- Die Definition und Entwicklung der Begriffe Bildungsroman und Schelmenroman
- Der Gegensatz zwischen Kontingenz und Kausalität im Leben der Figuren
- Die Auseinandersetzung zwischen Individuum und Wirklichkeit in beiden Romanen
- Psychologische Zugänge zu den Figuren und ihrer Entwicklung
- Die Darstellung der Welt und der Wahrnehmung der Wirklichkeit in beiden Romanen
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort führt in die Thematik der Studie ein und stellt die beiden Figuren sowie die unterschiedlichen Romantypen vor, die analysiert werden. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den Begriffen Bildungsroman und Schelmenroman und zeigt, wie sich die beiden Genres in den beiden Romanen manifestieren. Kapitel drei beleuchtet die Gegensätze zwischen Kontingenz und Kausalität, die sich in der Lebensweise der Figuren widerspiegeln. Das vierte Kapitel analysiert die Auseinandersetzung zwischen Individuum und Wirklichkeit in beiden Romanen, während das fünfte Kapitel psychologische Zugänge zu den Figuren und ihrer Entwicklung beleuchtet. Im sechsten Kapitel wird die Darstellung der Welt und der Wahrnehmung der Wirklichkeit in beiden Romanen untersucht. Das siebte Kapitel betrachtet die Unmündigkeit und Passivität des Taugenichts, während das achte Kapitel die Vollendete Humanität von Wilhelm Meister in den Fokus rückt. Das neunte Kapitel beschäftigt sich mit der Einstellung zur Liebe in beiden Romanen, während das zehnte Kapitel die Thematik des Schein und Seins untersucht. Kapitel elf vergleicht das erziehende Werk mit dem Märchen im Kontext der beiden Romane. Das zwölfte Kapitel beleuchtet die Darstellung der Natur und Kindheit als "schöne alte Zeit" in beiden Romanen. Das dreizehnte Kapitel untersucht die Unmittelbarkeit und Leichtigkeit des Erlebens, während das vierzehnte Kapitel die Gegensätze zwischen Schönheit und Zweckmäßigkeit thematisiert. Das fünfzehnte Kapitel analysiert die Darstellung der bürgerlichen Lebensweise in den beiden Romanen. Das sechzehnte Kapitel beleuchtet die Handlungen und den Ausdruck der Figuren. Das siebzehnte Kapitel beschäftigt sich mit dem dialektischen Streben der Figuren nach Selbstfindung und Erkenntnis, und das achtzehnte Kapitel betrachtet die Bedeutung der Fremde in den Romanen.
Schlüsselwörter
Die Studie behandelt wichtige Themen wie den Bildungsroman und den Schelmenroman, die gegensätzlichen Lebensauffassungen und die Auseinandersetzung zwischen Individuum und Wirklichkeit. Weitere Schwerpunkte sind die Psychologische Analyse der Figuren, die Darstellung der Welt und der Wahrnehmung der Wirklichkeit sowie die Themen Unmündigkeit, Vollendete Humanität, Liebe, Schein und Sein, Erziehungsarbeit und die „schöne alte Zeit“. Darüber hinaus werden die Darstellung von Natur und Kindheit, Unmittelbarkeit und Leichtigkeit des Erlebens sowie die Gegensätze zwischen Schönheit und Zweckmäßigkeit und die Darstellung der bürgerlichen Lebensweise untersucht.
- Arbeit zitieren
- M.A. Monica Pintucci (Autor:in), 2000, Schelmenroman und Bildungsroman. Auf der Suche nach einem Haltepunkt, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/458240