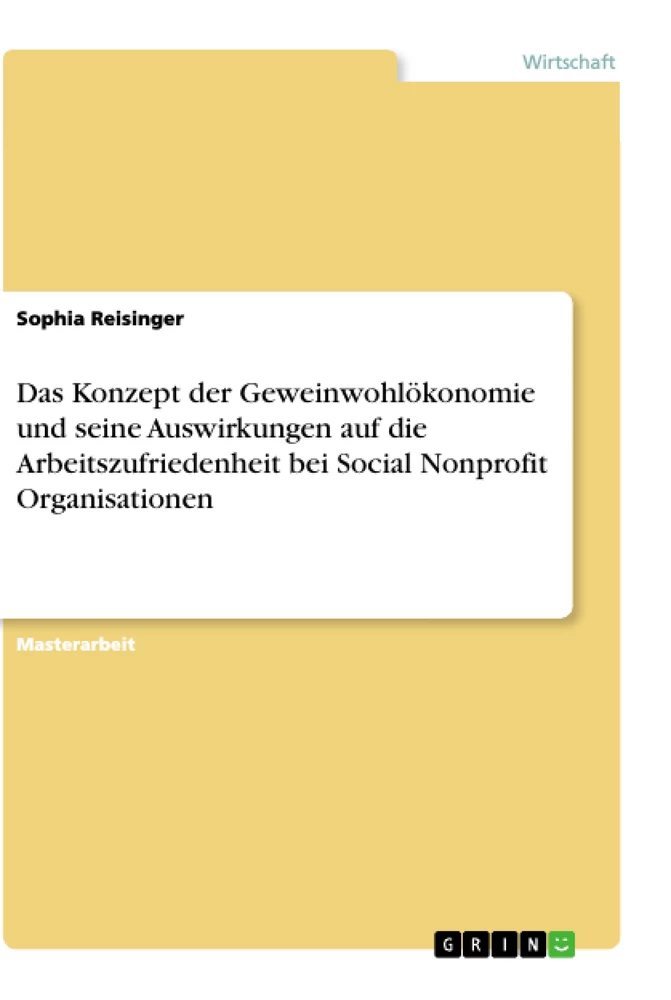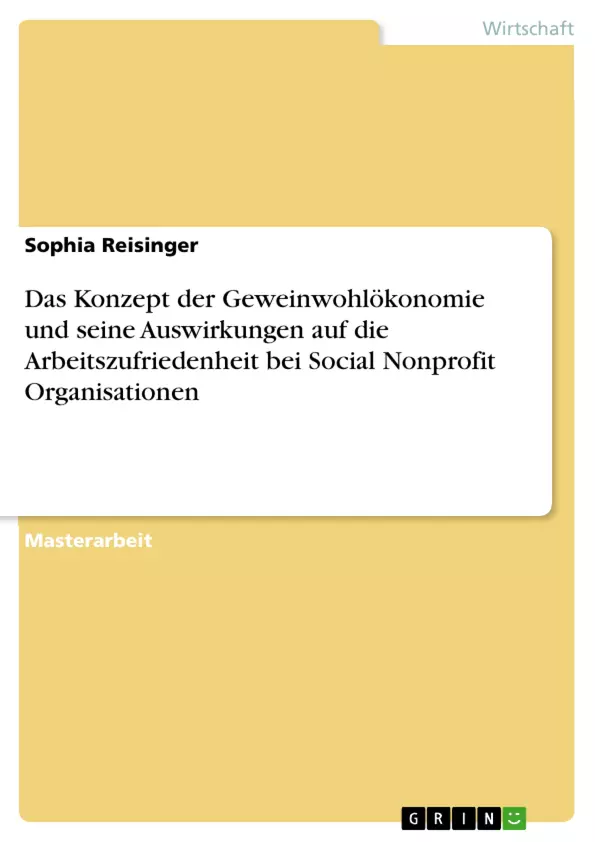Diese Arbeit befasst sich am Beispiel des Konzeptes der Gemeinwohl Ökonomie mit den Auswirkungen solcher Konzepte auf die Arbeitszufriedenheit bei Social Nonprofit Organizations.
Ziel des Werkes ist es, den Prozess der Gemeinwohl Ökonomie vorzustellen, den großen Sozialmanagementbereich der MitarbeiterInnenzufriedenheit darzustellen, Modelle aufzuzeigen und für die konkrete Fragestellung abzuwägen. Mit dieser Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, wie sich die Befindlichkeit der MitarbeiterInnen nach dem Beitritt, eventuellen ersten Testungen und Beurteilungen durch die "Gemeinwohl-Ökonomie" und eventuell folgenden Veränderungen in der Mitarbeiterführung geändert hat. Die forschungsleitende Annahme besteht, dass sich die Arbeitszufriedenheit in den teilnehmenden Unternehmen verbessert, wenn nicht sogar stark verbessert hat.
Nach einer Vorstellung der Gemeinwohl Ökonomie und ihrer fünf Aspekte folgt im Aufbau der Arbeit der große Theorieteil der Arbeitszufriedenheit. Nach der Definition bzw. Abgrenzung des Begriffs werden verschiedene Bedingungen, Variablen und Schwerpunkte in der Herangehensweise an das Thema vorgestellt. Danach folgt in chronologischer Folge des Entstehens eine Auflistung verschiedener Modelle der Arbeitszufriedenheit. Bevor über die eigene Forschung berichtet wird, werden verschiedene Messverfahren erörtert. Nach einem Artikel zur Arbeitspsychologie und Organisationspsychologie werden die für die Feldforschung gewählten Ansätze sowie die Ergebnisse erklärt. Diese werden abschließend nach verschiedenen Gesichtspunkten ausgewertet, beurteilt und interpretiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die „Gemeinwohl-Ökonomie“
- 2.1 Entstehungsgeschichte der Gemeinwohl-Ökonomie
- 2.2 Die drei Ebenen der Veränderung
- 2.2.1 Die wirtschaftliche Ebene
- 2.2.2 Die politische Ebene
- 2.2.3 Die gesellschaftliche Ebene
- 2.3 Die Bilanzerstellung
- 2.4 Der Aspekt der MitarbeiterInnen in dem Modell
- 2.4.1 Menschenwürde
- 2.4.2 Solidarität
- 2.4.3 Ökologische Nachhaltigkeit
- 2.4.4 Soziale Gerechtigkeit
- 2.4.5 Demokratische Mitbestimmung und Transparenz
- 3. Arbeitszufriedenheit
- 3.1 Definition und Abgrenzung der Arbeitszufriedenheit
- 3.1.1 Arbeitsfreude
- 3.1.2 Arbeits- und Leistungsmotivation
- 3.1.3 Commitment
- 3.1.4 Berufszufriedenheit
- 3.1.5 Einstellungen gegenüber der Arbeit („job attitudes“)
- 3.1.6 Arbeitszufriedenheit („job satisfaction“)
- 3.2 Bedingungen und Variablen der Arbeitszufriedenheit
- 3.3 Inhaltliche Schwerpunkte der Arbeitszufriedenheitsforschung
- 3.3.1 Physisch-ökonomischer Fokus
- 3.3.2 Sozialer Fokus
- 3.3.3 Selbstverwirklichungsorientierter Fokus
- 3.3.4 Persönlichkeitsorientierter Fokus
- 3.4 Theoretische Orientierungen der Arbeitszufriedenheitsforschung
- 3.4.1 Bedürfnistheoretischer Ansatz
- 3.4.2 Anreiztheoretischer Ansatz
- 3.4.3 Gleichgewichtstheoretische Ansätze
- 3.4.4 Humanistische Ansätze
- 3.5 Kritik am Modell
- 3.6 Modelle der Arbeitszufriedenheit
- 3.6.1 Die Bedürfnistheorien nach Murray
- 3.6.2 Die Bedürfnispyramide von Abraham Maslow
- 3.6.3 Die Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg
- 3.6.4 Die ERG-Theorie von Alderfer
- 3.6.5 Die Theorie von Lawler
- 3.6.6 Das Arbeitszufriedenheits-Modell von Bruggemann
- 3.6.7 Erweitertes Zufriedenheitsmodell nach Büssing
- 3.6.8 „Job Characteristics Model“ nach Hackman und Oldham
- 3.6.9 Aktuelle Forschung
- 3.7 Messung von Arbeitszufriedenheit
- 3.7.1 Qualitative, mündliche Interviews
- 3.7.2 Schriftliche Befragungen
- 3.7.3 Objektive Verfahren
- 4. Forschung/ Methode
- 4.1 Wissenschaftsfeld der Arbeits- und Organisationspsychologie
- 4.2 Feldforschung
- 4.2.1 Besonderheiten des Sozial-Non-Profit-Dienstleistungsbereichs
- 4.2.2 Untersuchungsdesign
- 4.2.3 Aufbau
- 4.2.4 Datenerhebung/Umsetzung
- 5. Ergebnisse
- 5.1 Ergebnisse nach den Kategorien der Gemeinwohl- Ökonomie
- 5.1.1 Arbeitszufriedenheit in Bezug auf die Menschenwürde
- 5.1.2 Arbeitszufriedenheit in Bezug auf die Solidarität
- 5.1.3 Arbeitszufriedenheit in Bezug auf die ökologische Nachhaltigkeit
- 5.1.4 Arbeitszufriedenheit in Bezug auf die soziale Gerechtigkeit
- 5.1.5 Arbeitszufriedenheit in Bezug auf Mitbestimmung und Transparenz
- 5.1.6 Arbeitszufriedenheit allgemein
- 5.2 Demografische Datenerhebung
- 5.3 Ergebnisse gesamt und Interpretation
- 5.5 Ausblick, Entwicklungschancen und Handlungsempfehlungen aus den gewonnenen Erkenntnissen
- 5.5.1 Entwicklungschancen und Handlungsempfehlungen in Bezug auf die Menschenwürde
- 5.5.2 Entwicklungschancen und Handlungsempfehlungen in Bezug auf die Solidarität
- 5.5.3 Entwicklungschancen und Handlungsempfehlungen in Bezug auf Mitbestimmung und Transparenz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Master-Thesis analysiert die Auswirkungen des Beitritts zum Prozess der Gemeinwohl-Ökonomie auf die Arbeitszufriedenheit in Sozial-Non-Profit-Organisationen. Sie untersucht, inwiefern die Anwendung der Gemeinwohl-Ökonomie-Kriterien, wie Menschenwürde, Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und demokratische Mitbestimmung, die Arbeitszufriedenheit der MitarbeiterInnen beeinflusst.
- Einfluss der Gemeinwohl-Ökonomie auf die Arbeitszufriedenheit
- Analyse der Auswirkungen der Gemeinwohl-Ökonomie-Kriterien auf verschiedene Aspekte der Arbeitszufriedenheit
- Vergleich der Arbeitszufriedenheit in Sozial-Non-Profit-Organisationen mit und ohne Gemeinwohl-Ökonomie-Zertifizierung
- Identifizierung von Faktoren, die die Arbeitszufriedenheit in Sozial-Non-Profit-Organisationen im Kontext der Gemeinwohl-Ökonomie beeinflussen
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die Steigerung der Arbeitszufriedenheit in Sozial-Non-Profit-Organisationen im Rahmen der Gemeinwohl-Ökonomie
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Master-Thesis ein und erläutert die Relevanz der Thematik im Kontext des steigenden Leistungsdrucks und der Konkurrenz im wirtschaftlichen und privaten Umfeld. Es wird betont, wie wichtig es ist, die MitarbeiterInnen in Sozial-Non-Profit-Organisationen zu motivieren und eine sinnhafte Arbeitsumgebung zu schaffen.
- Kapitel 2: Die „Gemeinwohl-Ökonomie“: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über das Konzept der Gemeinwohl-Ökonomie. Es beleuchtet die Entstehungsgeschichte, die drei Ebenen der Veränderung (wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich) und die zentralen Aspekte des Modells, wie Bilanzerstellung und die Berücksichtigung von Mitarbeiterinteressen.
- Kapitel 3: Arbeitszufriedenheit: Dieses Kapitel widmet sich dem Konzept der Arbeitszufriedenheit und stellt verschiedene Definitionen und Abgrenzungen vor. Es analysiert verschiedene Einflussfaktoren und Variablen der Arbeitszufriedenheit und beleuchtet verschiedene theoretische Ansätze und Modelle der Arbeitszufriedenheitsforschung.
- Kapitel 4: Forschung/ Methode: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Master-Thesis. Es geht auf die Besonderheiten der Feldforschung im Sozial-Non-Profit-Dienstleistungsbereich ein und erläutert das Untersuchungsdesign, den Aufbau der Datenerhebung und die Umsetzung der Forschungsmethodik.
- Kapitel 5: Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Es analysiert die Ergebnisse anhand der Kategorien der Gemeinwohl-Ökonomie und betrachtet die demografischen Daten der Befragten. Es bietet eine umfassende Interpretation der Ergebnisse und formuliert daraus Handlungsempfehlungen und einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Die Master-Thesis befasst sich mit dem Spannungsfeld zwischen Gemeinwohl-Ökonomie und Arbeitszufriedenheit. Sie analysiert die Auswirkungen des Beitritts zum Prozess der Gemeinwohl-Ökonomie auf die Arbeitszufriedenheit in Sozial-Non-Profit-Organisationen. Die zentralen Begriffe und Themengebiete sind: Gemeinwohl-Ökonomie, Sozial-Non-Profit-Organisationen, Arbeitszufriedenheit, Menschenwürde, Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, demokratische Mitbestimmung, Transparenz, Mitarbeitermotivation, Feldforschung, empirische Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ)?
Die GWÖ strebt ein Wirtschaftssystem an, das auf gemeinwohlfördernden Werten wie Menschenwürde, Solidarität und ökologischer Nachhaltigkeit basiert, statt auf reinem Gewinnstreben.
Wie beeinflusst die GWÖ die Arbeitszufriedenheit?
Die Forschungshypothese besagt, dass Kriterien wie demokratische Mitbestimmung und soziale Gerechtigkeit die Zufriedenheit der Mitarbeiter in Nonprofit-Organisationen verbessern.
Welche Theorien zur Arbeitszufriedenheit werden herangezogen?
Die Arbeit nutzt klassische Modelle wie die Bedürfnispyramide von Maslow, die Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg und das Job Characteristics Model.
Was sind die fünf Aspekte der Gemeinwohl-Bilanz für Mitarbeiter?
Diese umfassen Menschenwürde, Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit sowie demokratische Mitbestimmung und Transparenz.
Wie wurde die Forschung in dieser Master-Thesis durchgeführt?
Es wurde eine Feldforschung im Sozial-Non-Profit-Sektor mittels qualitativer Interviews und schriftlicher Befragungen durchgeführt.
- Citar trabajo
- Sophia Reisinger (Autor), 2012, Das Konzept der Geweinwohlökonomie und seine Auswirkungen auf die Arbeitszufriedenheit bei Social Nonprofit Organisationen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/458657