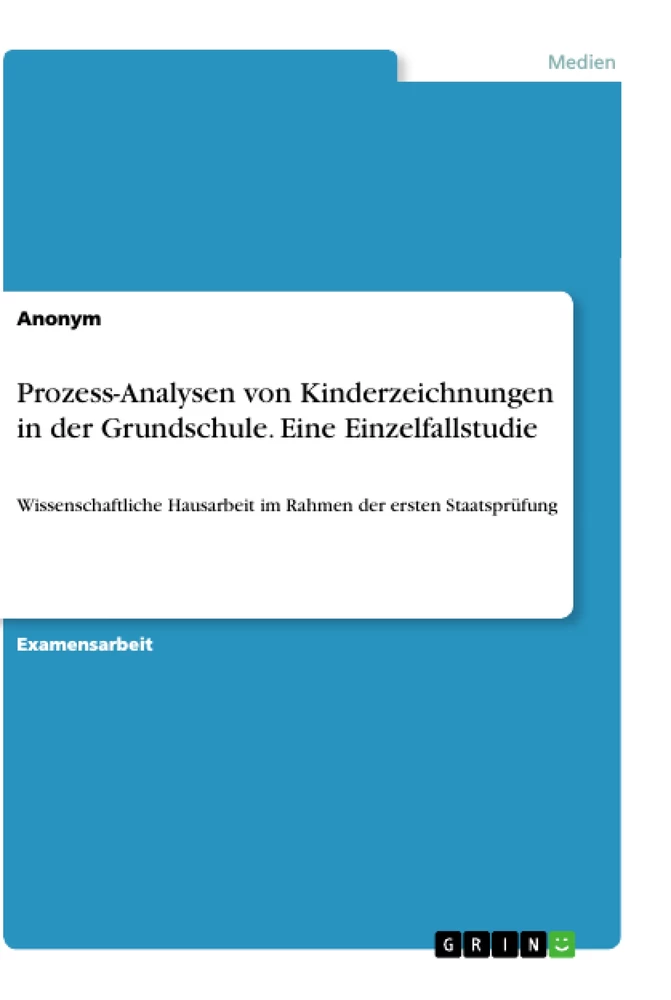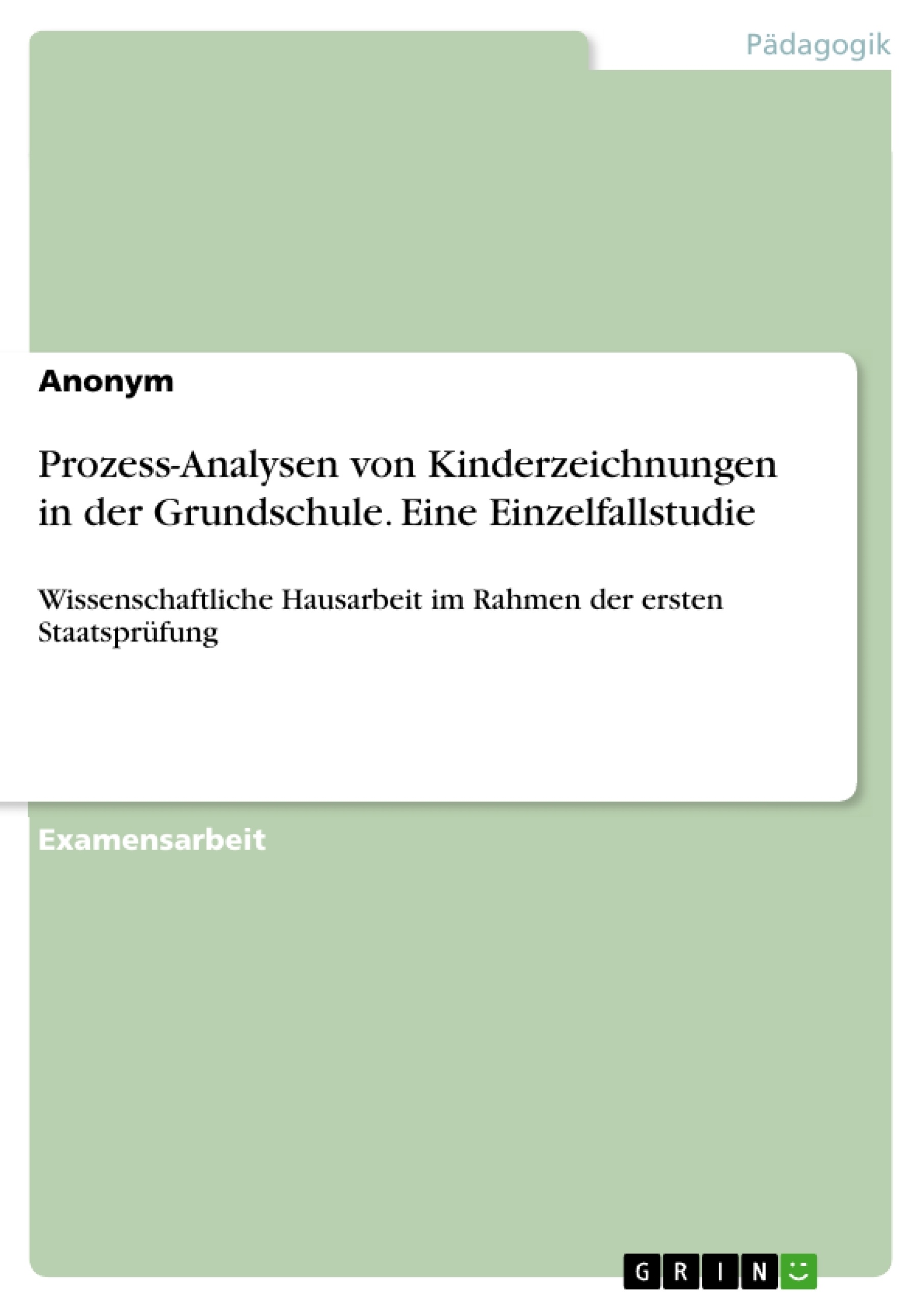Die „freie“ Kinderzeichnung hat sich am Ende des 19. Jahrhunderts durch die Kunsthistoriker und Kunstpädagogen etabliert. Der Begriff schließt das Malen mit Wasserfarben aus sowie auch andere Bereiche des bildnerischen Verhaltens, wie das Graffiti-Sprayen, Fotografieren und Gestalten am Computer. Die Kinderzeichnungsforschung ist ein eigener, traditionsreicher Bereich innerhalb der kunstpädagogischen Forschung, in dem das wissenschaftlich-forschende Selbstverständnis der Kunstpädagogik ihren Ursprung hat. Mittlerweile gibt es viele Veröffentlichungen, die einen Überblick aus kunstpädagogischer Perspektive über diesen Forschungsbereich geben. Darin werden die Untersuchungsergebnisse miteinander verknüpft und kritisch analysiert.
Diese Arbeit befasst sich zunächst mit den theoretischen Grundlagen der Kinderzeichnungsforschung. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für den zweiten, empirischen Teil. Im ersten Teil werden theoretische Grundlagen zur Kindheitsforschung in der Kunstpädagogik dargestellt. Daran anschließend wird auf die Schemaphase eingegangen, um den Entstehungsprozess der zu untersuchenden Zeichnung besser zuordnen zu können. Nach einer Eingrenzung der Forschungsthematik werden zur Orientierung methodologische Überlegungen angestellt, um dann auf die von mir gewählte qualitativ-empirische Forschungsmethode über die Einzelfallanalyse in Verknüpfung mit der teilnehmenden Beobachtung einzugehen.
Im zweiten Teil der Arbeit wird das Forschungsdesign beschrieben und konkretisiert. Der Fokus liegt auf der Aufbereitung und Auswertung des Beobachtungsprotokolls, das mit Hilfe von zwei Videoaufnahmen erstellt wird. Die Deutung der entstandenen Arbeiten bezieht sich auf die Merkmale der Schemaphase. Um diese kriterienorientiert beantworten zu können, ist sowohl ein theoriegeleitetes Herausarbeiten fundierter, wissenschaftlicher Erkenntnisse notwendig, als auch eine Betrachtung empirischer Forschungsergebnisse. Dabei geht es um eine Prozess-Analyse, die den individuellen, kindlichen Zeichenprozess ersichtlich machen soll. Abschließend werden in der Schlussbetrachtung die Ergebnisse der Einzelfallstudie formuliert. Im Fazit wird eine forschungsmethodologische Reflexion sowie ein Nachdenken über die eigene Rolle als Forscherin folgen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Struktur der wissenschaftlichen Hausarbeit
- Theoretischer Teil
- 2. Aktueller Forschungsstand der Kinderzeichnungsforschung mit Blick auf die Schemaphase der späten Kindheit
- 2.1 Forschungsaspekte
- 2.1.1 Gesamteindruck
- 2.1.2 Motive, Symbole, Zeichen
- 2.1.3 Graphomotorik
- 2.1.4 Formdarstellung
- 2.1.5 Größendarstellung
- 2.1.6 Farbdarstellung
- 2.1.7 Bewegungsdarstellung
- 2.1.8 Raum- und Zeitdarstellung, Komposition
- 2.1 Forschungsaspekte
- 2. Aktueller Forschungsstand der Kinderzeichnungsforschung mit Blick auf die Schemaphase der späten Kindheit
- Empirischer Teil
- 3. Methodologische Überlegungen
- 3.1 Qualitativ-empirische Forschung
- 3.2 Einzelfallanalyse
- 3.3 Datenerhebung
- 3.3.1 Teilnehmende Beobachtung
- 3.3.2 Videoaufzeichnung
- 3.3.3 Fotografie
- 4. Methodische Konkretisierung der empirischen Untersuchung
- 4.1 Situative Bedingungen
- 4.2 Untersuchungsaufbau
- 4.3 Datenerhebung
- 5. Datenaufbereitung und Auswertung
- 5.1 Beobachtungsbogen für den Gesamtverlauf
- 5.2 Analyse der Prozess-Aspekte
- 3. Methodologische Überlegungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit untersucht mittels einer Einzelfallstudie die Prozessanalyse von Kinderzeichnungen in der Grundschule. Ziel ist es, den Zeichenprozess eines Grundschulkindes detailliert zu analysieren und mit den Merkmalen der Schemaphase der späten Kindheit abzugleichen. Der Fokus liegt auf dem Ablauf des Zeichenprozesses selbst, weniger auf den Ergebnissen.
- Prozessanalyse von Kinderzeichnungen
- Vergleich mit der Schemaphase der späten Kindheit
- Methodologische Reflexion qualitativer Forschung
- Bedeutung der teilnehmenden Beobachtung und Videoaufzeichnung
- Kunstdidaktische Implikationen für den Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit basiert auf dem Forschungsinteresse der Autorin, welches durch ein Praktikum im Kressbronner KunstCampus und ein Kunstseminar geweckt wurde. Die zentrale Forschungsfrage lautet: „Wie kann im Rahmen einer Einzelfallstudie eine Kinderzeichnung eines Grundschulkindes mittels Prozessanalysen untersucht werden?“ Die Studie konzentriert sich auf die Prozessanalyse einer Kinderzeichnung, ohne explizit nach Ergebnissen zu suchen.
1. Struktur der wissenschaftlichen Hausarbeit: Die Hausarbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Der theoretische Teil behandelt die Grundlagen der Kinderzeichnungsforschung, insbesondere die Schemaphase. Der empirische Teil beschreibt die methodische Vorgehensweise, die Datenerhebung und -auswertung der Einzelfallstudie.
2. Aktueller Forschungsstand der Kinderzeichnungsforschung mit Blick auf die Schemaphase der späten Kindheit: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über verschiedene Modelle der Kinderzeichnungsentwicklung, wobei der Fokus auf der Schemaphase der späten Kindheit liegt. Es werden verschiedene Merkmale dieser Phase, wie die zunehmende Orientierung an der Realität, Detailgenauigkeit und die Entwicklung von Raum- und Zeitdarstellung, erläutert und mit den Arbeiten von Kerschensteiner, Lowenfeld, Piaget, John-Winde und Richter verglichen. Die spezifischen Merkmale der Zeichnungen in der späten Schemaphase, einschließlich der Aspekte der Form-, Größen-, Farb- und Bewegungsdarstellung, werden detailliert beschrieben.
2.1 Forschungsaspekte: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die einzelnen Aspekte der Prozessanalyse, die im empirischen Teil der Arbeit untersucht werden. Es werden der Gesamteindruck, die Motive, Symbole und Zeichen, die Graphomotorik, die Form-, Größen- und Farbdarstellung, sowie die Bewegungs-, Raum- und Zeitdarstellung und die Komposition behandelt. Jedes Element wird im Kontext der späten Schemaphase der Kinderzeichnung erläutert und definiert.
3. Methodologische Überlegungen: Dieses Kapitel beschreibt die methodischen Grundlagen der Studie. Es wird die qualitative Forschung im Allgemeinen und die Einzelfallanalyse im Besonderen erläutert, und die Wahl dieser Methode für die vorliegende Untersuchung begründet. Die Autorin erläutert die Vor- und Nachteile der qualitativen Forschung im Vergleich zur quantitativen Forschung und begründet die Entscheidung für eine qualitative, empirische Methode, die auf Einzelbeobachtungen und -analysen basiert.
3.1 Qualitativ-empirische Forschung, 3.2 Einzelfallanalyse, 3.3 Datenerhebung: Dieses Kapitel beschreibt die Datenerhebungsmethoden: teilnehmende Beobachtung, Videoaufzeichnung und Fotografie. Die Autorin erläutert die Vor- und Nachteile jeder Methode und begründet ihre Wahl. Der Fokus liegt auf den Vorteilen der Videoaufzeichnung für die detaillierte Erfassung komplexer Prozesse. Besonders werden die möglichen Störungen durch die Aufzeichnungsgeräte und deren Minimierung besprochen.
4. Methodische Konkretisierung der empirischen Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt den konkreten Untersuchungsaufbau, die situativen Bedingungen und die Datenerhebung. Die Einwilligungserklärung der Eltern des Kindes wird ebenfalls präsentiert. Der Aufbau der Untersuchung beschreibt detailliert den Einsatz zweier Kameras mit unterschiedlichen Perspektiven, um einen möglichst umfassenden Blick auf den Zeichenprozess zu gewährleisten.
5. Datenaufbereitung und Auswertung: Dieses Kapitel beschreibt die Aufbereitung und Auswertung der Daten, die auf Basis zweier Videoaufnahmen und der teilnehmenden Beobachtung des Zeichenprozesses erfolgen. Ein detaillierter Beobachtungsbogen wird vorgestellt, der die Basisinformationen zum Kind, die Beobachtungssituation und die Analyse der Zeichnungen umfasst. Die Auswertung der Prozessaspekte wird anhand des Beobachtungsbogens und des Kriterienkatalogs erläutert.
Häufig gestellte Fragen zur wissenschaftlichen Hausarbeit: Prozessanalyse von Kinderzeichnungen
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht mittels einer Einzelfallstudie die Prozessanalyse von Kinderzeichnungen in der Grundschule. Der Fokus liegt auf dem detaillierten Ablauf des Zeichenprozesses eines Kindes und dem Abgleich mit Merkmalen der Schemaphase der späten Kindheit. Das Ergebnis der Zeichnung steht dabei weniger im Mittelpunkt als der Prozess seiner Entstehung.
Welche Forschungsfrage steht im Zentrum der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: „Wie kann im Rahmen einer Einzelfallstudie eine Kinderzeichnung eines Grundschulkindes mittels Prozessanalysen untersucht werden?“
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und was ist ihr Inhalt?
Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Der theoretische Teil beleuchtet den aktuellen Forschungsstand der Kinderzeichnungsforschung, insbesondere die Schemaphase der späten Kindheit, unter Berücksichtigung verschiedener Modelle und Forschungsaspekte (Gesamteindruck, Motive, Graphomotorik, Form-, Größen-, Farb- und Bewegungsdarstellung, Raum- und Zeitdarstellung). Der empirische Teil beschreibt die methodische Vorgehensweise (qualitative Forschung, Einzelfallanalyse), die Datenerhebung (teilnehmende Beobachtung, Videoaufzeichnung, Fotografie) und die Datenaufbereitung und -auswertung anhand eines Beobachtungsbogens.
Welche Methoden wurden in der Studie angewendet?
Die Studie verwendet eine qualitative, empirische Methode, basierend auf Einzelfallanalyse. Die Datenerhebung erfolgt mittels teilnehmender Beobachtung, Videoaufzeichnung und Fotografie. Die Wahl dieser Methoden wird im Detail begründet und die Vor- und Nachteile diskutiert.
Welche Aspekte der Kinderzeichnung werden im Detail analysiert?
Die Analyse umfasst den Gesamteindruck der Zeichnung, die verwendeten Motive und Symbole, die Graphomotorik, die Form-, Größen-, Farb- und Bewegungsdarstellung sowie die Raum- und Zeitdarstellung und Komposition. Diese Aspekte werden im Kontext der Schemaphase der späten Kindheit interpretiert.
Wie wurde die Datenaufbereitung und -auswertung durchgeführt?
Die Datenaufbereitung und -auswertung basieren auf zwei Videoaufnahmen und der teilnehmenden Beobachtung. Ein detaillierter Beobachtungsbogen unterstützt die systematische Erfassung und Analyse der Daten. Die Auswertung der Prozessaspekte erfolgt anhand dieses Bogens und eines Kriterienkatalogs.
Welche Autoren und Modelle der Kinderzeichnungsforschung werden berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht sich auf relevante Autoren und Modelle der Kinderzeichnungsentwicklung, darunter Kerschensteiner, Lowenfeld, Piaget, John-Winde und Richter. Der Fokus liegt auf der Schemaphase der späten Kindheit und deren charakteristischen Merkmalen.
Welche kunstdidaktischen Implikationen ergeben sich aus der Studie?
Die Studie liefert Erkenntnisse, die für den Kunstunterricht relevant sind und Implikationen für die Beobachtung und Analyse von Kinderzeichnungen im pädagogischen Kontext bietet. Die methodischen Überlegungen können für die Praxis adaptiert werden.
Wo liegt der Fokus der Studie: auf dem Ergebnis der Zeichnung oder dem Zeichenprozess?
Der Fokus der Studie liegt auf dem Ablauf des Zeichenprozesses selbst, weniger auf den Ergebnissen der Zeichnung. Die Prozessanalyse steht im Vordergrund.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2018, Prozess-Analysen von Kinderzeichnungen in der Grundschule. Eine Einzelfallstudie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/458931