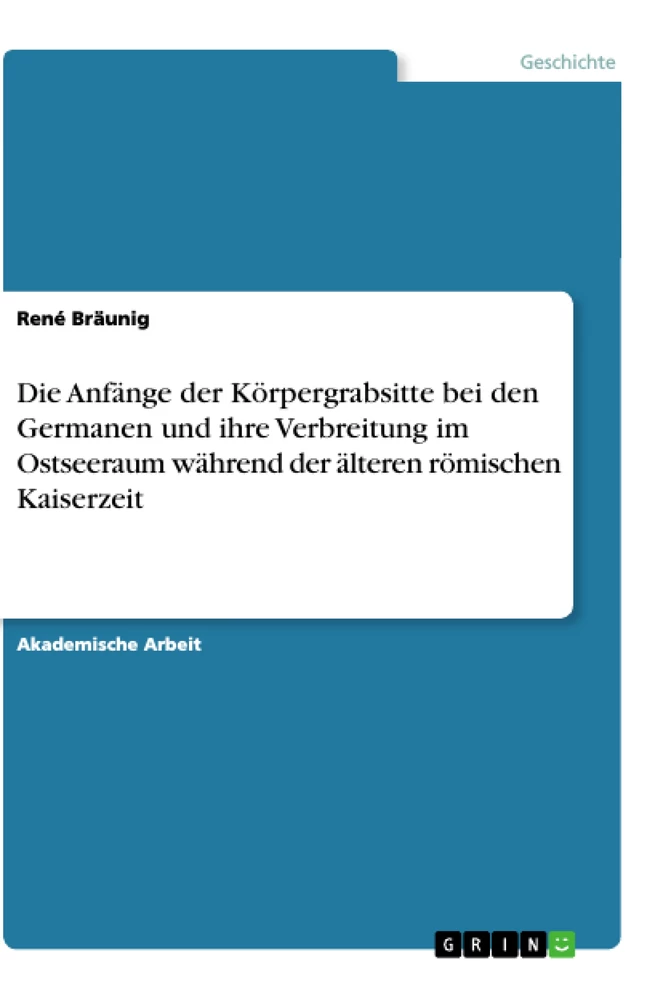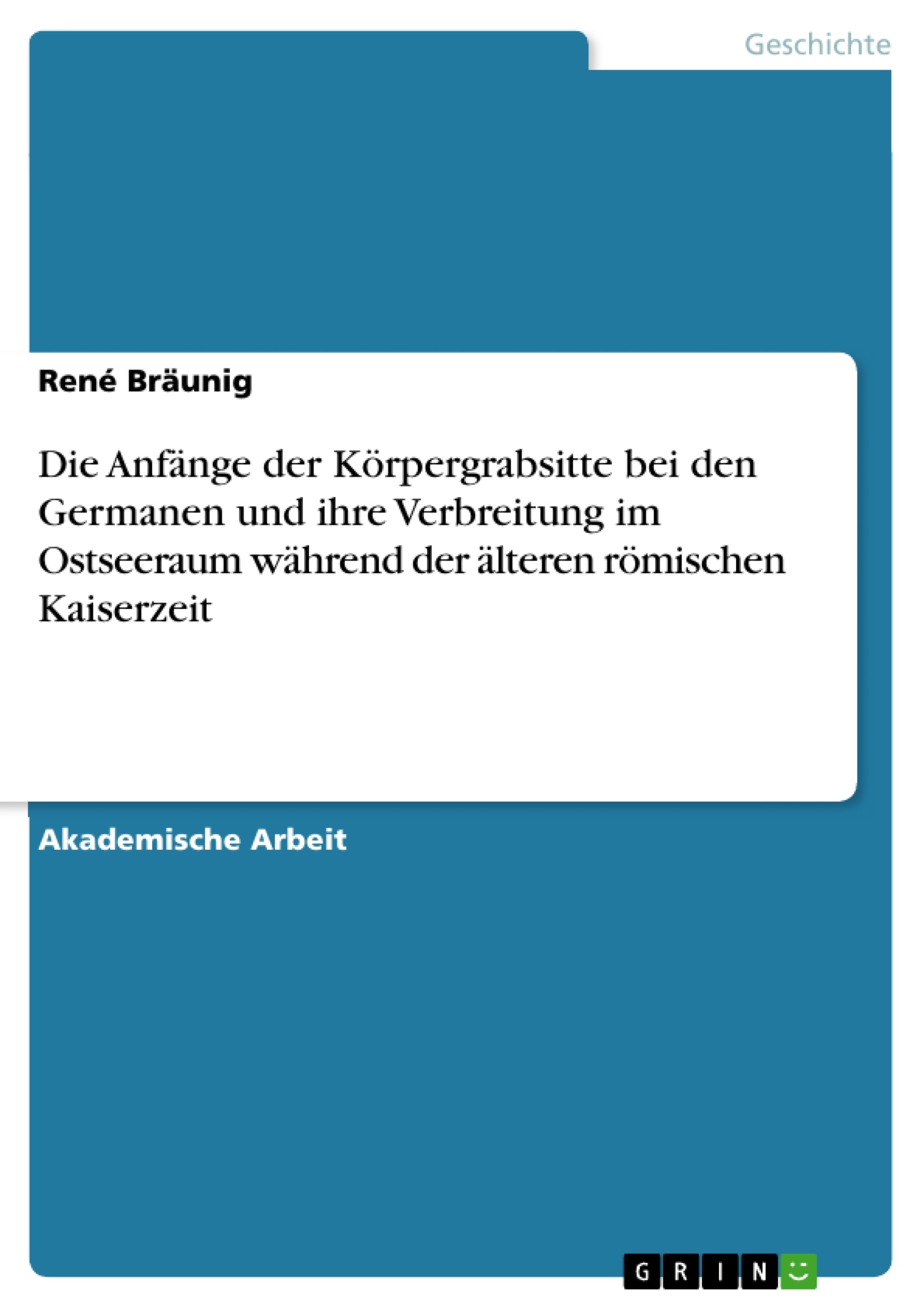Der Text analysiert die Anfängen der Körperbestattungssitte bei den Germanen und mögliche Einflüsse aus benachbarten Kulturen.
Der Zeitraum der Untersuchung des Aufkommens der Körpergrabsitte und ihrer Verbreitung beginnt in der Zeitstufe A nach Eggers und endet mit der Stufe Eggers B2 mit wenigen Ausnahmen, die in den Grenzbereich des Übergangs zwischen Eggers B2 und C1 gehören. Um der Frage der Entstehung der Körpergrabsitte nachzugehen, sind Untersuchungen zur vorrömischen Eisenzeit in den, später durch römische Schriftquellen, als sicher germanisch besiedelt anzusehenden Gebiete notwendig.
Der Zeitabschnitt der frühen Kaiserzeit bringt einige Besonderheiten im Grabritus hervor, die vorher im germanischen Raum mehr oder weniger unbekannt waren.
Dazu gehören getrennte Männer- und Frauenfriedhöfe, die Waffenbeigabe und das zahlreicher werdende Phänomen der Körpergräber. Dahinter wurde oft eine stärkere soziale Differenzierung der germanischen Gesellschaft gesehen. Hachmann vermutete hinter den verschieden ausgestatteten Waffengräbern verschiedene Kriegerränge mit politisch und sozial differenziertem Einfluß. Dagegen wäre die vorrömische Eisenzeit homogener strukturiert gewesen, weil eine Führungsschicht archäologisch nicht nachweisbar ist.
Neuere Untersuchungen zu Gräberfeldern der vorrömischen Eisenzeit im skandinavischen Raum zeigen hier ein viel differenzierteres Bild.
In den reich ausgestatteten frühkaiserzeitlichen Körpergräbern vom Lübsowtyp sah man die archäologische Hinterlassenschaft einer überregionalen Führungsschicht. Neuere Untersuchungen haben gezeigt, daß alle diese Erscheinungen im Grabritus stärker zu differenzieren sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Forschungsstand
- Die Körpergräber der Spätlatenezeit
- Die keltischen Körpergräber der Spätlatenezeit
- Die Körpergräber der vorrömischen Eisenzeit in Skandinavien
- Körpergräber der vorrömischen Eisenzeit im Havelgebiet
- Die Körpergräber der vorrömischen Eisenzeit im Elb-Saale-Gebiet
- Die "rätische" Körpergrabgruppe
- Der Raum Mitteleuropa, Südpolen
- Böhmen
- Mitteldeutschland
- Süd- und Mittelpolen
- Mittelschlesien
- Niederschlesien
- Kujawien und das Palukigebiet
- Großpolen
- Die Fürstengräber vom Lübsowtyp
- Das Rheinland
- Skandinavien, Nordostdeutschland, Nordwestpolen und Großpolen
- Nordostdeutschland und Nordwestpolen
- Pommersche Küstengruppe
- Rügensche Küstengruppe
- Südpommersche Gruppe
- Brandenburg und der mittlere Oderraum
- Brandenburg
- Der mittlere Oderraum
- Mecklenburg
- Hinterpommern
- Pommerellen und Westpreußen
- Dänemark
- Nordjütland (Himmerland, Vendsyssell, Thy)
- Mittel- und Ostjütland
- Westjütland
- Südjütland und Nordschleswig
- Fünen und Langeland
- Seeland, Lolland und Falster
- Bornholm
- Schweden
- Gotland und Öland
- Das schwedische Festland
- Västergötland
- Östergotland
- Norwegen
- Finnland und Ostpreußen
- Finnland
- Ostpreußen
- Das Baltikum
- Vergleich der verschiedenen Entwicklungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Anfänge der Körpergrabsitte bei den Germanen und deren Verbreitung im Ostseeraum während der älteren römischen Kaiserzeit. Sie beleuchtet die Entwicklung dieser Bestattungsform im Kontext der vorrömischen Eisenzeit und der Spätlatenezeit, untersucht regionale Unterschiede und sucht nach möglichen Einflüssen und Ursachen für den Wandel der Bestattungspraktiken.
- Entstehung und Verbreitung der Körpergrabsitte im germanischen Raum
- Regionale Variationen der Körpergräber und deren Ausstattung
- Mögliche Einflüsse keltischer Bestattungstraditionen
- Soziokulturelle Interpretationen der Körpergräberfunde
- Vergleichende Analyse der Entwicklung in verschiedenen Regionen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung und Forschungsstand: Diese Einleitung beschreibt den Untersuchungszeitraum (Eggers A bis B2/C1) und die Notwendigkeit der Untersuchung der vorrömischen Eisenzeit in den germanisch besiedelten Gebieten, um die Entstehung der Körpergrabsitte zu erforschen. Sie hebt die Besonderheiten des frühen Kaiserzeitlichen Grabritus hervor, darunter getrennte Friedhöfe und die zunehmende Zahl von Körpergräbern, die oft mit sozialer Differenzierung in Verbindung gebracht werden. Die Einleitung diskutiert frühere Theorien (Hachmann) über soziale Strukturen und weist auf neuere, differenziertere Ansätze hin (Gebühr, Kunow, Kunst, Steuer), die regionale Unterschiede in der Waffenbeigabe und Grabausstattung betonen und die These eines alleinigen keltischen Einflusses auf die Verbreitung der Körperbestattung in Frage stellen.
Die Körpergräber der Spätlatenezeit: Dieses Kapitel analysiert das spärliche Auftreten von Körpergräbern in der letzten Phase der Latenezeit im keltischen Kulturraum, im Gegensatz zur Überzahl an Brandbestattungen. Es werden Beispiele aus Mitteldeutschland, Schlesien und Böhmen genannt, darunter das Frauengrab von Mellingen mit seinen Fibeln, die Verbindungen zum Alpen- und Mittelrheingebiet aufweisen. Die Grabbeigaben verorten das Grab in einem lokalen Kontext. Ähnliche Funde in Weimar-Tiefurt und Gotha-Siebleben werden ebenfalls erwähnt.
Der Raum Mitteleuropa, Südpolen: Dieser Abschnitt behandelt die Verbreitung von Körpergräbern in verschiedenen Regionen Mitteleuropas und Südpolens, von Böhmen bis nach Großpolen. Es wird eine detaillierte geographische und archäologische Analyse dieser Funde erwartet, wobei die regionalen Unterschiede in der Ausprägung der Körpergrabsitte im Mittelpunkt stehen. Die Kapitel betonen wahrscheinlich die Vielfalt der Funde und die Herausforderungen bei der Interpretation der kulturellen und sozialen Zusammenhänge.
Die Fürstengräber vom Lübsowtyp: Dieses Kapitel konzentriert sich auf eine spezifische Art von Körpergräbern, die als "Fürstengräber vom Lübsowtyp" bezeichnet werden. Es dürfte eine detaillierte Beschreibung der Merkmale dieser Gräber, ihrer Ausstattung und ihrer geographischen Verteilung umfassen. Die Bedeutung dieser Gräber für das Verständnis der sozialen Hierarchien und der politischen Organisation der germanischen Gesellschaft in der frühen Kaiserzeit wird analysiert. Die Diskussion der Interpretation dieser Gräber als Indikatoren für eine überregionale Führungsschicht wird kritisch beleuchtet und mit aktuellen Forschungsergebnissen verglichen.
Das Rheinland: Hier wird die Verbreitung und Beschaffenheit der Körpergräber im Rheinland während der untersuchten Periode behandelt. Der Fokus liegt wahrscheinlich auf den Besonderheiten dieser Region im Vergleich zu anderen Gebieten. Die Rolle des Rheinlandes im größeren Kontext der Verbreitung der Körpergrabsitte und dessen mögliche Verbindungen zu anderen Regionen wird diskutiert.
Skandinavien, Nordostdeutschland, Nordwestpolen und Großpolen: Dieser umfangreiche Abschnitt befasst sich mit der Verbreitung von Körpergräbern in einem weitläufigen Gebiet, von Skandinavien bis nach Großpolen. Eine detaillierte regionale Analyse verschiedener Gruppen (Pommersche Küstengruppe, Rügensche Küstengruppe usw.) wird erwartet. Hier werden regionale Variationen in der Ausprägung der Körpergrabsitte, ihre zeitliche Entwicklung und ihre möglichen Verbindungen untereinander untersucht.
Vergleich der verschiedenen Entwicklungen: Dieser Abschnitt dient zur Synthese der Ergebnisse und zieht Vergleiche zwischen den verschiedenen regionalen Entwicklungen der Körpergrabsitte. Es wird eine Zusammenfassung der wichtigsten Beobachtungen und Schlussfolgerungen aus den vorherigen Kapiteln erwartet, mit einem Schwerpunkt auf Gemeinsamkeiten und Unterschieden im Hinblick auf die Verbreitung, die zeitliche Entwicklung und die soziokulturellen Implikationen der Körpergräber.
Schlüsselwörter
Körpergrabsitte, Germanen, ältere römische Kaiserzeit, Spätlatenezeit, vorrömische Eisenzeit, Bestattungsrituale, regionale Variationen, soziale Differenzierung, keltische Einflüsse, Waffengräber, Lübsowtyp, Ostseeraum, Mitteleuropa, Skandinavien.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Untersuchung der Körpergrabsitte bei den Germanen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Anfänge und Verbreitung der Körpergrabsitte bei den Germanen im Ostseeraum während der älteren römischen Kaiserzeit (Eggers A bis B2/C1). Sie beleuchtet die Entwicklung dieser Bestattungsform im Kontext der vorrömischen Eisenzeit und der Spätlatenezeit, analysiert regionale Unterschiede und sucht nach Einflüssen und Ursachen für den Wandel der Bestattungspraktiken.
Welche geographischen Regionen werden untersucht?
Die Studie umfasst ein weitläufiges Gebiet, darunter Mitteleuropa (Böhmen, Mitteldeutschland, Süd- und Mittelpolen, Schlesien, Kujawien, Großpolen), das Rheinland, Skandinavien (Dänemark, Schweden, Norwegen), Nordostdeutschland, Nordwestpolen, das Baltikum, Finnland und Ostpreußen. Die Analyse konzentriert sich auf regionale Variationen der Körpergrabsitte.
Welche Zeiträume werden betrachtet?
Der Fokus liegt auf der älteren römischen Kaiserzeit, aber die Arbeit berücksichtigt auch die vorrömische Eisenzeit und die Spätlatenezeit, um die Entwicklung der Körpergrabsitte zu verstehen.
Welche Arten von Gräbern werden untersucht?
Die Arbeit analysiert vor allem Körpergräber, im Gegensatz zu Brandgräbern. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den "Fürstengräbern vom Lübsowtyp", die als Indikatoren für soziale Hierarchien interpretiert werden.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehung und Verbreitung der Körpergrabsitte im germanischen Raum, regionale Variationen der Körpergräber und ihrer Ausstattung, mögliche Einflüsse keltischer Bestattungstraditionen, soziokulturelle Interpretationen der Funde und eine vergleichende Analyse der Entwicklung in verschiedenen Regionen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit synthetisiert die Ergebnisse der regionalen Analysen und zieht Vergleiche zwischen den verschiedenen Entwicklungen der Körpergrabsitte. Sie fasst die wichtigsten Beobachtungen und Schlussfolgerungen zusammen, mit einem Schwerpunkt auf Gemeinsamkeiten und Unterschieden bezüglich Verbreitung, zeitlicher Entwicklung und soziokulturellen Implikationen.
Wie werden keltische Einflüsse berücksichtigt?
Die Arbeit untersucht mögliche Einflüsse keltischer Bestattungstraditionen auf die Verbreitung der Körpergrabsitte bei den Germanen. Sie hinterfragt dabei die These eines alleinigen keltischen Einflusses und berücksichtigt regionale Unterschiede.
Welche Rolle spielen die "Fürstengräber vom Lübsowtyp"?
Die "Fürstengräber vom Lübsowtyp" bilden einen wichtigen Schwerpunkt der Arbeit. Ihre Merkmale, Ausstattung und geographische Verteilung werden detailliert beschrieben und ihre Bedeutung für das Verständnis sozialer Hierarchien und politischer Organisation analysiert.
Welche Bedeutung haben regionale Unterschiede?
Regionale Unterschiede in der Ausprägung der Körpergrabsitte, ihrer zeitlichen Entwicklung und ihren möglichen Verbindungen untereinander spielen eine zentrale Rolle in der Analyse. Die Arbeit betont die Vielfalt der Funde und die Herausforderungen bei der Interpretation der kulturellen und sozialen Zusammenhänge.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Körpergrabsitte, Germanen, ältere römische Kaiserzeit, Spätlatenezeit, vorrömische Eisenzeit, Bestattungsrituale, regionale Variationen, soziale Differenzierung, keltische Einflüsse, Waffengräber, Lübsowtyp, Ostseeraum, Mitteleuropa, Skandinavien.
- Quote paper
- René Bräunig (Author), 2004, Die Anfänge der Körpergrabsitte bei den Germanen und ihre Verbreitung im Ostseeraum während der älteren römischen Kaiserzeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/459099