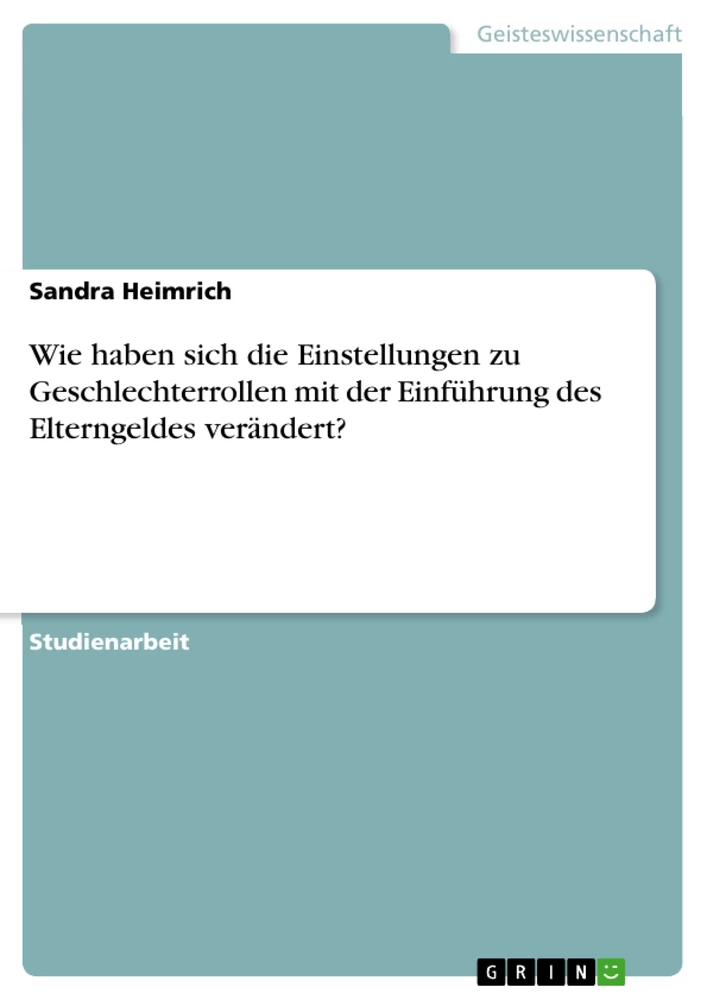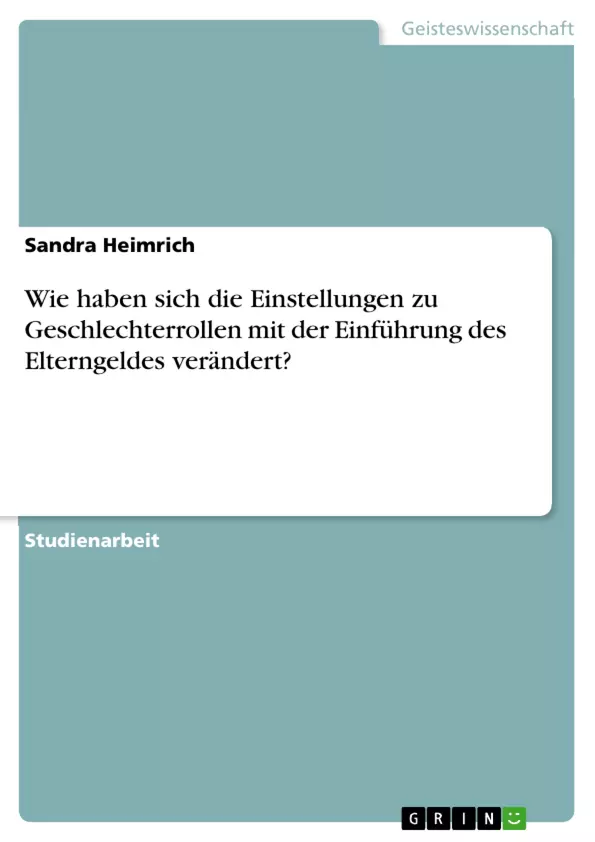Männer bringen das Geld nach Hause, Frauen kümmern sich um Haushalt und Kinder - diese traditionellen Geschlechterrollen haben bis heute in Deutschland einen Einfluss auf die Verteilung der Erwerbs- und Hausarbeit in einer Partnerschaft. Mit der Einführung des Elterngelds im Jahr 2007, das mittlerweile in Basiselterngeld umbenannt wurde, ist jedoch der Anteil an Männern, die die gesetzlich verankerte Elternzeit in Anspruch nehmen, deutlich angestiegen, da sich hier erstmals Mütter und Väter den Erziehungsurlaub untereinander aufteilen können. Die vorliegende Arbeit fokussiert auf den potentiellen Wandel der Einstellungen deutscher Eltern, der mit der Einführung dieser familienpolitischen Maßnahme einhergeht.
Konkret wird dabei die Frage aufgeworfen, inwieweit sich die Geschlechterrolleneinstellungen deutscher Eltern hinsichtlich der Aufteilung der Hausarbeit, der Erwerbstätigkeit von Müttern und der Vorherrschaft des klassischen Versorgermodells vor und nach der Einführung des Elterngeld Plus unterscheiden.
Dazu wird zunächst die deutsche Familienpolitik vorgestellt und in diesem Rahmen der Paradigmenwechsel durch die Einführung des Elterngeld Plus erläutert. Schließlich werden Theorien vorgestellt, die Einstellungsveränderungen im Lebensverlauf erklären können, und die entsprechenden Hypothesen abgeleitet. Im Anschluss werden der Forschungsstand sowie das in dieser Studie verwendete Analyseverfahren detailliert vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis.
- 1 Geschlechterrollen in Deutschland..
- 2 Institutioneller Kontext.
- 2.1 Traditionelle Verteilung der Erwerbs- und Hausarbeit in Deutschland ..
- 2.2 Familienpolitische Maßnahmen in Deutschland
- 2.2.1 Basiselterngeld
- 2.2.2 Elterngeld Plus .......
- 3 Theoretischer Bezugsrahmen: Einstellungsänderungen im Lebensverlauf.
- 3.1 Theorie der kognitiven Dissonanz……………………………..\n
- 3.2 Identitätstheorien.......
- 3.3 Elaboration-Likelihood-Modell
- 3.4 Forschungsleitende Hypothesen..\n
- 4 Forschungsstand: Geschlechterrolleneinstellungen, Elternschaft und Familienpolitik ........
- 4.1 Der Übergang in die Elternschaft........
- 4.2 Familienpolitik und Geschlechterrolleneinstellungen………………………..\n
- 4.3 Familienpolitische Regulierung der Elternzeit......
- 5 Qualitative Erforschung der Geschlechterrolleneinstellungen vor und nach Einführung des\nElterngeld Plus
- 5.1 Theoretical Sampling und Leitfadeninterview .....
- 5.2 Methodenkritik am qualitativen Forschungsdesign
- 6 Fazit: Weitere Anknüpfungspunkte für qualitative Forschung.....
- 7 Anhang.....
- 8 Literaturverzeichnis..............
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den potenziellen Wandel von Geschlechterrolleneinstellungen deutscher Eltern im Kontext der Einführung des Elterngeld Plus. Im Fokus steht die Frage, inwieweit sich die Einstellungen zu der Verteilung von Hausarbeit und Erwerbstätigkeit von Müttern sowie die Präferenz für das klassische Versorgermodell vor und nach der Einführung des Elterngeld Plus unterscheiden.
- Einfluss des Elterngeld Plus auf Geschlechterrolleneinstellungen
- Verteilung von Hausarbeit und Erwerbstätigkeit in Elternpaaren
- Traditionelle Geschlechterrollen im Kontext der Familienpolitik
- Theorien zur Einstellungsänderung im Lebensverlauf
- Qualitative Forschung zur Erfassung von Geschlechterrolleneinstellungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema Geschlechterrollen in Deutschland und beleuchtet die traditionelle Verteilung von Erwerbs- und Hausarbeit. Anschließend wird der institutionelle Kontext der Familienpolitik in Deutschland erläutert, wobei insbesondere das Basiselterngeld und das Elterngeld Plus im Fokus stehen. In Kapitel 3 werden theoretische Ansätze zur Erklärung von Einstellungsänderungen im Lebensverlauf vorgestellt. Kapitel 4 analysiert den aktuellen Forschungsstand zu Geschlechterrolleneinstellungen, Elternschaft und Familienpolitik. Im Mittelpunkt von Kapitel 5 steht die qualitative Forschungsmethode, die in der vorliegenden Arbeit eingesetzt wird. Abschließend werden die wichtigsten Erkenntnisse der Untersuchung zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Geschlechterrolleneinstellungen, Familienpolitik, Elterngeld Plus, Hausarbeit, Erwerbstätigkeit, Einstellungsänderung, qualitative Forschung, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat das Elterngeld die Geschlechterrollen in Deutschland beeinflusst?
Seit der Einführung des Elterngelds 2007 ist der Anteil der Väter in Elternzeit deutlich gestiegen. Die Arbeit untersucht, ob dies auch zu einem Wandel der Einstellungen bezüglich Hausarbeit und Erwerbstätigkeit von Müttern geführt hat.
Was ist der Unterschied zwischen Basiselterngeld und Elterngeld Plus?
Das Elterngeld Plus wurde eingeführt, um die Vereinbarkeit von Familie und Teilzeitarbeit zu fördern. Es ermöglicht eine längere Bezugsdauer des Elterngelds, wenn die Eltern währenddessen in Teilzeit arbeiten.
Welche Theorien erklären Einstellungsänderungen bei Eltern?
Die Arbeit nutzt unter anderem die Theorie der kognitiven Dissonanz, Identitätstheorien und das Elaboration-Likelihood-Modell, um zu erklären, wie sich Geschlechterrolleneinstellungen im Lebensverlauf verändern können.
Was ist das klassische Versorgermodell?
Das traditionelle Modell sieht vor, dass der Mann das Geld verdient (Haupternährer), während die Frau für Haushalt und Kinder zuständig ist. Die Arbeit prüft, inwieweit dieses Modell durch familienpolitische Maßnahmen an Bedeutung verliert.
Wie wurden die Einstellungen der Eltern erforscht?
Es wurde ein qualitatives Forschungsdesign mit Leitfadeninterviews und Theoretical Sampling verwendet, um die tiefgreifenden Einstellungen der Eltern vor und nach der Einführung des Elterngeld Plus zu erfassen.
- Quote paper
- Sandra Heimrich (Author), 2017, Wie haben sich die Einstellungen zu Geschlechterrollen mit der Einführung des Elterngeldes verändert?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/459836