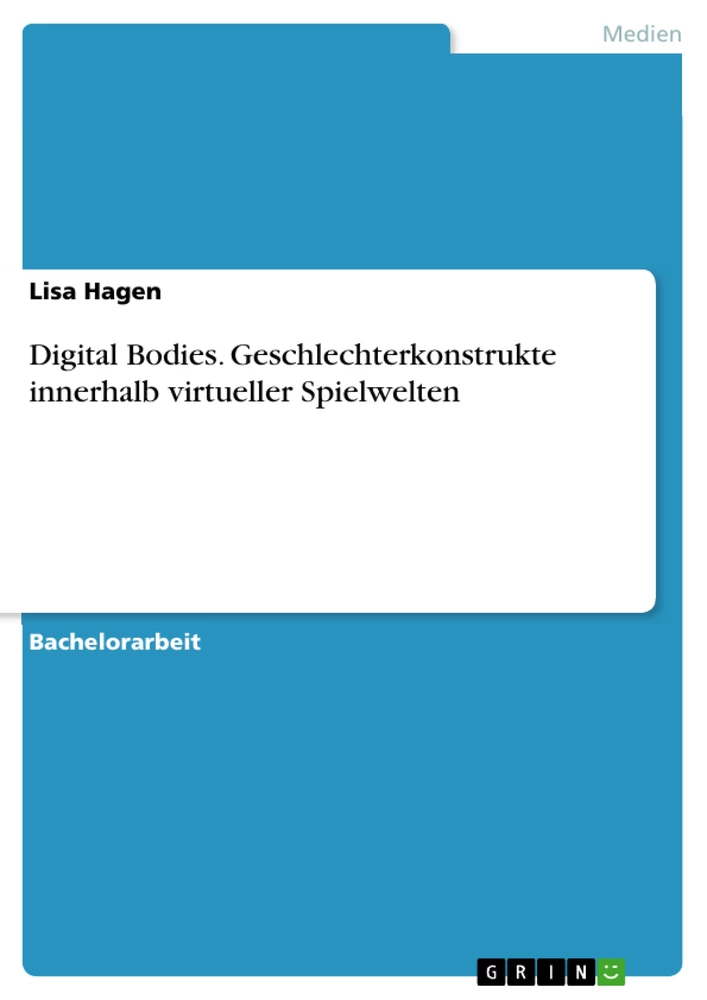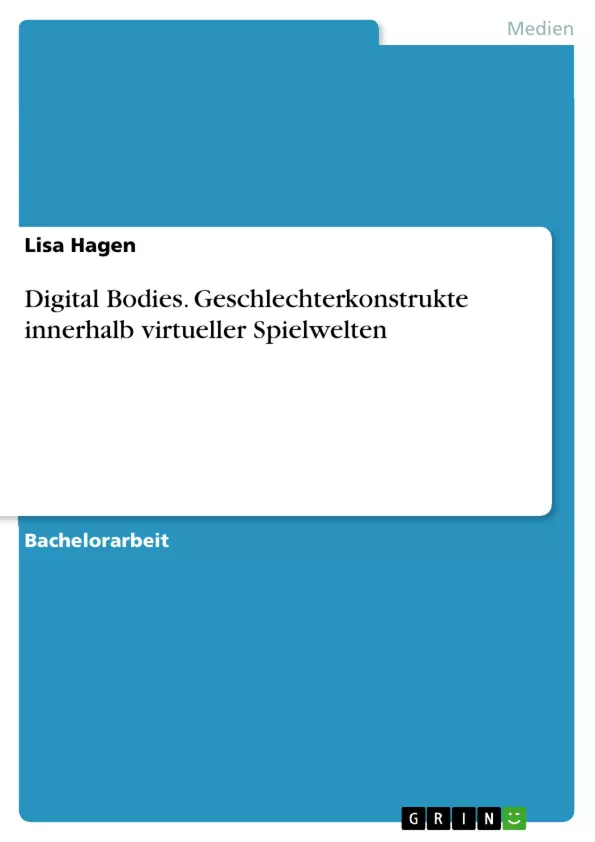Seit der Erscheinung der Magnavox Odyssey Konsole im Jahre 1972 sind einige Jahre vergangen und die graphischen Möglichkeiten haben sich seitdem vervielfacht. War zu dieser Zeit noch der Titel „Pong“ (Atari, 1972) ein Kassenschlager, bedarf es heute sehr viel mehr graphischer Raffinessen, um ein erfolgsversprechendes Computerspiel zu kreieren. Seit der Anmeldung des Patents im Jahre 1968 für die Brown Box von Ralph Baer, der ersten Videospielkonsole weltweit, wächst der Videospiele-Markt stetig und lässt von Jahr zu Jahr größere Gewinne verzeichnen. Allein der Vergleich der Jahresumsätze von 2015 und 2016 zeigt, ein Wachstum der deutschen Spielebranche um 7 Prozent, auf 2,13 Milliarden Euro. Der Anteil aus dem Verkauf digitaler Spiele für Computer, Konsolen und Mobilgeräte beträgt dabei 1,18 Milliarden Euro. Dazu kommen die Gebühren für Online-Netzwerke. Auch virtuelle Güter und Zusatzinhalte sorgen für einen stabilen Markt.
Diese Zahlen lassen schon erahnen, welches Potential sich hinter dem Medium Computerspiel verbirgt. Da die Nutzung digitaler Spiele stetig beliebter wird und den Alltag der Nutzer in immer weiteren Bereichen durchdringt, drängt sich die Frage auf, welche Darstellungen, speziell in Bezug auf die Kategorie Geschlecht, besonders häufig sind, und welche Auswirkungen diese Verbreitung von Rollenbildern mit sich bringt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Ökonomische Relevanz des Computerspielmarktes
- 2. Grundlegende Definitionen
- 2.1. Begriffsdefinition Videospiel
- 2.2. Begriffsdefinition Geschlecht und Stereotyp
- 3. Charakteristika des Bildschirmspiel-Konsumenten
- 4. Körperästhetik im digitalen Spiel
- 4.1. Konstruktion virtueller Schönheit
- 4.2. Avatar - der digitale Stellvertreter
- 5. Geschlechterbilder innerhalb digitaler Spiele
- 5.1. Analysebeispiele weiblicher Charaktere
- 5.2. Analysebeispiele männlicher Charaktere
- 5.3. Vergleich ästhetischer Darstellungsformen der Geschlechter
- 6. Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und digitalem Spiel
- 7. Auswirkungen zeitgenössischer Videospiele
- 8. Zunehmende Gleichberechtigung in der Games-Welt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Geschlechterrollen, die in der digitalen Spielewelt abgebildet werden. Ziel ist es, die Darstellung von Geschlechterrollen in digitalen Spielen zu analysieren und deren Auswirkungen auf das Selbstbild und das Verhalten der Spielenden zu beleuchten.
- Ökonomische Relevanz des Computerspielmarktes
- Definitionen von Videospielen und Geschlechterstereotypen
- Charakteristika des Bildschirmspiel-Konsumenten
- Körperästhetik in digitalen Spielen
- Geschlechterbilder in digitalen Spielen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Ökonomische Relevanz des Computerspielmarktes
Das Kapitel beleuchtet die wirtschaftliche Bedeutung des Computerspielmarktes, indem es auf die Entwicklung der Branche und deren stetiges Wachstum seit den 1970er Jahren hinweist. Es werden Statistiken zu den Jahresumsätzen der deutschen Spieleindustrie sowie die Bedeutung digitaler Spiele und Online-Netzwerke hervorgehoben.
2. Grundlegende Definitionen
2.1. Begriffsdefinition Videospiel
Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von Videospielen und deren Abgrenzung vom Spiel im Allgemeinen. Es werden Eigenschaften wie räumliche und zeitliche Begrenzung, Regelgebundenheit, Spielzweck und die Bedeutung der Interaktivität beleuchtet.
2.2. Begriffsdefinition Geschlecht und Stereotyp
Die Definitionen von Geschlecht und Stereotyp werden in diesem Kapitel eingeführt. Es werden die grundlegenden Konzepte, die für die Analyse der Geschlechterdarstellungen in Videospielen relevant sind, vorgestellt.
3. Charakteristika des Bildschirmspiel-Konsumenten
Dieses Kapitel befasst sich mit den Eigenschaften und Merkmalen der Spieler von digitalen Spielen. Es werden Einblicke in die Motivationsstrukturen und Verhaltensweisen der Spielenden gegeben.
4. Körperästhetik im digitalen Spiel
4.1. Konstruktion virtueller Schönheit
Dieses Kapitel analysiert die Darstellung von Schönheit in digitalen Spielen und beleuchtet die Konstruktionen virtueller Körperbilder, die in dieser Spielwelt präsentiert werden.
4.2. Avatar - der digitale Stellvertreter
Das Kapitel befasst sich mit dem Avatar als digitale Repräsentation des Spielenden und untersucht, wie die Auswahl und Gestaltung von Avataren die Geschlechteridentität und das Selbstbild des Spielers beeinflussen können.
5. Geschlechterbilder innerhalb digitaler Spiele
5.1. Analysebeispiele weiblicher Charaktere
Das Kapitel analysiert exemplarisch die Darstellung weiblicher Charaktere in Videospielen, um die gängigen Geschlechterstereotype und -bilder zu identifizieren.
5.2. Analysebeispiele männlicher Charaktere
Dieses Kapitel analysiert die Darstellung männlicher Charaktere in Videospielen und untersucht, welche Geschlechterstereotype und -bilder diese repräsentieren.
5.3. Vergleich ästhetischer Darstellungsformen der Geschlechter
Das Kapitel vergleicht die ästhetischen Darstellungsformen von weiblichen und männlichen Charakteren in Videospielen und beleuchtet die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Gestaltung und Darstellung.
6. Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und digitalem Spiel
Dieses Kapitel befasst sich mit der Wechselwirkung zwischen der Gesellschaft und der Welt der digitalen Spiele. Es untersucht, wie digitale Spiele von sozialen Normen und Erwartungen beeinflusst werden und umgekehrt Einfluss auf die Gesellschaft nehmen können.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Darstellung von Geschlechterrollen in digitalen Spielen, die Interaktion zwischen virtuellen Welten und der realen Gesellschaft sowie die Auswirkungen von Computerspielen auf das Selbstbild und Verhalten der Spielenden. Wichtige Schlüsselwörter sind: Videospiel, Bildschirmspiel, Gender, Stereotyp, Körperbild, Avatar, Interaktivität, Online-Spiel, Offline-Spiel.
Häufig gestellte Fragen
Wie werden Geschlechterrollen in Videospielen dargestellt?
Oftmals finden sich stereotype Darstellungen: männliche Charaktere werden als stark und dominant, weibliche Charaktere häufig sexualisiert oder in passiven Rollen dargestellt.
Was ist ein Avatar?
Ein Avatar ist die digitale Repräsentation des Spielers innerhalb der virtuellen Welt, die als Stellvertreter für Handlungen und Interaktionen dient.
Welchen Einfluss hat die Körperästhetik in Spielen?
Virtuelle Schönheitsideale können das Selbstbild der Spieler beeinflussen und gesellschaftliche Normen über „ideale“ Körper verstärken.
Gibt es einen Trend zu mehr Gleichberechtigung in Games?
Ja, die Arbeit beleuchtet, dass zunehmend vielfältigere und weniger stereotype Charaktere Einzug in moderne Videospiele halten.
Warum ist der Videospiele-Markt so relevant für die Forschung?
Aufgrund der enormen ökonomischen Bedeutung und der Tatsache, dass digitale Spiele den Alltag vieler Menschen durchdringen, haben die dort vermittelten Rollenbilder eine große soziale Reichweite.
- Quote paper
- Lisa Hagen (Author), 2017, Digital Bodies. Geschlechterkonstrukte innerhalb virtueller Spielwelten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/461348