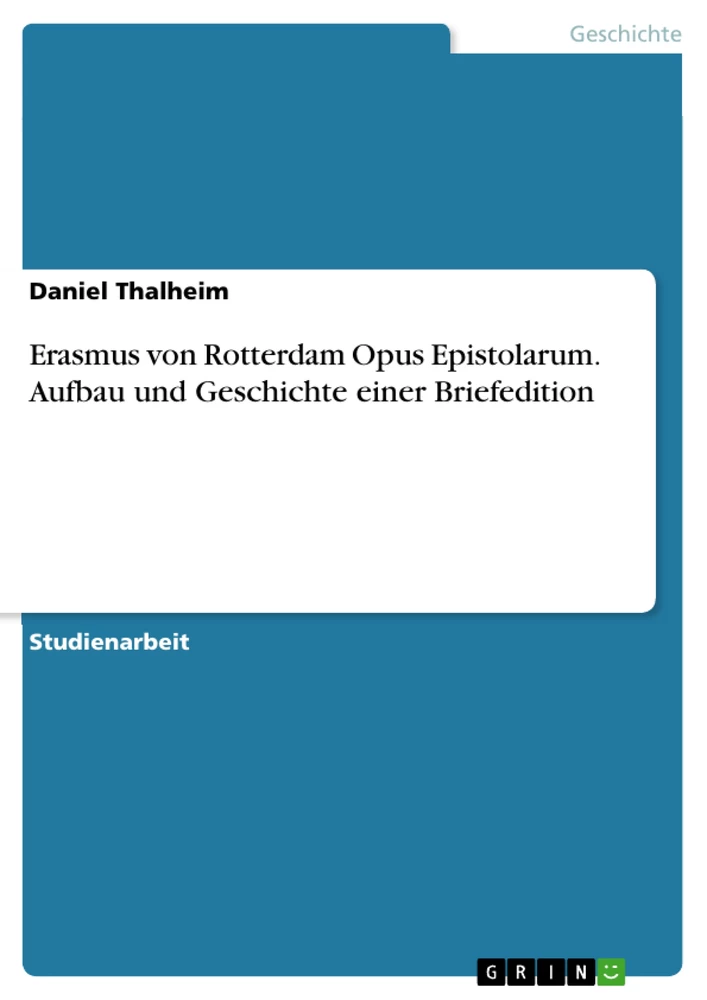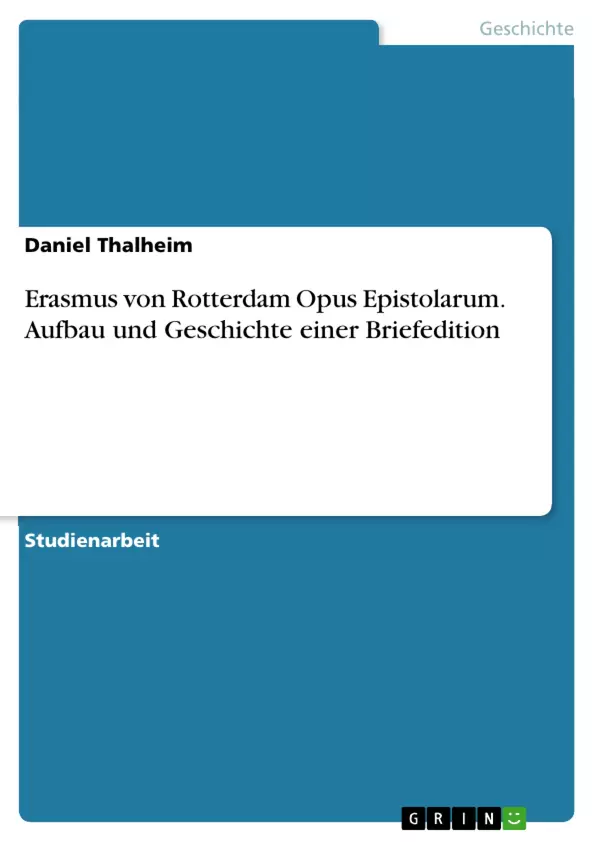Zu Lebzeiten des Humanisten Erasmus von Rotterdam herrschte eine rege Rezeption seiner Briefe unter vielen Verlegern und Humanisten, die auch nach seinem Tode nicht abriss. Die heutigen kritischen Briefeditionen übernahmen die chronologische Art der Zusammenstellung der Briefe in Büchern, doch Erasmus-Forscher Percy Stafford Allen ordnete diese neu an, nummerierte sie neu durch und war der erste, der sich kritisch mit Erasmus' Werk auseinandersetzte. Peter G. Bietenholz und seine Mitherausgeber fügten in den englischen Übersetzungen neue Fehlerkorrekturen hinzu, die nicht übersichtlich sind. Eine thematische Ordnung der Briefe begründete schon Erasmus als für ihn unmöglich, da der Reiz für ihn darin bestehe, verschiedene Themen in einem bestimmten Zeitraum dem Leser zugänglich zu machen. Seine Nacheditoren behielten dieses Ordnungssystem bei, das aber nach unkorrekt verteilten Daten neu arrangiert werden musste, da ein Wechsel seiner Freundeskreise bestand und eben so eine neue Datierung einiger Briefe daraus erschlossen werden kann.
Die Rekonstruktion von Erasmus’ Briefschreiben sowie seiner Arbeitsweise anhand der von dem Herausgeber des "Opus Omnia", Jean Leclerc, entdeckten Manuskripte in Deventer wurde bereits nachvollziehbar und übersichtlich dargestellt. Erasmus’ Leben konnte von nun an klarer dargestellt werden, auch wenn die schiere Unzahl von über 2000 Briefen noch einige Schwierigkeiten bereit hält, Erasmus Leben genauestens zu erforschen.
Ohne die zeitgenössische Erasmusrezeption würde das Briefwerk ungemein dürftiger erscheinen als es jetzt der Fall ist. Dies kann man Erasmus selbst verdanken, der aus Urheberrechten heraus immer wieder Gegenveröffentlichungen startete und anregte. Selbst über seinen Tod hinaus beschäftigten sich unzählige Gelehrte mit seinem Werk und Leben. Zumal er noch vor seinem Tod eine autorisierte Vita anregte, die erstmals in der Leidener Ausgabe von 1706 erschien, jedoch seit Erasmus’ Tod entwickelt wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Leben und Werk von Erasmus
- Das Opus Epistolarum - Die Forschung
- Die Entstehungsgeschichte
- Vom Urheberrecht - Erasmus und nicht autorisierte Veröffentlichungen
- Das Deventer Briefbuch
- Zusammenfassung und Fazit
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit konzentriert sich auf die Erforschung des Opus Epistolarum von Erasmus von Rotterdam, insbesondere dessen Aufbau und Entstehung. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der „Briefrekrutierung“, d.h. der Verwendung von bereits veröffentlichten Briefen und Skizzenbüchern in der Edition.
- Aufbau und Geschichte der Briefeditionen von Erasmus
- Erasmus' Verhältnis zu nicht autorisierten Veröffentlichungen
- Das Deventer Briefbuch und seine Bedeutung für die Edition
- Die Herausforderungen der Briefdatierung und -verortung
- Der Einfluss von Erasmus' Korrespondenz auf die Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt den Leser in das Leben und Werk von Erasmus ein und beleuchtet seine Bedeutung als Humanist und Theologe. Sie stellt die zentrale Frage nach Aufbau und Geschichte der Briefeditionen von Erasmus und die Rolle des Deventer Briefbuchs.
- Leben und Werk von Erasmus: Dieses Kapitel beleuchtet die wichtigsten Stationen in Erasmus' Leben, seine Ausbildung, seinen Werdegang und seine zentralen Werke. Dabei wird auch auf seine Italienreise, seine Zeit in England und seine Beziehung zu wichtigen Persönlichkeiten wie Heinrich VIII. und Karl V. eingegangen.
- Das Opus Epistolarum - Die Forschung: Dieser Abschnitt beschreibt die Forschungsgeschichte der Briefe von Erasmus und stellt die bedeutende Edition von Percy Stafford Allen vor. Die Publikation zeichnet sich durch ihre umfassende Sammlung von Briefen, Neuentdeckungen und frühere Veröffentlichungen aus.
- Die Entstehungsgeschichte: Dieses Kapitel untersucht die Entstehung der Briefeditionen von Erasmus. Dabei wird insbesondere auf die „Briefrekrutierung“, d.h. die Verwendung bereits veröffentlichter Briefe und Skizzenbücher, eingegangen. Die Analyse deckt die komplexen Prozesse und Herausforderungen der Erstellung der Edition auf.
- Vom Urheberrecht - Erasmus und nicht autorisierte Veröffentlichungen: Das Kapitel beschäftigt sich mit Erasmus' Verhältnis zu nicht autorisierten Veröffentlichungen seiner Briefe. Es untersucht, wie er sich in Briefen zu diesem Thema äußerte und welche Strategien er zur Kontrolle seiner Werke entwickelte.
- Das Deventer Briefbuch: Dieser Abschnitt befasst sich mit dem Deventer Briefbuch, einer Sammlung von Skizzen und Notizen, die Erasmus in seiner frühen Zeit in Deventer anlegte. Es untersucht die Bedeutung des Briefbuchs für die Entstehung der Edition und die Herausforderungen, die sich aus der Verwendung dieser Quelle ergeben.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: Erasmus von Rotterdam, Opus Epistolarum, Briefeditionen, Briefrekrutierung, Deventer Briefbuch, Urheberrecht, nicht autorisierte Veröffentlichungen, Humanismus, Theologie, Forschung, Quellen, Briefdatierung, Briefverortung, Korrespondenz.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "Opus Epistolarum" von Erasmus von Rotterdam?
Es ist die umfassende Sammlung der Briefkorrespondenz des Humanisten Erasmus, die eine zentrale Quelle für die Erforschung seines Lebens und seiner Zeit darstellt.
Warum ist die Datierung der Briefe von Erasmus so schwierig?
Erasmus datierte viele Briefe ungenau oder gar nicht; Forscher müssen Daten oft mühsam durch den Abgleich von Freundeskreisen und historischen Ereignissen rekonstruieren.
Was ist das "Deventer Briefbuch"?
Es ist ein Skizzenbuch mit frühen Entwürfen und Notizen von Erasmus, das wichtige Einblicke in seine Arbeitsweise und die Entstehung seiner Briefeditionen bietet.
Wie stand Erasmus zum Urheberrecht seiner Briefe?
Erasmus kämpfte gegen nicht autorisierte Veröffentlichungen durch Raubdrucker und startete oft eigene Gegenveröffentlichungen, um die Kontrolle über sein Werk zu behalten.
Wer war Percy Stafford Allen?
Allen war ein bedeutender Erasmus-Forscher, der die erste wirklich kritische und neu geordnete Gesamtausgabe der Briefe von Erasmus herausgab.
Warum ordnete Erasmus seine Briefe nicht thematisch?
Erasmus hielt eine thematische Ordnung für unmöglich, da er den Reiz darin sah, dem Leser verschiedene Themen innerhalb eines bestimmten Zeitraums zugänglich zu machen.
- Quote paper
- Magister Daniel Thalheim (Author), 2005, Erasmus von Rotterdam Opus Epistolarum. Aufbau und Geschichte einer Briefedition, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/461394