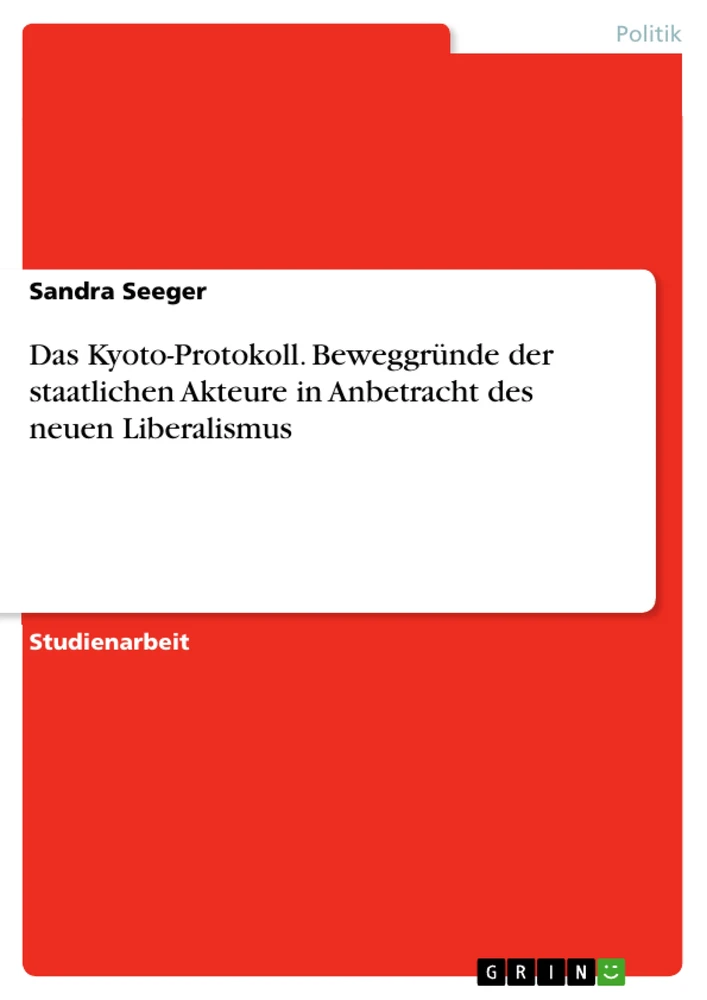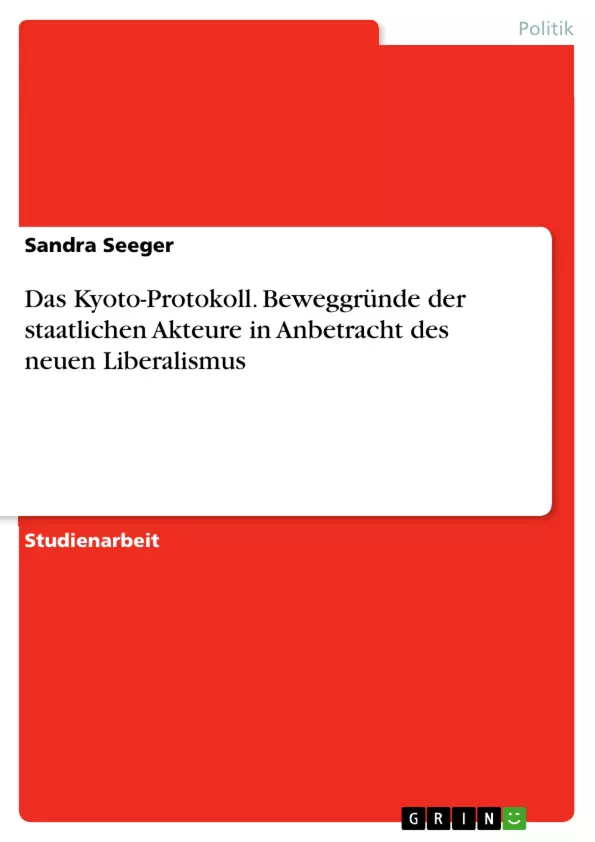Seit im Jahre 1972 die Konferenz der vereinten Nationen in Stockholm stattfand und später die Diskussion über das zu schließende Ozonloch aufbrach, ist die globale Umweltpolitik in der öffentlichen Wahrnehmung fest verankert. Das Bewusstsein dafür, dass Umweltschäden ein vielschichtiges globales Problem sind, das gemeinsame Lösungen erfordert, wurde im Laufe der Zeit immer mehr geschärft. Staatsgrenzen schützen nicht vor Umweltproblemen, mögen die internationalen Akteure noch so verschiedene Interessen und Weltbilder vertreten. Deswegen muss es Richtlinien und eine zielgerichtete Steuerung in der globalen Umweltpolitik geben. Vor allem in den 80er Jahren drängte sich das neue Thema Umweltschutz förmlich in den Vordergrund. Zum einen durch ein Vorankommen in der wissenschaftlichen Klimaforschung aber auch außergewöhnliche klimatische Vorkommnisse. So wurde auch die Gesellschaft in den westlichen Industriestaaten immer mehr für diese Thematik sensibilisiert. Das öffentliche Bewusstsein für den internationalen Klima- und Umweltschutz entwickelt sich meist durch Naturkatastrophen. So ist es nicht verwunderlich, dass z.B. die Katastrophe von Fukushima zur gesellschaftlichen Verteufelung der Atomkraft in den westlichen Teilen Europas führte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der (neue) Liberalismus nach Andrew Moravcsik
- (Umwelt-)Regime in den internationalen Beziehungen
- Das Kyoto-Protokoll und seine Entstehung
- Die beteiligten Akteure und ihre Beweggründe
- Die europäische Union
- Die JUSSCANNZ-Gruppe
- Die Entwicklungsländer
- Die CEIT-Länder
- Anwendung der Theorie des Liberalismus auf das Akteursverhalten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, das Akteursverhalten der am Entstehungsprozess des Kyoto-Protokolls beteiligten Staaten mit der Theorie des (neuen) Liberalismus von Moravcsik zu erklären.
- Der (neue) Liberalismus nach Andrew Moravcsik
- Die Entstehung und der Inhalt des Kyoto-Protokolls
- Die Beweggründe der beteiligten Akteure
- Die Anwendung der liberalen Theorie auf das Akteursverhalten
- Die Bedeutung von gesellschaftlichen Interessen und Präferenzen für die internationale Umweltpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit führt in das Thema der globalen Umweltpolitik ein und stellt das Kyoto-Protokoll als Schwerpunkt dar. Die Forschungsfrage lautet, ob sich das Akteursverhalten der am Entstehungsprozess des Protokolls beteiligten Staaten mit der Theorie des (neuen) Liberalismus erklären lässt.
- Der (neue) Liberalismus nach Andrew Moravcsik: Dieses Kapitel erläutert die Theorie des (neuen) Liberalismus nach Moravcsik. Es werden die zentralen Annahmen und die drei Varianten des Liberalismus (ideeller, kommerzieller und republikanischer Liberalismus) vorgestellt.
- (Umwelt-)Regime in den internationalen Beziehungen: Dieser Abschnitt soll dem besseren Verständnis für die Entstehung des Kyoto-Protokolls dienen.
- Das Kyoto-Protokoll und seine Entstehung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung und dem groben Inhalt des Kyoto-Protokolls.
- Die beteiligten Akteure und ihre Beweggründe: In diesem Kapitel werden die staatlichen Akteure näher beleuchtet, die maßgeblich an den Verhandlungen in Kyoto beteiligt waren. Hierzu gehören die Europäische Union, die JUSSCANNZ-Gruppe, die Entwicklungsländer und die CEIT-Länder.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem (neuen) Liberalismus, Umweltpolitik, internationalen Beziehungen, Regimetheorie, Kyoto-Protokoll, staatliche Akteure, gesellschaftliche Interessen, Präferenzen und Interdependenz.
Häufig gestellte Fragen zum Kyoto-Protokoll und Liberalismus
Was ist die Kernfrage dieser Arbeit zum Kyoto-Protokoll?
Es wird untersucht, ob sich das Verhalten der Staaten bei der Entstehung des Protokolls durch die Theorie des (neuen) Liberalismus von Andrew Moravcsik erklären lässt.
Welche Rolle spielt die Theorie von Moravcsik?
Sie betont, dass staatliches Handeln in der Außenpolitik primär durch innerstaatliche gesellschaftliche Interessen und Präferenzen bestimmt wird.
Welche Akteursgruppen werden analysiert?
Die Arbeit beleuchtet die Europäische Union, die JUSSCANNZ-Gruppe (u.a. USA, Japan, Kanada), die Entwicklungsländer und die CEIT-Länder (Transformationsstaaten).
Wie beeinflussen Naturkatastrophen die Umweltpolitik?
Naturkatastrophen sensibilisieren die Öffentlichkeit und erhöhen den Druck auf Regierungen, internationale Abkommen wie das Kyoto-Protokoll zu schließen.
Was sind die drei Varianten des Liberalismus nach Moravcsik?
Man unterscheidet den ideellen, den kommerziellen und den republikanischen Liberalismus.
- Quote paper
- Sandra Seeger (Author), 2017, Das Kyoto-Protokoll. Beweggründe der staatlichen Akteure in Anbetracht des neuen Liberalismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/461961