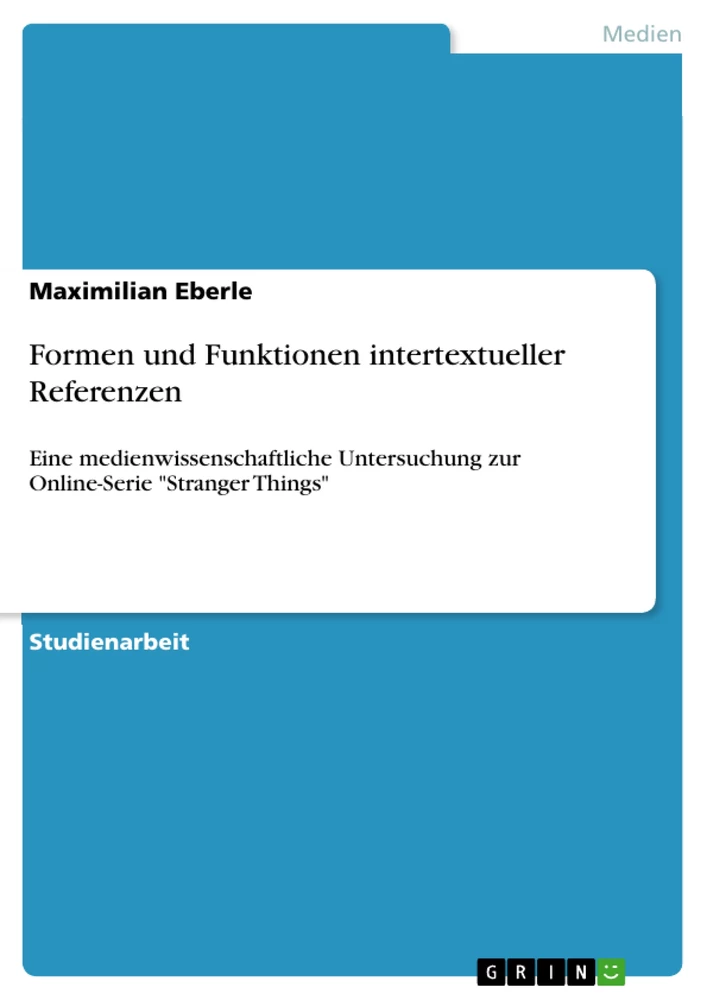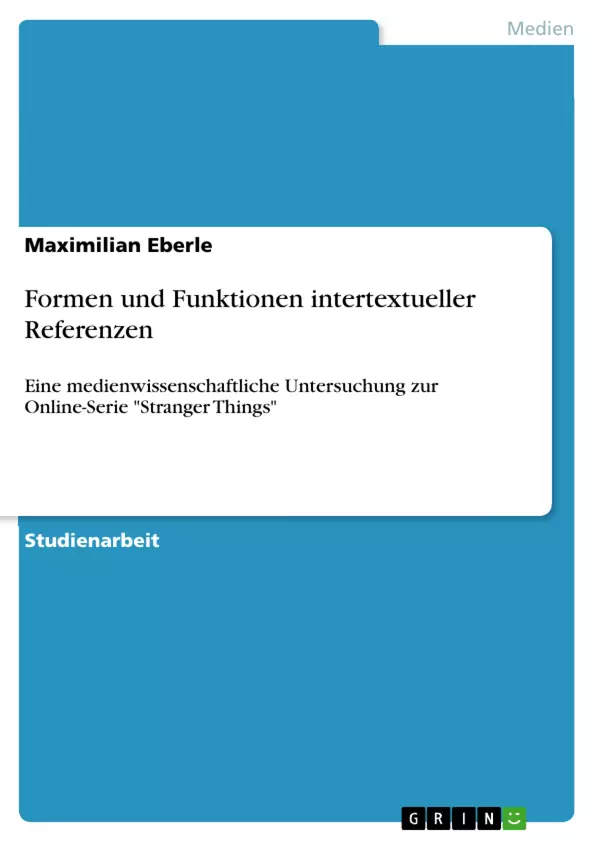Diese Arbeit untersucht Formen und Funktionen intertextueller Referenzen am Beispiel der Online-Serie "Stranger Things". Besonders bei der Auseinandersetzung mit (alten wie neuen) Medien wie Literatur, Kunst, Film und Fernsehen wird Serialität als kulturelles Phänomen behandelt. Innerhalb dieses Spektrums liegt vor allem die Theorie der Intertextualität, die besagt, dass sich ein Einzeltext durch seine Referenzen immer im Universum früherer Prätexte verorten lässt, im Fokus der Forschung. Während StrukturalistInnen und PoststrukturalistInnen besonders die Literatur auf dieses Phänomen hin untersuchten, hat Intertextualität vor allem in jüngster Vergangenheit auch Eingang in die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Massenmedien gefunden.
So behandelt auch diese Arbeit eine eher neue Erscheinung der Massenmedien, die Online-Serie. Am Beispiel des ausschließlich im "Web 2.0" publizierten Formats "Stranger Things", das 2016 erstmals erschien und vor kurzem um eine zweite Staffel erweitert wurde, soll gezeigt werden, welche Formen von Intertextualität in einem solchen Format aufgegriffen werden, um danach zu analysieren, welche Funktionen diesen zugrunde liegen. Zunächst soll dabei eine theoretische Grundlage geschaffen werden, indem ein klares Konzept von Text definiert wird und die bisherige Forschung zur Intertextualität im Bereich der Film- und Fernsehforschung dargelegt werden. Im Analyseteil wird anschließend die Online-Serie explizit auf intertextuelle Elemente untersucht, um anschließend Schlüsse über die Intention und Wirkungsabsichten von Intertextualität bei der Produktion einerseits, als auch über den jeweiligen Effekt bei der Rezeption der Serie andererseits zu ziehen.
Bereits im Terminus "Intertextualität" selbst wird ersichtlich, dass es sich um das Zusammenspiel und die Interferenzen mehrerer Texte handelt. Für das Verständnis von Intertextualität muss also zunächst ein grundsätzlicher Textbegriff erschlossen werden, der definiert, was einen Text eigentlich auszeichnet. Die Linguistik, insbesondere die Textlinguistik, ist sich seit jeher uneinig, nach welchen Kriterien ein Text zu definieren ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Zum Textbegriff
- Zum Begriff der Intertextualität
- Verhältnis zur Intermedialität
- Analyse: Formen intertextueller Bezüge in „Stranger Things“
- Eckdaten und Kurzsynopsis zur Serie
- Paratextuelle Elemente
- Visuelle Inszenierung von Handlungssequenzen und Motiven
- Stanley Kubricks „The Shining“: Das Axtmotiv
- David Lynchs „Twin Peaks“: Der Cliffhanger
- Steven Spielbergs: „E.T. – The Extra Terrestrial”: Enttäuschung der Erwartungshaltung
- Figurenzeichnung und Narrative
- Jim Hopper: Gerechtigkeitsfeldzug des einsamen Detektivs
- Eleven vs. Carrie vs. E.T. vs. Charlie
- ,,Dungeons and Dragons“ und der Demagorgon
- Funktionen und Wirkungsweisen intertextueller Bezüge in „Stranger Things“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die Online-Serie „Stranger Things“ im Hinblick auf intertextuelle Bezüge und deren Funktionen. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, welche Formen von Intertextualität in der Serie zum Einsatz kommen und wie diese die emotionale Wirkung und die Rezeption beeinflussen.
- Definition von Intertextualität und ihrer Anwendung in Film und Fernsehen
- Analyse der spezifischen Formen von Intertextualität in „Stranger Things“
- Die Funktion von Intertextualität zur Emotionalisierung durch Nostalgie
- Intertextualität als Element eines metafiktionalen Rätselspiels
- Der Einfluss von Intertextualität auf die „media convergence“
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Phänomen der Intertextualität und insbesondere deren Rolle in modernen Medien wie Online-Serien vor. Die Arbeit fokussiert auf die Serie „Stranger Things“ und ihre Verwendung intertextueller Elemente.
- Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Intertextualität und stellt verschiedene Ansätze zur Analyse von Texten, insbesondere im Kontext von Fernsehserien, vor. Die Problematik des Textbegriffs bei Serien und die Integration von visuellem und auditivem Material in der Analyse werden thematisiert.
- Analyse: Formen intertextueller Bezüge in „Stranger Things“: Dieses Kapitel analysiert die Serie „Stranger Things“ auf verschiedene Formen von Intertextualität. Es werden paratextuelle Elemente, visuelle Bezüge zu anderen Filmen sowie die Verwendung von Figuren und narrativen Elementen aus anderen Medien betrachtet.
- Funktionen und Wirkungsweisen intertextueller Bezüge in „Stranger Things“: Dieses Kapitel analysiert die Funktionen und Wirkungsweisen der in „Stranger Things“ festgestellten intertextuellen Bezüge. Es beleuchtet die Emotionalisierung durch Nostalgie, die Nutzung von Intertextualität als Element eines metafiktionalen Rätselspiels und den Einfluss auf die „media convergence“.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von Intertextualität in der Online-Serie „Stranger Things“. Schlüsselbegriffe sind hierbei die Intertextualität als Phänomen, die Formen von Intertextualität, die Funktionsweise von Intertextualität, die „media convergence“ sowie die Nostalgie. Die Arbeit verbindet Erkenntnisse aus der Medienwissenschaft, der Film- und Fernsehforschung, der Intertextualitätsforschung und der Kulturwissenschaft.
- Arbeit zitieren
- Maximilian Eberle (Autor:in), 2017, Formen und Funktionen intertextueller Referenzen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/462898