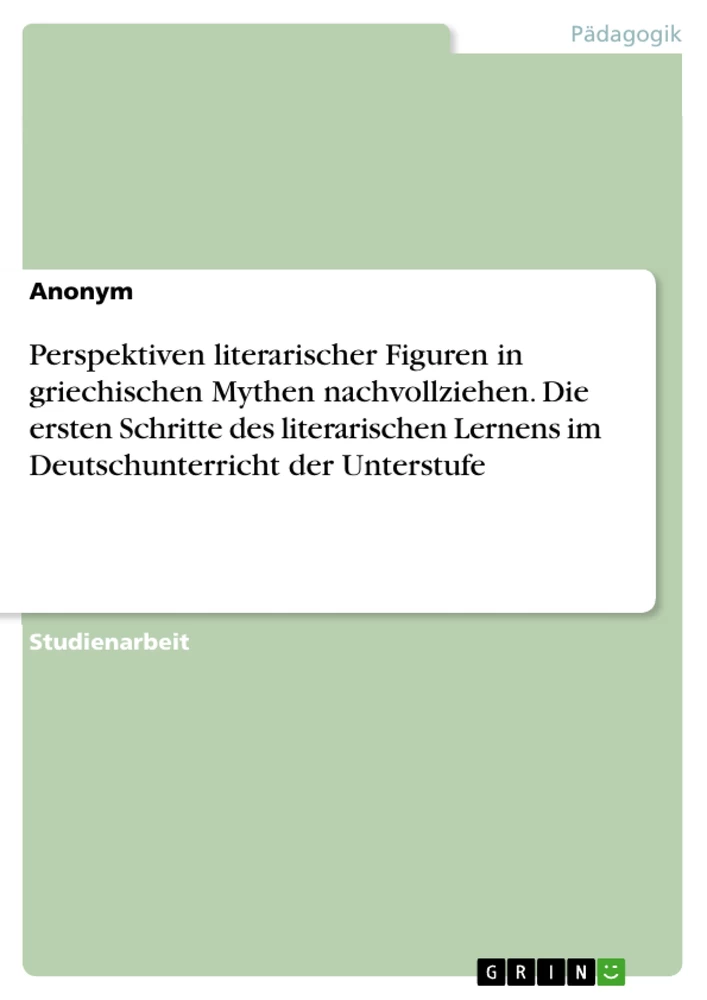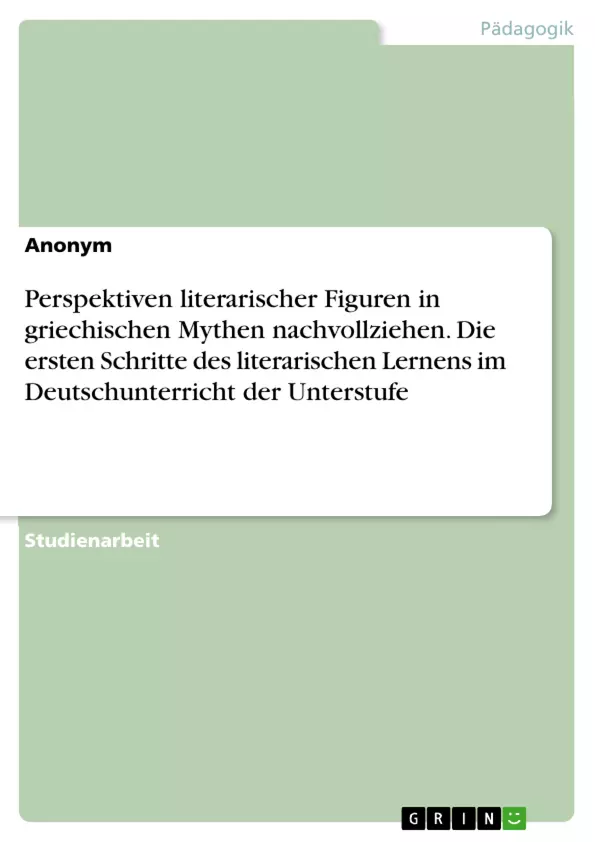Literaturunterricht- ein Teilgebiet des Deutschunterrichts, der allein Bestandteil der Oberschule zu sein scheint: Schülerinnen und Schüler lesen anspruchsvolle Dramen von weltbekannten Schriftstellern wie Goethe oder Schiller, sie lernen das Interpretieren und Analysieren von literarischen Werken nach bestimmten Mustern und müssen die Kompetenz für einen bewussten Umgang mit Literatur unter Beweis stellen. Vergleicht man so einen Literaturunterricht, mit dem ausgeführten Zitat von Kaspar H. Spinner, kommt man zum Entschluss, dass Theorie und Praxis wieder ihre Schwierigkeiten in der Übereinstimmung aufweisen. Wenn der Literaturunterricht zur Identitätsentwicklung, zur Perspektivübernahme, Empathie, zur Kreativität und kritischen Hinterfragung führen soll, darf dieser nicht erst mit dem Beginn der Sekundarstufe einsetzen. Bereits durch die vorschulische Lesesozialisation ist literarisches Lernen als ein wichtiger Bestandteil auch für die Grundschule - nämlich von Anfang an vorgesehen. Für den Literaturunterricht der Unterstufe gibt es aus Seiten der Deutsch- bzw. Literaturdidaktik bereits verschiedenste Ansätze und Methoden. Unteranderem auch von Kathrin Waldt, welche die Ansicht vertritt, dass Kinder gerade mit anspruchsvoller Literatur auf diesem Wege gefördert werden können. Im Bezug dazu tauchte nicht zuletzt mit Kaspar H. Spinner der Begriff des literarischen Lernens in den Vordergrund, der damit „Lernprozesse [verbindet], die zur Erschließung und zum Verstehen ästhetisch- fiktionaler Texte beitragen“. Zu denen gehören auch klassische Sagen bzw. Mythen, welche die Kinder oft durch amerikanische Verfilmungen kennen und diese aus diesem Grund Zugang in die Klassenräume finden sollten. Ansonsten besteht die Gefahr, dass mythologische Stoffe in den Köpfen der Heranwachsenden nicht in ihrem eigentlichen kulturellen Kontext haften bleiben . Im Rahmen dieser Arbeit wird deshalb untersucht, inwiefern die Auseinandersetzung mit Mythen das literarische Lernen bereits in der Unterstufe fördern kann?
„Literaturunterricht vermittelt ein Lernen, das über die Literatur hinausreicht. Er ist ein Beitrag zur Identitätsentwicklung der Heranwachsenden [...], zum Verstehen anderer Sichtweisen, zur Auseinandersetzung mit moralischen Fragen und zur Entfaltung von Ideenreichtum.“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlage
- Der Begriff des literarischen Lernens in der Literaturdidaktik
- Definition des Begriffs „literarisches Lernen“ nach Kaspar H. Spinner
- Elf Aspekte des literarischen Lernens
- Literarisches Lernen in der Unterstufe
- Potenzial von griechischen Mythen für den Literaturunterricht
- „Die Irrfahrten des Odysseus“: Kritische Hinterfragung des Materials unter dem Aspekt-,,Perspektiven literarischer Figuren nachvollziehen“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, inwiefern die Auseinandersetzung mit griechischen Mythen das literarische Lernen bereits in der Unterstufe fördern kann. Sie befasst sich mit dem Begriff des literarischen Lernens nach Kaspar H. Spinner und beleuchtet die Bedeutung von Mythen als Lernmaterialien im Deutschunterricht. Die Analyse konzentriert sich auf die „Irrfahrten des Odysseus“ und hinterfragt die Eignung dieses Stoffes unter dem Aspekt der Perspektivübernahme.
- Das literarische Lernen im Kontext der Grundschule
- Das Potenzial von griechischen Mythen im Deutschunterricht
- Die Bedeutung von Perspektivübernahme im literarischen Lernen
- Analyse des Stoffes "Die Irrfahrten des Odysseus" unter dem Aspekt "Perspektiven literarischer Figuren nachvollziehen"
- Die Förderung des literarischen Lernens durch Mythen in der Unterstufe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des literarischen Lernens in der Grundschule ein und stellt den Bezug zur Arbeit von Kaspar H. Spinner her. Das Kapitel „Theoretische Grundlage“ definiert den Begriff des literarischen Lernens und erläutert Spinners 11 Aspekte, die für die Analyse von Schulmaterialien relevant sind. Der Abschnitt „Literarisches Lernen in der Unterstufe“ befasst sich mit dem Potenzial von griechischen Mythen im Deutschunterricht und betrachtet kritisch das Material „Die Irrfahrten des Odysseus“ im Hinblick auf die Perspektivübernahme literarischer Figuren.
Schlüsselwörter
Literarisches Lernen, Mythen, Griechische Mythologie, Perspektivübernahme, "Die Irrfahrten des Odysseus", Deutschunterricht, Grundschule, Unterstufe, Kaspar H. Spinner.
Häufig gestellte Fragen
Ab wann sollte literarisches Lernen in der Schule beginnen?
Literarisches Lernen sollte nicht erst in der Oberschule, sondern bereits in der Grundschule (Unterstufe) beginnen, um die Identitätsentwicklung und Empathie frühzeitig zu fördern.
Warum eignen sich griechische Mythen für den Deutschunterricht?
Griechische Mythen bieten anspruchsvolle Stoffe, die Kindern oft aus Filmen bekannt sind. Sie ermöglichen die Auseinandersetzung mit moralischen Fragen und kulturellen Kontexten in einem fiktionalen Rahmen.
Was sind die 11 Aspekte des literarischen Lernens nach Kaspar H. Spinner?
Diese Aspekte umfassen Lernprozesse wie das Vorstellen von Welten, das Nachvollziehen von Perspektiven literarischer Figuren und den Umgang mit Symbolik, die zur Erschließung ästhetischer Texte beitragen.
Wie wird das Thema Perspektivübernahme am Beispiel von Odysseus gelehrt?
Am Beispiel der „Irrfahrten des Odysseus“ lernen Schüler, die Sichtweisen und Gefühle der Figuren nachzuvollziehen, was eine Kernkompetenz des literarischen Lernens darstellt.
Welche Gefahr besteht bei der rein medialen Rezeption von Mythen?
Ohne schulische Einbettung besteht die Gefahr, dass mythologische Stoffe (z. B. aus Hollywood-Filmen) ohne ihren eigentlichen kulturellen und literarischen Kontext verstanden werden.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2016, Perspektiven literarischer Figuren in griechischen Mythen nachvollziehen. Die ersten Schritte des literarischen Lernens im Deutschunterricht der Unterstufe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/463120