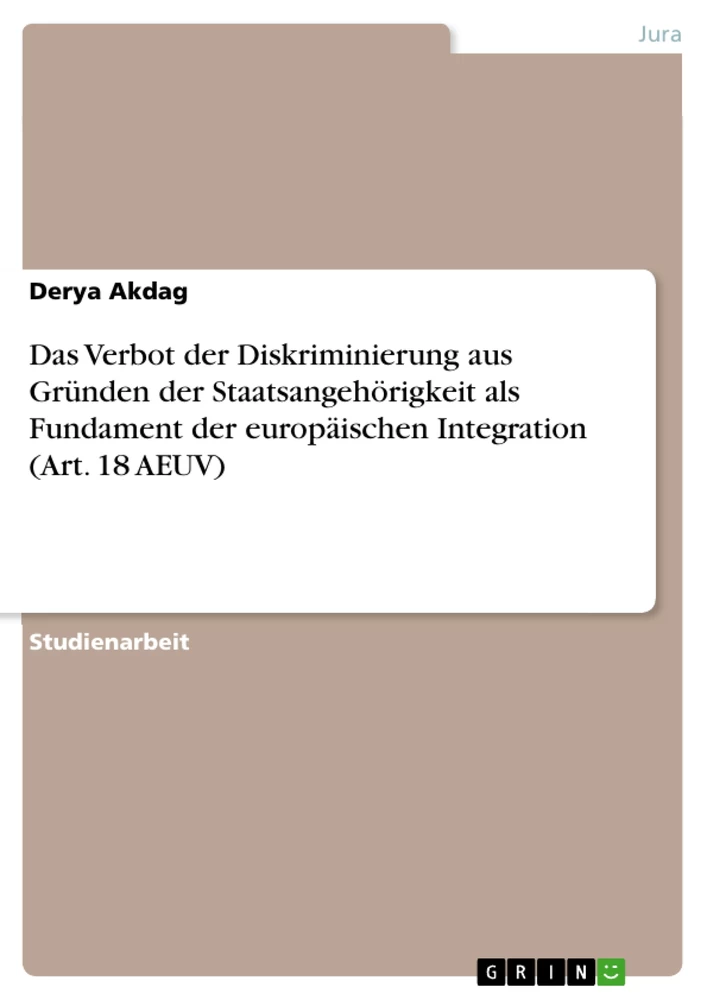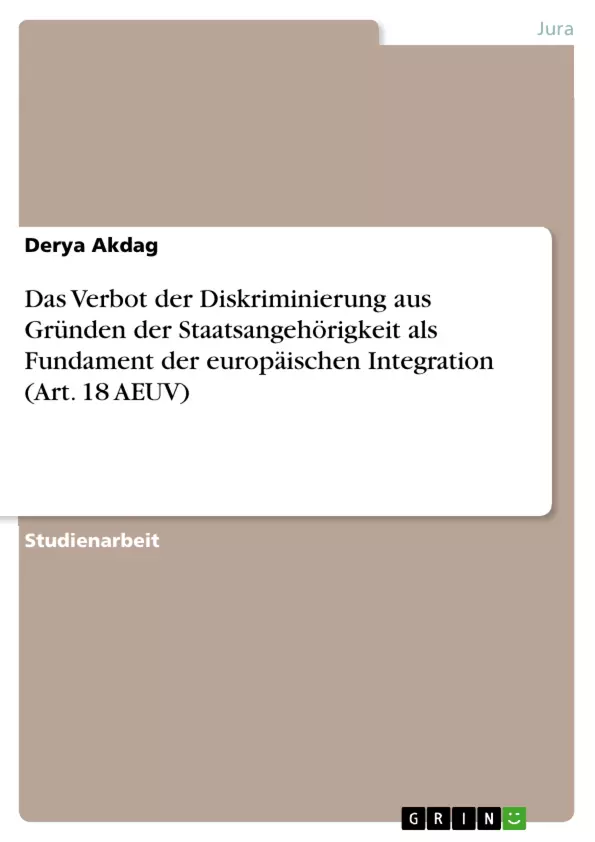Europa als Gedanke richtet sich gegen den gegenwärtigen Zustand der Mitgliedstaaten, da diese im Grunde genommen sehr protektionistisch und egoistisch angelegt sind. In den europäischen Gesetzesentwürfen wird daher die Entwicklungsoffenheit innerhalb der Europäischen Union hervorgehoben. Erst nach dem Ersten Weltkrieg ist die Idee einer europäischen Integration kontinuierlich weiterentwickelt worden. Dabei ist unter der europäischen Integration die Entwicklung der Europäischen Union seit ihrer Gründung zu verstehen, was auch als Integrationsprozess bezeichnet wird. Der Integrationsprozess beinhaltet sowohl die Aufnahme neuer Mitglieder bzw. die Erweiterung als auch Vertiefungen, d.h. die Intensivierung der Zusammenarbeit. Hierbei werden die Gleichrangigkeit der Mitgliedstaaten und die gleichberechtigte Teilhabe am acquis communautaire, folglich am gemeinschaftlichen Besitzstand, als Fundament des Integrationsprozesses verstanden. Darüber hinaus sind im Integrationsprozess die Supranationalität, welche die Richtung der Integration vorgibt, sowie die Homogenität, die den Grund einer einheitlichen Integrationsstruktur darstellt, zur Geltung gebracht worden. Der Motor der europäischen Integration ist der Europäische Gerichtshof, welcher einerseits durch die Auslegung der Verträge und andererseits mithilfe von Instrumentarien bei der Nichtbeachtung der Verträge erhebliche Wirkungen auf die nationalen Rechtsordnungen ausüben kann. Nach Rudolf Streinz wird die Europäische Union durch die kritische Begleitung des Europäischen Gerichtshofs - vor allem durch nationale Verfassungsgerichte - sowie mithilfe der Entwicklung der europäischen Integration nicht gefährdet, sondern durchaus gestärkt. Diese aufgezeigten Elemente der europäischen Integration sind von großer Bedeutung, denn die Europäische Union ist dabei, sich zu einer „Grundrechtsunion“ zu entwickeln.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung
- I. Entstehungsgeschichte des Art. 18 AEUV
- II. Langwieriges Schattendasein des allgemeinen Diskriminierungsverbots
- B. Allgemeines Diskriminierungsverbot des Art. 18 AEUV
- I. Tatbestandsvoraussetzungen des Art. 18 I AEUV
- 1. Subsidiarität
- 2. Anwendbarkeit
- a. Sachlicher Anwendungsbereich
- b. Räumlicher und zeitlicher Anwendungsbereich
- c. Persönlicher Anwendungsbereich
- 3. Diskriminierung
- a. Unmittelbare Diskriminierung
- b. Mittelbare Diskriminierung
- c. Umgekehrte Diskriminierung
- d. Diskriminierung und allgemeine Beschränkung
- II. Beeinträchtigung und Rechtfertigung i.S.d. Art. 18 I AEUV
- III. Sekundärrechtliche Regelung des allgemeinen Diskriminierungsverbots
- C. Bedeutung des allgemeinen Diskriminierungsverbots für die europäische Integration
- I. Unionsbürgerschaft als wesentliches Mittel der europäischen Integration
- 1. Unionsbürgerschaft nach Art. 20 AEUV
- 2. Auswirkungen von Brexit auf der europäischen und der britischen Seite
- II. Allgemeines Freizügigkeitsrecht als Werkzeug für die europäische Integration
- 1. Allgemeines Freizügigkeitsrecht als Grundfreiheit und Unionsbürgerrecht
- a. Bedeutung der allgemeinen Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union
- b. Unionsbürgerrichtlinie (Richtlinie 2004/38/EG vom 29. April 2004)
- c. Auffangfreiheit für Studierende - ein Recht auf nicht-wirtschaftliche Integration
- 2. Allgemeines Freizügigkeitsrecht als soziales Gleichstellungsrecht
- III. Art. 18 AEUV als Initiator für die Vertiefung des Binnenmarktes
- IV. Wirkung des allgemeinen Diskriminierungsverbots auf nationale Verfassungen - ein Einblick in das deutsche Grundgesetz
- V. Reichweite des Art. 18 AEUV hinsichtlich Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen
- D. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert das Verbot der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit gemäß Art. 18 AEUV im Kontext der europäischen Integration. Sie beleuchtet die Entstehungsgeschichte und Entwicklung dieses Verbots, untersucht seine Bedeutung für die Unionsbürgerschaft und das allgemeine Freizügigkeitsrecht sowie seine Auswirkungen auf den Binnenmarkt und nationale Verfassungen.
- Entwicklung des Art. 18 AEUV
- Anwendbarkeit und Reichweite des Verbots der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit
- Bedeutung des Art. 18 AEUV für die Unionsbürgerschaft und das Freizügigkeitsrecht
- Auswirkungen des Art. 18 AEUV auf den Binnenmarkt und nationale Verfassungen
- Bedeutung des Art. 18 AEUV für die europäische Integration
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Seminararbeit vor und führt in die Thematik des Art. 18 AEUV ein. Der erste Teil beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Art. 18 AEUV und die Herausforderungen, die mit der Durchsetzung eines allgemeinen Diskriminierungsverbots verbunden waren. Der zweite Teil befasst sich mit den Tatbestandsvoraussetzungen des Art. 18 AEUV, einschließlich der Subsidiarität, Anwendbarkeit und der verschiedenen Formen der Diskriminierung. Zudem werden die rechtlichen Aspekte der Beeinträchtigung und Rechtfertigung i.S.d. Art. 18 I AEUV sowie die sekundärrechtliche Regelung des allgemeinen Diskriminierungsverbots untersucht.
Der dritte Teil analysiert die Bedeutung des allgemeinen Diskriminierungsverbots für die europäische Integration, wobei die Unionsbürgerschaft als ein wesentliches Mittel der Integration und die Auswirkungen des Brexit auf europäischer und britischer Seite betrachtet werden. Des Weiteren wird das allgemeine Freizügigkeitsrecht als Werkzeug der europäischen Integration beleuchtet, inklusive seiner Bedeutung innerhalb der Europäischen Union, der Unionsbürgerrichtlinie und der Auffangfreiheit für Studierende. Auch die Rolle des Art. 18 AEUV bei der Vertiefung des Binnenmarktes wird analysiert.
Der vierte Teil befasst sich mit der Wirkung des allgemeinen Diskriminierungsverbots auf nationale Verfassungen, insbesondere mit Bezug auf das deutsche Grundgesetz. Schließlich wird die Reichweite des Art. 18 AEUV hinsichtlich Drittstaatsangehörigen und Staatenlosen untersucht.
Schlüsselwörter
Art. 18 AEUV, Diskriminierungsverbot, Staatsangehörigkeit, Unionsbürgerschaft, Freizügigkeitsrecht, Binnenmarkt, Europäische Integration, Grundrechte, Grundgesetz.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt Art. 18 AEUV?
Art. 18 AEUV verbietet im Anwendungsbereich der Verträge jede Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit.
Warum wird dieses Verbot als Fundament der europäischen Integration bezeichnet?
Es sichert die Gleichrangigkeit der Mitgliedstaaten und die gleichberechtigte Teilhabe aller Unionsbürger am gemeinschaftlichen Besitzstand (Acquis communautaire).
Welche Rolle spielt der Europäische Gerichtshof (EuGH) dabei?
Der EuGH gilt als Motor der Integration, da er durch die Auslegung der Verträge das Diskriminierungsverbot stärkt und nationale Rechtsordnungen beeinflusst.
Was ist der Unterschied zwischen unmittelbarer und mittelbarer Diskriminierung?
Unmittelbare Diskriminierung knüpft direkt an die Staatsangehörigkeit an, während mittelbare Diskriminierung durch Kriterien erfolgt, die faktisch meist Ausländer betreffen (z.B. Wohnsitzklauseln).
Wie wirkt sich Art. 18 AEUV auf Studierende aus?
Er fungiert als Auffangfreiheit, die Studierenden das Recht auf nicht-wirtschaftliche Integration und Gleichbehandlung in anderen EU-Mitgliedstaaten gewährt.
- Quote paper
- Derya Akdag (Author), 2017, Das Verbot der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit als Fundament der europäischen Integration (Art. 18 AEUV), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/463380