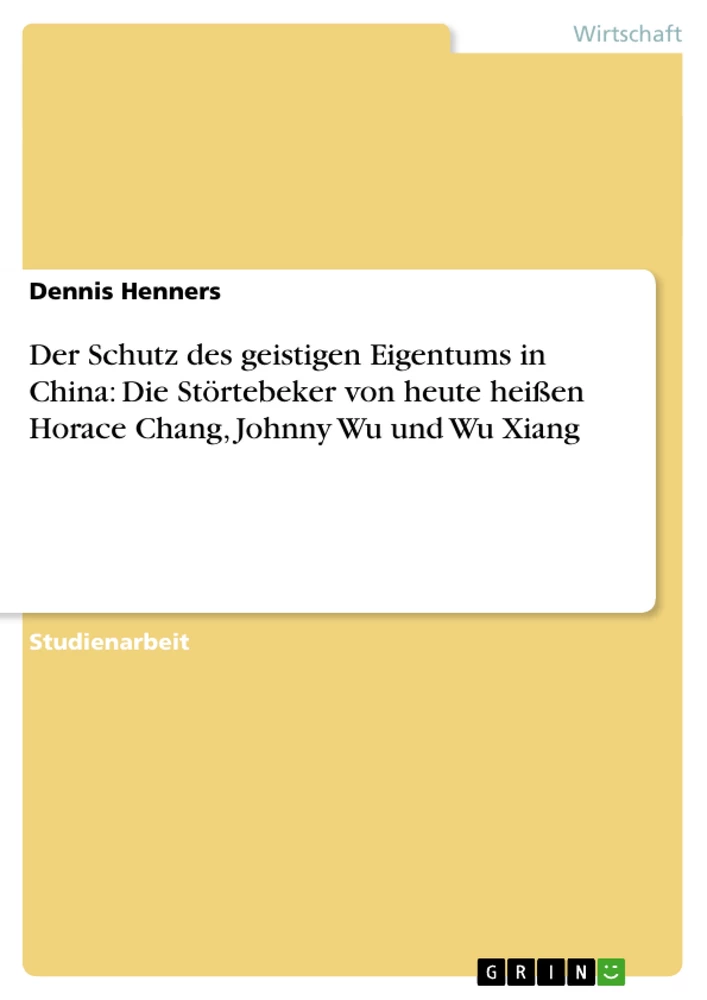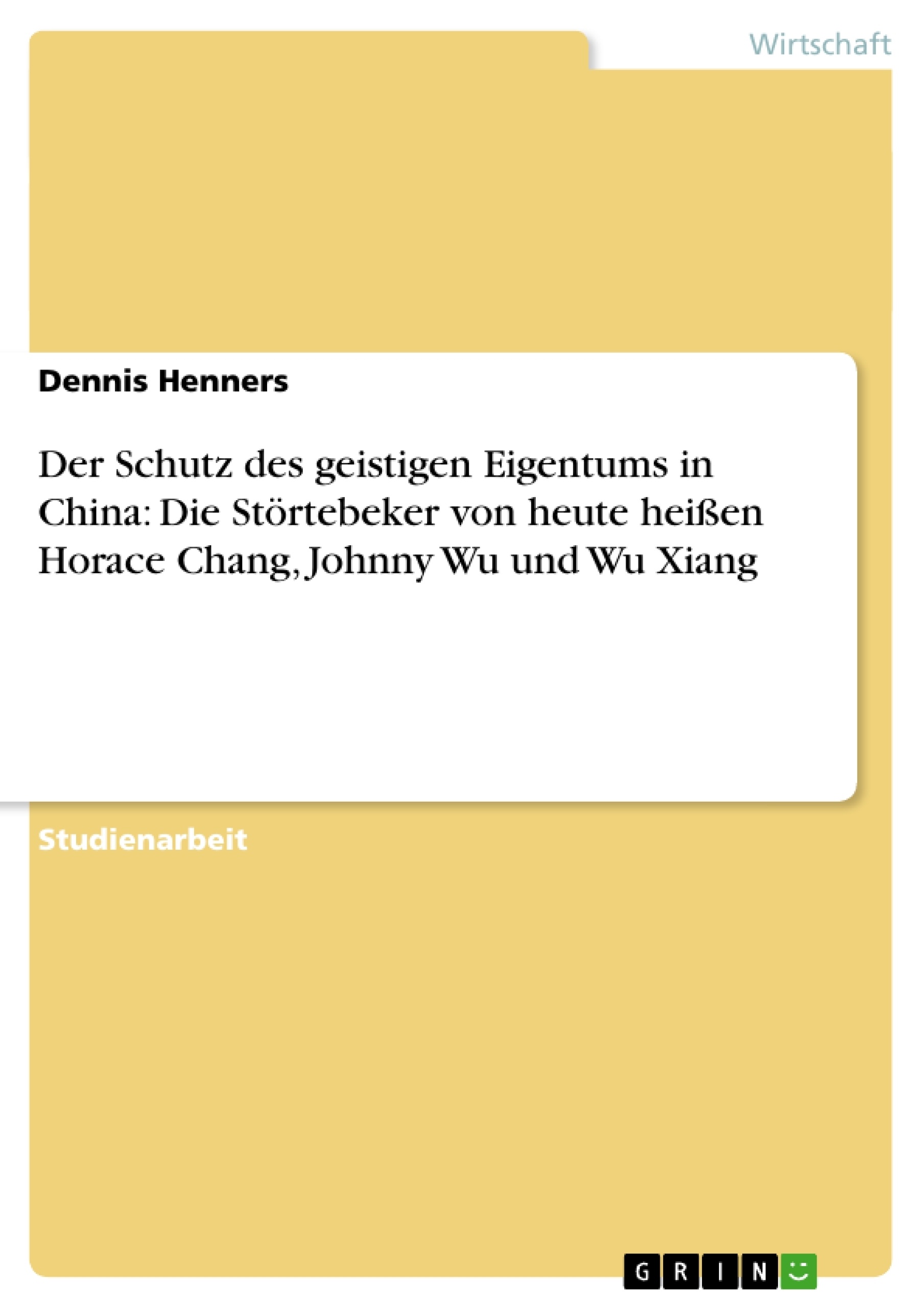Lang ist es her, doch die Chinesen scheinen bis heute die konfuzianischen Lehren nicht vergessen zu haben. So kommt es zu Künstlern, die bis auf den letzten Pinselstrich ein Leben lang van Goghs „Sonnenblumen“ nachmalen, und andere Kreative, die in weiser Voraussicht schon einmal Band sechs, sieben und acht der Harry Potter Serie schreiben: “Harry Potter und der Leopardendrache“, „Harry Potter und der große Trichter“. Die Imitationsfreude der Chinesen kennt keine Grenzen. Ob Akkuschrauber oder Rasierklingen, Sportschuhe oder Sicherungen, Bremsscheiben oder Antibaby-Pillen, Motorräder oder Mars-Riegel. Zuweilen, so als hätten sie ein schlechtes Gewissen, verändern sie einige Buchstaben des Namens, der Marke: Statt „Fa“ steht dann „Fu“ auf der Deoflasche, die dem Original ansonsten bis ins Detail zu gleichen scheint. Ein Unterschied, der für chinesische Kundschaft kaum auszumachen ist. Die Absatzmärkte für Plagiate, „made in China“ beschränken sich schon längst nicht mehr auf Straßenbazare, wie dem direkt vor der US-Botschaft liegendem Pekinger Seidemarkt, wo gefälschte Kleidung namenharter Labels wie „the North Face“, Taschen der Luxusmarke „Louis Vitton“ und DVDs mit den neusten Hollywoodstreifen den Besitzer wechseln. Die Unternehmen kämpfen zuweilen mit einer Flutwelle an Fälschungen, welche bis vor ihre Haustüren geschwemmt wird. Teilweise ist dieses „Treibgut“ für Laien kaum von den Originalen zu unterscheiden. Dies rührt meist daher, dass die Piraten oft die gesamte Produktionskette, vom Rohstofflieferant über die Fabrikationsanlagen bis hin zum Vertrieb fälschen. Dennoch haben all diese Produkte eines gemein: Sie kosten allesamt ein Bruchteil des Originals und sind so echt wie „ein 25-Euroschein."
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsabgrenzung
- Der Partner, der Konkurrent: Sieben Ursachen des Technologieklaus
- Der gesetzliche Hintergrund
- Die Gesetzeseinbettung des geistigen Eigentums im chinesischen Privatrecht
- Das TRIPS-Abkommen
- Die Bemühungen gegen die Produktpiraten
- Die Risiken der Plagiate
- Für den Konsumenten
- Für die Unternehmen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Problematik des geistigen Eigentums in China. Sie analysiert die Gründe für den weitverbreiteten Produktpiraterismus und beleuchtet die gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie die Bemühungen zur Bekämpfung von Fälschungen.
- Die Ursachen des Technologieklaus in China
- Die rechtlichen Grundlagen des geistigen Eigentums in China
- Die Herausforderungen bei der Durchsetzung des geistigen Eigentums
- Die Risiken von Produktpiraterie für Konsumenten und Unternehmen
- Die Bedeutung von internationalen Abkommen wie TRIPS
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Produktpiraterismus in China ein und stellt das Problem in den Kontext der konfuzianischen Lehre. Die Arbeit analysiert zunächst den Begriff des geistigen Eigentums und untersucht die Gründe für den Technologieklaus. Kapitel 4 beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen des geistigen Eigentums in China, insbesondere die Gesetzeseinbettung im chinesischen Privatrecht und die Relevanz des TRIPS-Abkommens. Weiterhin werden die Bemühungen zur Bekämpfung von Produktpiraten sowie die damit verbundenen Risiken für Konsumenten und Unternehmen behandelt.
Schlüsselwörter
Geistiges Eigentum, Produktpiraterie, Technologieklaus, China, TRIPS, Gesetzeseinbettung, Produktpiraten, Konsumenten, Unternehmen, Risiken.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Produktpiraterie in China so weit verbreitet?
Die Arbeit nennt kulturelle Gründe wie die konfuzianische Tradition (Imitation als Ehre) sowie ökonomische Ursachen wie den schnellen technologischen Nachholbedarf.
Was ist das TRIPS-Abkommen?
TRIPS ist ein internationales Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum, dem China im Rahmen seines WTO-Beitritts zugestimmt hat.
Welche Risiken bergen Plagiate für Konsumenten?
Gefälschte Produkte wie Bremsscheiben, Antibaby-Pillen oder Sicherungen können lebensgefährlich sein, da sie oft keine Qualitätskontrollen durchlaufen.
Wie reagieren Unternehmen auf den Technologieklau in China?
Unternehmen verstärken ihre Bemühungen durch rechtliche Schritte, technische Schutzmaßnahmen und eine sorgfältigere Auswahl ihrer Partner vor Ort.
Was versteht man unter „Shanzhai“ im Kontext der Imitationsfreude?
Es beschreibt die chinesische Phänomenologie der Nachahmung von Markenprodukten, die oft täuschend echt aussehen, aber nur einen Bruchteil des Originals kosten.
Wie steht es um die rechtliche Durchsetzung des geistigen Eigentums in China?
Obwohl Gesetze im Privatrecht existieren, bleibt die praktische Durchsetzung aufgrund lokaler Interessen und unterschiedlicher Rechtsauffassungen eine große Herausforderung.
- Citar trabajo
- Dennis Henners (Autor), 2005, Der Schutz des geistigen Eigentums in China: Die Störtebeker von heute heißen Horace Chang, Johnny Wu und Wu Xiang, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46443