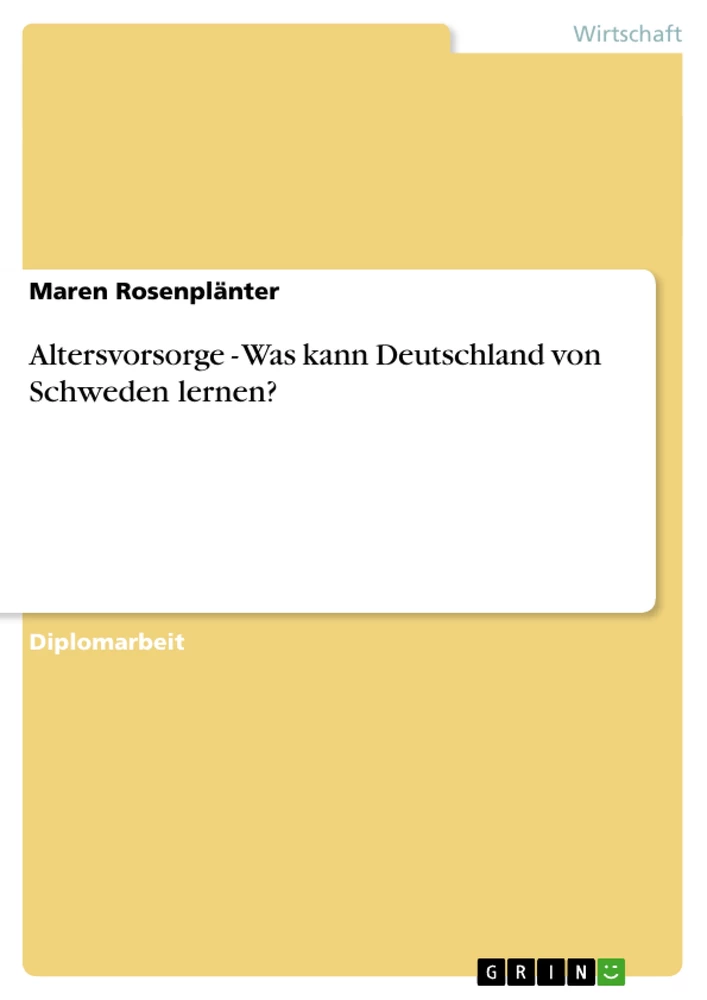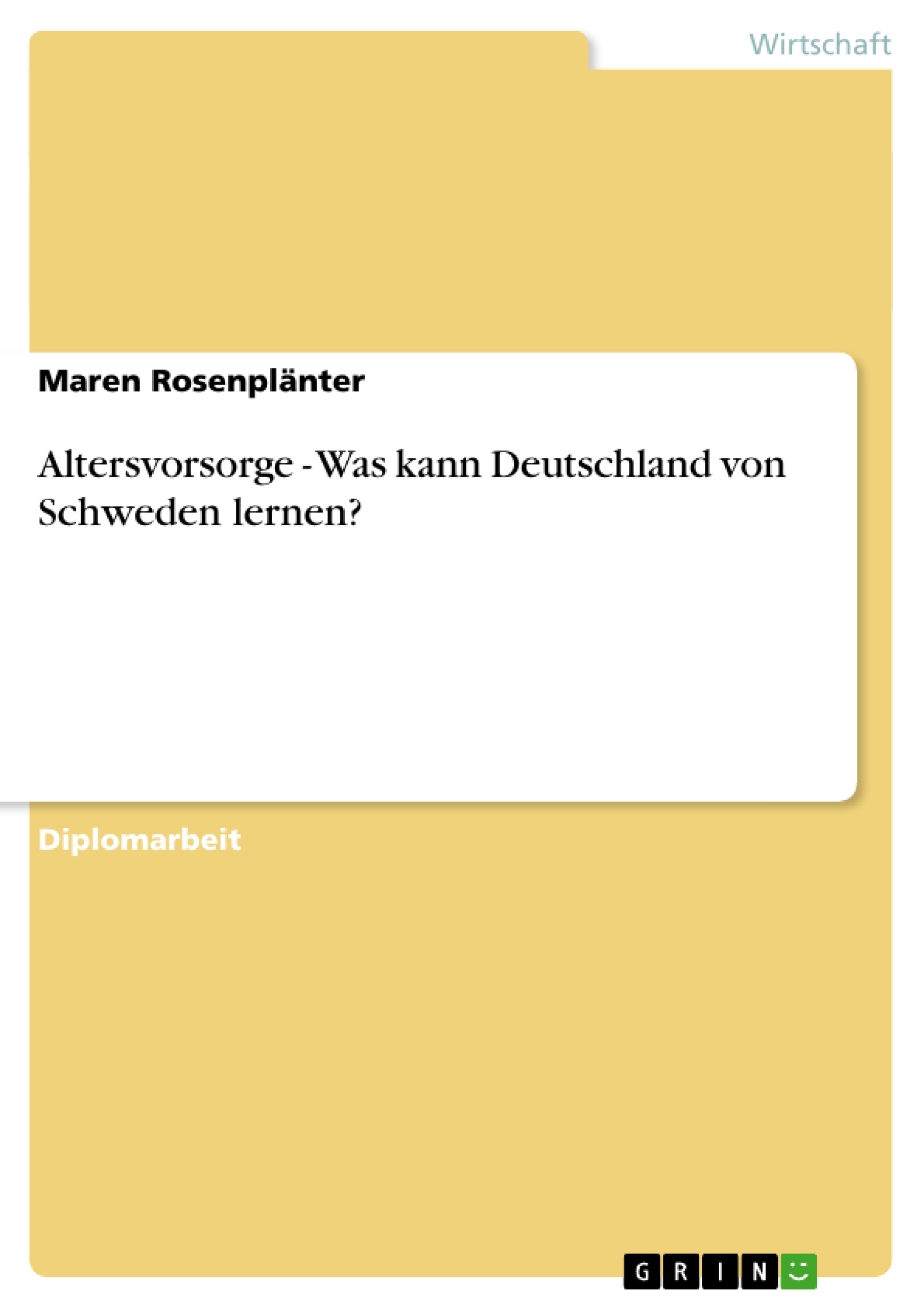Schweden und der schwedische Wohlfahrtsstaat gerieten 1991 nach Jahrzehnten der Stärke in eine der schwersten Krisen in der Geschichte des Königreichs. Einige der Gründe waren eine weltweite Rezession, eine Bankenkrise, eine unterfinanzierte Steuerreform und eine steigende Arbeitslosigkeit. Drei Jahre lang arbeitete die schwedische Regierung gegen ein beispielloses Haushaltsdefizit, 1994 fehlten in den öffentlichen Kassen 11%.
Kurz: „Die Grundpfeiler der schwedischen Solidargemeinschaft - darunter die Vollbeschäftigung - wurden erschüttert.“
Die politisch Verantwortlichen wandten sich daher Mitte der 90er Jahre zur Anpassung des schwedischen Sozialstaates den neuen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu. 1998 nach einer 10jährigen, intensiven Diskussion wurde ein neues Rentensystem eingeführt. Sowohl Regierungs- und Oppositionsfraktion als auch Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften trugen diese Reform.
Konsequent wurde der Sozialstaat nach altem Modell in kurzer Zeit zu einem modernen, angepassten Wohlfahrtsstaat umgebaut.
Deutschland ist vielleicht nicht in einer solch tiefen Krise wie die Schweden es Anfang der `90er Jahre waren. Doch ist im Hinblick auf die Problematik der Renten in Deutschland ein Vergleich mit den Skandinaviern sinnvoll. Kann unser Sozialstaat effizient umgebaut werden, bevor es zu einer größeren Krise und damit größeren Einschneidungen kommen muss?
Einzelne Teile des schwedischen Vorbildes zumindest können Motivation für das deutsche Altersvorsorgesystem sein. Die gesamten Strukturen zu übertragen wird kaum möglich sein. Selbst falls die Politiker dies wollten, blieben die Grundvoraussetzungen zu verschieden. Einer der Hauptgründe ist die Einstellung der deutschen Gesellschaft zu Reformen, die meist mit Kürzungen der Sozialleistungen einhergehen. Die Schweden haben ein ganz anderes Grundvertrauen in die Aktivitäten des Staates.
Teilaspekte aus dem Vergleich geben Hinweise auf mögliche - nicht zwangsläufig richtige -Reformansätze: So zeigt der Ländervergleich z.B., dass die nachgelagerte Besteuerung eine sinnvolle Neuerung ist, die mit dem Alterseinkünftegesetz in Deutschland auch schon umgesetzt wurde.
Kürzungen im Sozialsystem werden nicht zu umgehen sein, weil die Finanzierung ansonsten nicht zu tragen ist.
Ein weiteres Beispiel sind individuelle Rentenkonten aus dem NDC-System, bei dem die Sparer ihre Beiträge auf eigene Konten für die Rente einbezahlen.
Inhaltsverzeichnis
- Ehrenwörtliche Erklärung
- Kurzfassung
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Anlagenverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Motivation
- 1.2 Aufgabenstellung und -abgrenzung
- 1.3 Ziel der Arbeit
- 1.4 Vorgehen
- 2 Grundlagen
- 2.1 Hintergrund des deutschen Sozialstaates
- 2.1.1 Die drei Säulen des Alterssicherungssystems
- 2.1.1.1 Staatliche Altersvorsorge
- 2.1.1.2 Betriebliche Altersvorsorge
- 2.1.1.2.1 Direktzusage
- 2.1.1.2.2 Unterstützungskasse
- 2.1.1.2.3 Direktversicherung
- 2.1.1.2.4 Pensionskasse
- 2.1.1.2.5 Pensionsfonds
- 2.1.1.3 Private Altersvorsorge
- 2.2 Hintergrund des schwedischen Sozialstaates
- 2.2.1 Das \"Schwedische Modell\"
- 2.2.1.1 Der \"stillschweigende Vertrag\"
- 2.2.1.2 Krise und Überwindung I
- 2.2.1 Das \"Schwedische Modell\"
- 2.1.1 Die drei Säulen des Alterssicherungssystems
- 3 Analyse: Deutschland
- 3.1 Der Sozialstaat Deutschland
- 3.1.1 Das Alterseinkünftegesetz
- 3.1.1.1 Besteuerung Schritt für Schritt
- 3.1.2 Die gesetzliche Rentenversicherung als erste Säule
- 3.1.2.1 Das Umlageverfahren
- 3.1.2.2 Lohnabhängigkeit
- 3.1.2.3 Arbeitsmarkt
- 3.1.2.4 Versicherungsfremde Leistungen
- 3.1.3 Die betriebliche Altersvorsorge als zweite Säule
- 3.1.4 Die private Rentenversicherung als dritte Säule
- 3.1.4.1 Lebens- und Rentenversicherungen
- 3.1.4.1.1 Kommentar
- 3.1.4.2 Die \"Rürup-Rente\"
- 3.1.4.2.1 Kommentar
- 3.1.4.3 Die \"Riester-Rente\"
- 3.1.4.1 Lebens- und Rentenversicherungen
- 3.1.1 Das Alterseinkünftegesetz
- 4 Alternative Lösung aus Schweden?
- 4.1 Der Sozialstaat Schweden
- 4.1.1 Krise und Überwindung II
- 4.1.2 Ein neuer Gesellschaftsvertrag
- 4.2 Altersvorsorge
- 4.2.1 Alterssicherungssystem und Bedeutung der Vorsorgesysteme
- 4.2.1.1 Die staatliche Altersvorsorge als erste Säule
- 4.2.1.1.1 Die Garantierente
- 4.2.1.1.2 Die einkommensabhängige Zusatzrente
- 4.2.1.1.3 Die kapitalgedeckte Prämienrente
- 4.2.1.1.4 Finanzierung
- 4.2.1.2 Die betriebliche Altersvorsorge als zweite Säule
- 4.2.1.2.1 Pensionsrückstellungen
- 4.2.1.2.2 Pensionsfonds und Direktversicherung
- 4.2.1.3 Die private Altersvorsorge als dritte Säule
- 4.2.1.3.1 Kapitaleinkünfte
- 4.2.1.3.2 Private Rentenversicherung und Pensionssparkonten
- 4.2.1.1 Die staatliche Altersvorsorge als erste Säule
- 4.2.1 Alterssicherungssystem und Bedeutung der Vorsorgesysteme
- 5 Empfehlungen für Deutschland
- 5.1 Übertragbarkeit des Modells
- 5.2 Übertragbarkeit ausgewählter Elemente
- 5.2.1 Steuer
- 5.2.2 Sozialleistungen und Finanzierung
- 5.2.3 Das NDC-System
- 5.2.4 Renteneintrittsalter
- 6 Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der deutschen Altersvorsorge im Vergleich zum schwedischen System. Das Ziel ist es, herauszufinden, welche Erkenntnisse aus der schwedischen Reform des Sozialstaates für Deutschland relevant sind.
- Vergleich des deutschen und schwedischen Sozialstaates
- Analyse der deutschen Altersvorsorge
- Bewertung der schwedischen Altersvorsorge
- Übertragungsmöglichkeiten von schwedischen Modellen auf Deutschland
- Bewertung der Übertragbarkeit einzelner Elemente des schwedischen Systems
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, in der die Motivation für die Arbeit, die Aufgabenstellung und -abgrenzung, das Ziel der Arbeit sowie das Vorgehen vorgestellt werden. Im zweiten Kapitel werden die Grundlagen für die Arbeit gelegt, indem der deutsche und schwedische Sozialstaat im historischen Kontext dargestellt wird.
Kapitel 3 analysiert den deutschen Sozialstaat und beleuchtet die drei Säulen des Alterssicherungssystems: die staatliche, die betriebliche und die private Altersvorsorge. Dabei werden die Stärken und Schwächen des deutschen Systems im Detail untersucht. Kapitel 4 widmet sich dem schwedischen Sozialstaat und der dort implementierten Reform des Alterssicherungssystems. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei auf die drei Säulen des schwedischen Systems, die staatliche, die betriebliche und die private Altersvorsorge, gelegt.
In Kapitel 5 werden die Erkenntnisse aus dem Vergleich der beiden Sozialsysteme zusammengefasst und konkrete Empfehlungen für Deutschland abgeleitet. Dabei wird die Übertragbarkeit des schwedischen Modells auf Deutschland, sowie die Übertragbarkeit einzelner Elemente des schwedischen Systems auf Deutschland diskutiert.
Schlüsselwörter
Altersvorsorge, Sozialstaat, Schweden, Deutschland, Reform, Umlageverfahren, Kapitaldeckung, Renteneintrittsalter, Garantierente, Zusatzrente, Prämienrente, NDC-System.
Häufig gestellte Fragen
Was macht das schwedische Rentensystem zum Vorbild?
Schweden hat sein System 1998 modernisiert und setzt auf eine Kombination aus Garantierente, einkommensabhängiger Zusatzrente und kapitalgedeckter Prämienrente.
Was ist das NDC-System in Schweden?
NDC steht für „Notional Defined Contribution“. Es handelt sich um individuelle Rentenkonten, auf denen Beiträge fiktiv verzinst werden, was die Transparenz für die Sparer erhöht.
Könnte Deutschland das schwedische Modell komplett übernehmen?
Eine vollständige Übernahme ist schwierig, da die gesellschaftlichen Voraussetzungen und das Staatsvertrauen in Schweden deutlich höher sind als in Deutschland.
Welche Rolle spielt die nachgelagerte Besteuerung?
Bei der nachgelagerten Besteuerung sind Beiträge in der Ansparphase steuerfrei, während die Rentenzahlungen im Alter versteuert werden – ein Modell, das Deutschland bereits teilweise adaptiert hat.
Was sind die drei Säulen der Altersvorsorge in Deutschland?
Die drei Säulen sind die gesetzliche Rentenversicherung (Umlageverfahren), die betriebliche Altersvorsorge und die private Altersvorsorge (z.B. Riester- oder Rürup-Rente).
- 4.1 Der Sozialstaat Schweden
- 3.1 Der Sozialstaat Deutschland
- 2.1 Hintergrund des deutschen Sozialstaates
- Citation du texte
- Maren Rosenplänter (Auteur), 2005, Altersvorsorge - Was kann Deutschland von Schweden lernen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46458