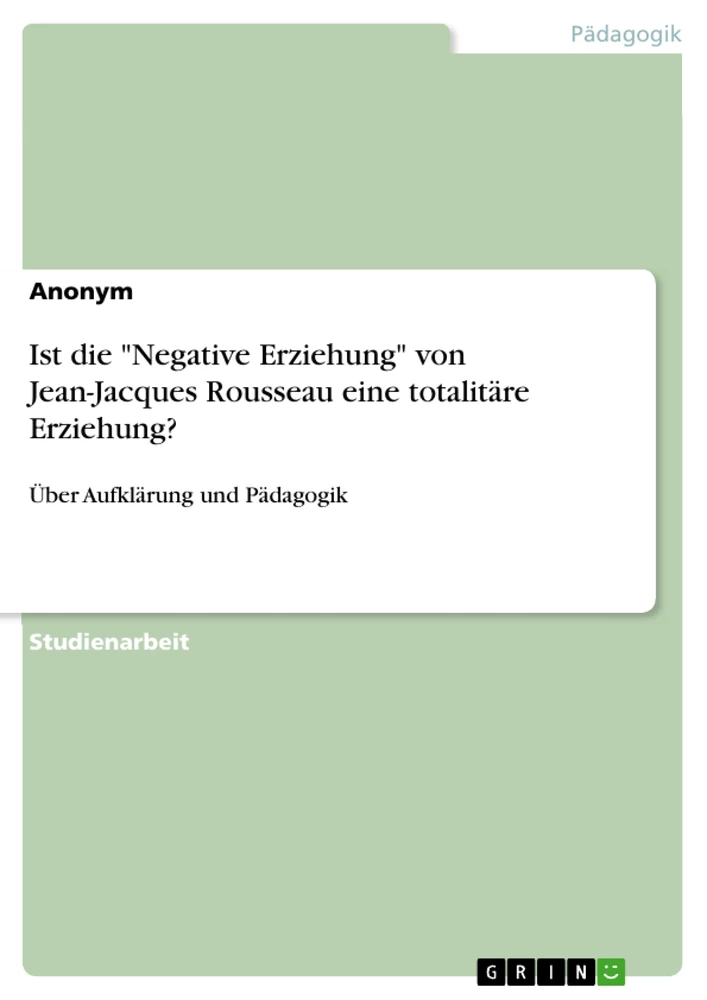In dieser Hausarbeit werde ich mich auf Rousseaus Begriff der "Negativen Erziehung" beziehen und die Frage beantworten: Ist die "Negative Erziehung" eine totalitäre Erziehung? Um diese Frage beantworten zu können, werde ich mich im Verlauf der Hausarbeit auch auf die Antinomie "Natur und Disziplinierung" beziehen. Anhand dieses Spannungsverhältnisses werde ich die Auswirkung Rousseaus Erziehungstheorie auf die heutige Pädagogik erwähnen, wobei ich mich hierbei auf die Montessori-Pädagogik beschränken werde.
Jean-Jacques Rousseau lebte im 18. Jahrhundert zur Zeit der Aufklärung. Er hat eine große Anzahl bedeutender Schriften vorzuweisen, die sich auf seine vielen Interessen wie die Politik, Philosophie, Musik und Pädagogik beziehen. Seine wichtigsten Werke "der Gesellschaftsvertrag" und "Emil oder über die Erziehung" veröffentlichter er innerhalb kürzester Zeit hintereinander. Rousseau war der Ansicht, dass der Mensch von Natur aus gut sei und nahm mit seiner Botschaft "Zurück zur Natur", die er in "Emil oder über die Erziehung" verfasste, starken Einfluss auf die moderne Pädagogik.
In diesem Werk fordert Rousseaus mit der "Negativen Erziehung" die Erziehung zur Selbstbestimmung des Menschen, die sich an dem jeweiligen Zögling und nicht, wie damals üblich, an den allgemeinen Richtlinien der Gesellschaft orientieren sollte. Das Werk erfuhr sowohl viel Kritik als auch begeisterte Zustimmung. Kritisiert wurde vor allem seine Vorstellung, dass der Mensch von Natur aus gut sei, die Ablehnung von Eingriffen des Erziehers in Form von Geboten und Strafen, sowie die Vorstellung eines perfekten Erziehers, den es nicht geben würde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rousseau und die Aufklärung
- Aufklärung - gesellschaftspolitischer Hintergrund
- Kurzbiografie Rousseaus
- Emil oder über die Erziehung
- Negative Erziehung
- Der Erzieher
- Das Gesetz des Möglichen und Unmöglichen
- Beispiel der negativen Erziehung aus dem Roman „Emil oder über die Erziehung“
- Spannungsfeld Natur und Disziplinierung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Rousseaus Konzept der „Negativen Erziehung“ und beantwortet die Frage, ob diese eine totalitäre Erziehung darstellt. Der Fokus liegt dabei auf der Antinomie „Natur und Disziplinierung“ und den Auswirkungen Rousseaus Erziehungstheorie auf die heutige Pädagogik, insbesondere die Montessori-Pädagogik.
- Analyse des Begriffs „Negative Erziehung“ bei Rousseau
- Untersuchung der Antinomie „Natur und Disziplinierung“
- Beurteilung, ob die „Negative Erziehung“ totalitär ist
- Relevanz von Rousseaus Erziehungstheorie für die heutige Pädagogik
- Beispiel der Montessori-Pädagogik als Anwendung der „Negativen Erziehung“
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt den Hintergrund der Arbeit dar, indem sie Rousseaus Lebenswerk und seine Bedeutung für die Pädagogik beleuchtet. Sie führt in das Thema der „Negativen Erziehung“ ein und erläutert die Fragestellung der Arbeit.
- Rousseau und die Aufklärung: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den gesellschaftspolitischen Hintergrund der Aufklärung und die wichtigsten Merkmale dieser Epoche. Es befasst sich mit Rousseaus Leben und Werk und skizziert die Bedeutung seiner Schriften „der Gesellschaftsvertrag“ und „Emil oder über die Erziehung“ für die moderne Pädagogik.
- Negative Erziehung: Dieses Kapitel behandelt Rousseaus Konzept der „Negativen Erziehung“ im Detail. Es stellt den Erzieher als zentrale Figur vor, untersucht das Gesetz des Möglichen und Unmöglichen und beleuchtet die Anwendung der „Negativen Erziehung“ im Roman „Emil oder über die Erziehung“.
- Spannungsfeld Natur und Disziplinierung: Dieses Kapitel untersucht die Antinomie „Natur und Disziplinierung“ im Kontext von Rousseaus Erziehungstheorie. Es beleuchtet die Herausforderungen, die diese Antinomie für die Erziehung stellt, und erörtert die Auswirkungen auf die heutige Pädagogik.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Schlüsselwörter "Negative Erziehung", "Natur und Disziplinierung", "Rousseau", "Aufklärung", "Totalitarismus", "Montessori-Pädagogik", "Selbstbestimmung" und "Erziehung". Das Werk analysiert Rousseaus Konzept der "Negativen Erziehung" und untersucht die Frage, ob es totalitär ist. Es beleuchtet die Bedeutung von "Natur" und "Disziplinierung" in der Erziehung sowie die Relevanz von Rousseaus Ideen für die heutige Pädagogik, insbesondere die Montessori-Pädagogik.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Jean-Jacques Rousseau unter "Negativer Erziehung"?
Die "Negative Erziehung" nach Rousseau ist eine Erziehung zur Selbstbestimmung, die sich am Zögling orientiert und nicht an gesellschaftlichen Richtlinien. Sie verzichtet auf direkte Gebote und Strafen durch den Erzieher.
Ist Rousseaus Erziehungstheorie als totalitär einzustufen?
Diese Arbeit untersucht kritisch, ob die totale Kontrolle des Umfelds durch den Erzieher in "Emil" totalitäre Züge trägt, insbesondere im Spannungsfeld zwischen Natur und Disziplinierung.
Welchen Einfluss hatte Rousseau auf die Montessori-Pädagogik?
Rousseaus Prinzip "Zurück zur Natur" und die Konzentration auf die Bedürfnisse des Kindes finden sich als Grundpfeiler in der modernen Montessori-Pädagogik wieder.
Was ist die zentrale Botschaft von "Emil oder über die Erziehung"?
Rousseau vertritt die Ansicht, dass der Mensch von Natur aus gut ist und die Erziehung ihn vor dem korrumpierenden Einfluss der Gesellschaft schützen muss.
Was besagt das "Gesetz des Möglichen und Unmöglichen"?
Es beschreibt die pädagogische Methode, dem Zögling nur durch die Notwendigkeit der Dinge Grenzen zu setzen, anstatt durch den menschlichen Willen oder Verbote.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Ist die "Negative Erziehung" von Jean-Jacques Rousseau eine totalitäre Erziehung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/464908