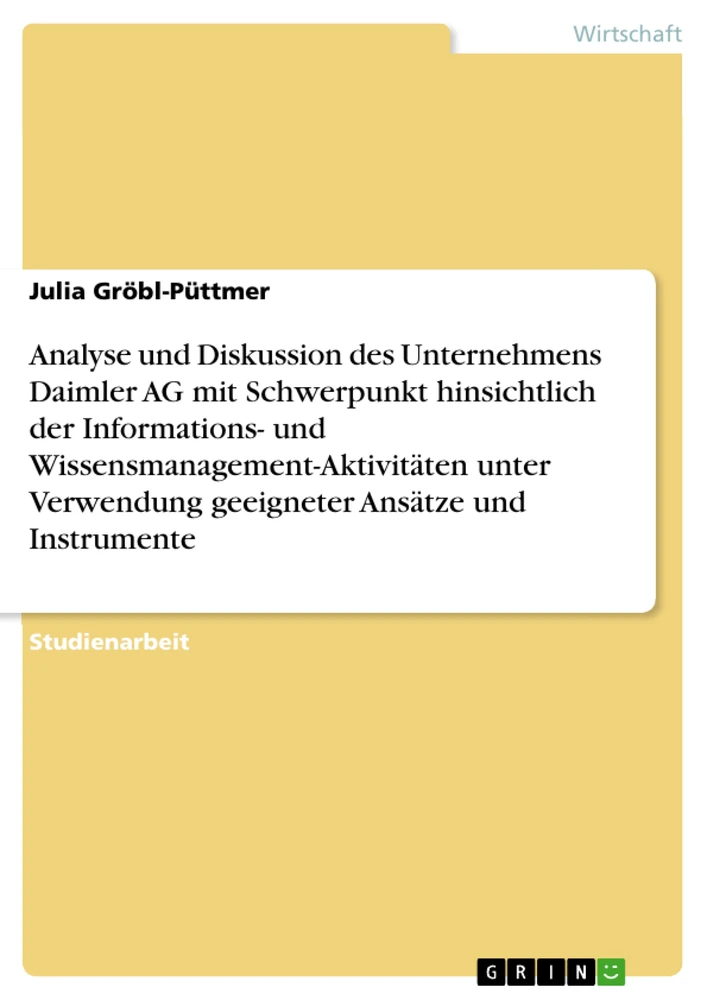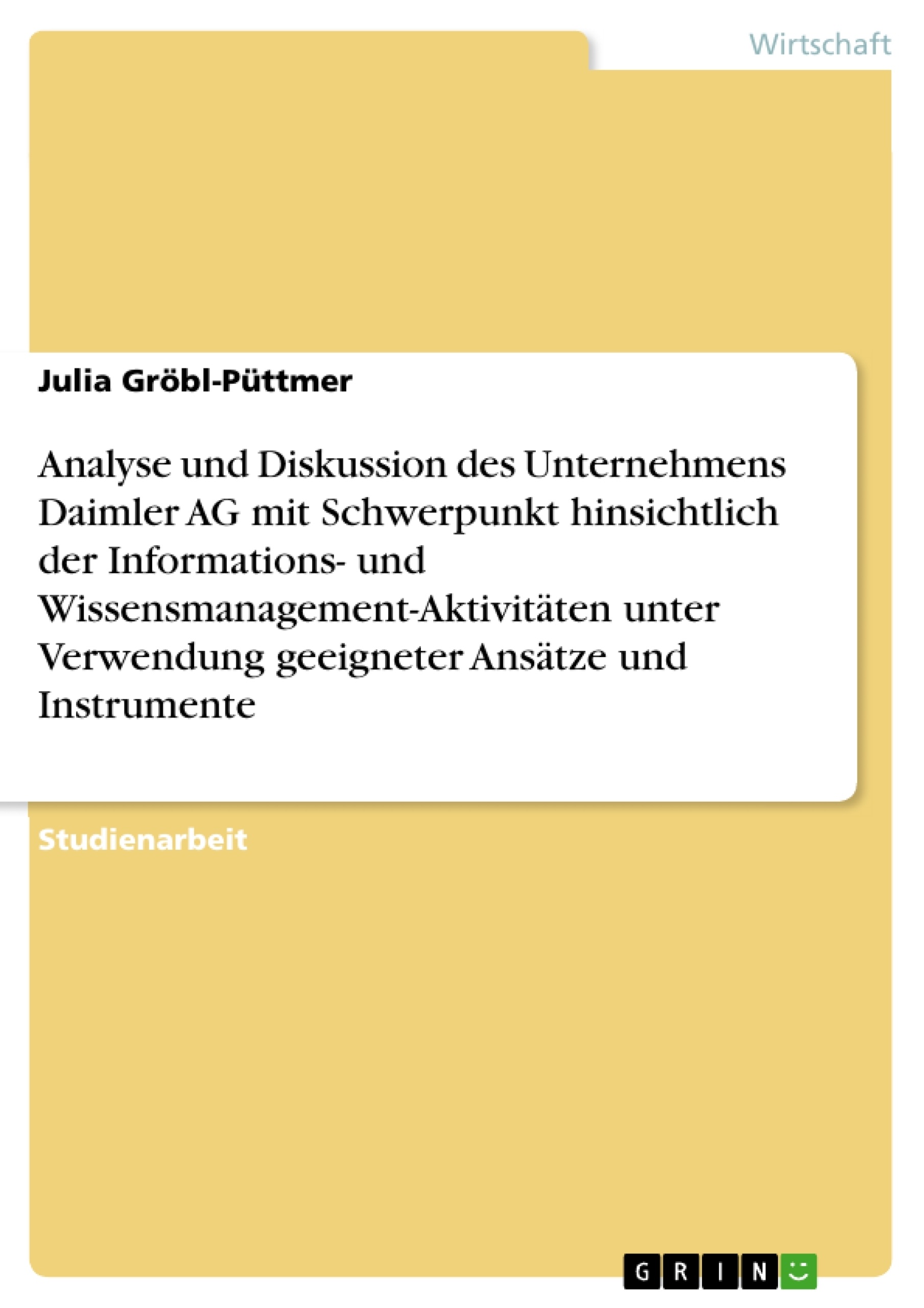Ziel ist es herauszuarbeiten, wie mit der Ressource Wissen umgegangen werden soll, damit es allen Beteiligten einen Mehrwert verschafft. Außerdem, wie Wissen aufgebaut, geteilt und vervielfacht werden kann, sodass es sich konstant verbreitet ohne verloren zu gehen. Das dafür geeignete Modell Bausteine des Wissensmanagements nach Probst et al. wird in diesem Kontext vorgestellt. Konkret werden in dieser Arbeit das Wissensmanagement und der Umgang mit Wissen im Unternehmen Daimler AG beleuchtet. Vorab wird das Geschäftsmodell vorgestellt und anhand der vorab genannten Punkte bearbeitet. Als wesentlicher Bestandteil der Hausarbeit werden verschiedene Handlungsoptionen für ein erfolgreiches Wissensmanagement im Konzern Daimler AG erarbeitet und eine Emp-fehlung hierzu abgeleitet. Als abschließender Teil folgen ein Fazit und ein Ausblick.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Wissensmanagement
- Begriffsdefinitionen
- Ziele von Wissensmanagement
- Modell des Wissensmanagements
- Wissensmanagement im Unternehmen Daimler AG
- Daimler AG - Geschäftsmodell, Strategie und Kennzahlen
- Daimler AG – Unternehmens- und Führungskultur
- Daimler AG - Anwendung des Bausteine-Modells
- Diskussion und Handlungsempfehlung
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert das Wissensmanagement im Unternehmen Daimler AG. Ziel ist es, die Bedeutung von Wissen im Unternehmenskontext aufzuzeigen und die Herausforderungen im Umgang mit Wissen in der Praxis zu beleuchten.
- Bedeutung von Wissen in Unternehmen
- Herausforderungen im Wissensmanagement
- Modell des Wissensmanagements nach Probst et al.
- Wissensmanagement bei Daimler AG
- Handlungsempfehlungen für Daimler AG
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung befasst sich mit der Relevanz von Wissen in Unternehmen und stellt die Problematik des Umgangs mit Wissen im Zeitalter des Internets dar. Außerdem wird das Ziel der Arbeit erläutert, welches darin besteht, die Bedeutung von Wissensmanagement und die Anwendung des Bausteine-Modells nach Probst et al. im Unternehmen Daimler AG zu analysieren.
Problemstellung
Dieses Kapitel beleuchtet die Herausforderungen, denen Unternehmen im Kontext der Globalisierung, Digitalisierung und des zunehmenden Wettbewerbs gegenüberstehen. Es wird deutlich gemacht, dass Unternehmen auf ein effektives Wissensmanagement angewiesen sind, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.
Wissensmanagement
In diesem Kapitel werden die Begriffe Wissen, Informationsmanagement und Wissensmanagement definiert und voneinander abgegrenzt. Das Modell des Wissensmanagements nach Probst et al. wird vorgestellt und die Ziele des Wissensmanagements im Unternehmenskontext erläutert.
Wissensmanagement im Unternehmen Daimler AG
Dieses Kapitel widmet sich dem Geschäftsmodell, der Strategie und den Kennzahlen der Daimler AG. Außerdem wird die Unternehmens- und Führungskultur beleuchtet, sowie die Anwendung des Bausteine-Modells auf das Unternehmen Daimler AG analysiert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Wissensmanagement, Informationsmanagement, Daimler AG, Bausteine-Modell nach Probst et al., Kompetenzmanagement, Geschäftsmodell, Strategie, Kennzahlen, Unternehmens- und Führungskultur, Handlungsempfehlung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel von Wissensmanagement bei der Daimler AG?
Ziel ist es, die Ressource Wissen so zu nutzen, dass sie allen Beteiligten Mehrwert bietet, Wissen aufgebaut, geteilt und vervielfacht wird, ohne verloren zu gehen.
Welches Modell wird zur Analyse des Wissensmanagements verwendet?
Die Arbeit nutzt das Modell „Bausteine des Wissensmanagements“ nach Probst et al., um die Prozesse im Konzern zu beleuchten.
Wie unterscheiden sich Daten, Informationen und Wissen?
Daten sind Rohzeichen, Informationen sind kontextualisierte Daten, und Wissen entsteht, wenn Informationen durch Erfahrungen und Vernetzung für Handlungen nutzbar gemacht werden.
Welche Rolle spielt die Unternehmenskultur beim Wissensmanagement?
Eine offene Führungs- und Unternehmenskultur ist entscheidend, damit Mitarbeiter bereit sind, ihr Wissen zu teilen und Innovationen voranzutreiben.
Welchen Herausforderungen steht Daimler durch die Digitalisierung gegenüber?
Die Digitalisierung erfordert einen schnelleren Wissensaustausch und den Schutz vor Informationsüberflutung bei gleichzeitigem Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit.
Gibt es konkrete Handlungsempfehlungen für den Konzern?
Ja, die Arbeit leitet aus der Analyse verschiedene Optionen ab, um das Wissensmanagement im Konzern strategisch zu optimieren.
- Arbeit zitieren
- Julia Gröbl-Püttmer (Autor:in), 2019, Analyse und Diskussion des Unternehmens Daimler AG mit Schwerpunkt hinsichtlich der Informations- und Wissensmanagement-Aktivitäten unter Verwendung geeigneter Ansätze und Instrumente, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/465317