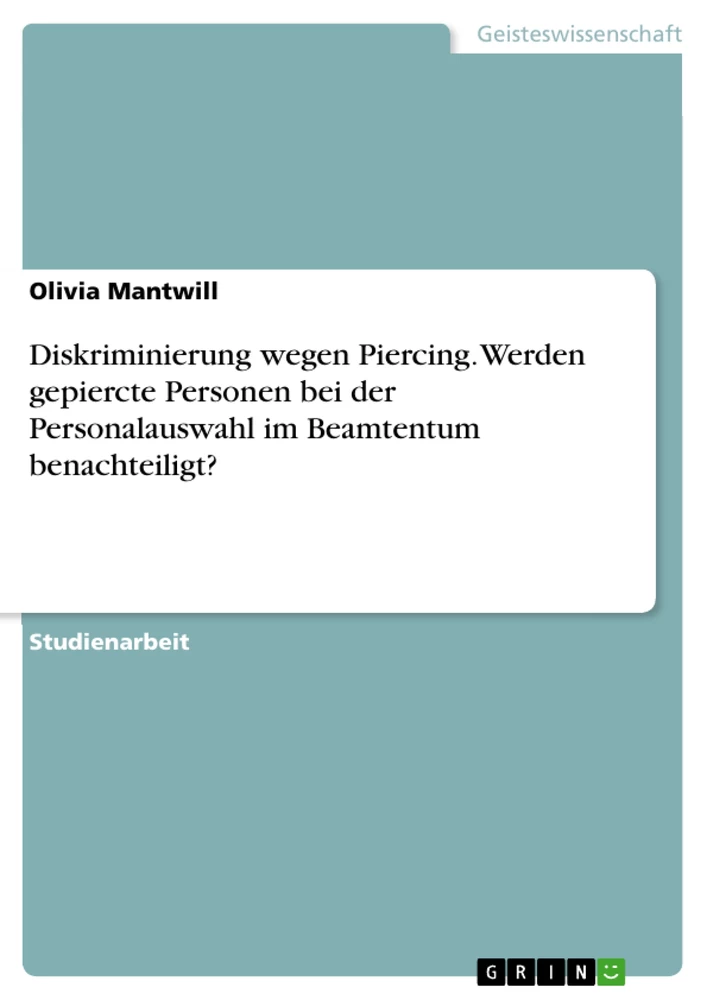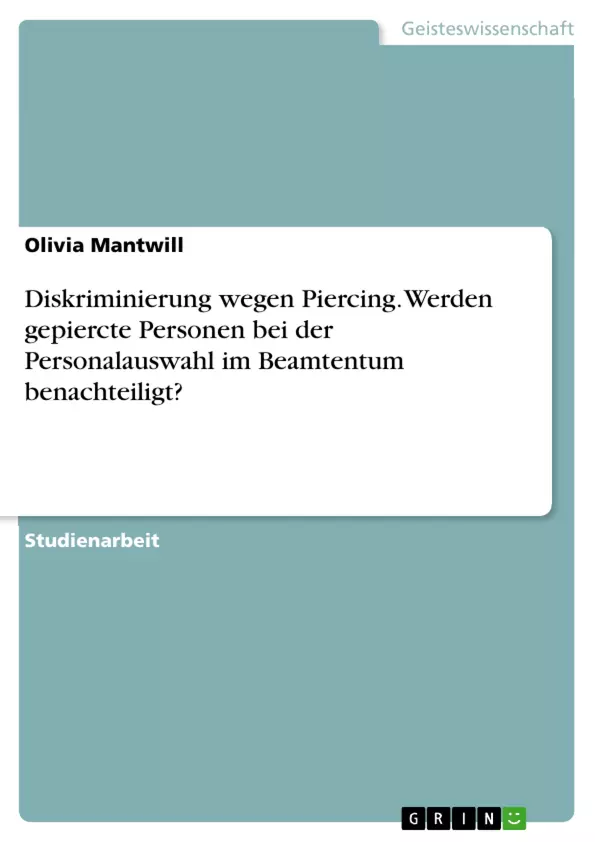Werden gepiercte Personen in der Personalauswahl für Beamtenstellen benachteiligt? Wenn ja, geschieht dies aus rationalen oder irrationalen Gründen? Diese Arbeit untersucht die These, ob gepiercte Bewerber im Beamtentum absichtlich seltener zu Vorstellungsgesprächen eingeladen werden als ungepiercte und wenn ja, auf welcher Art von Diskriminierung dies beruht.
Dieses Thema hat eine höhere gesellschaftliche Relevanz als eine wissenschaftliche, da Piercings in der modernen deutschen und europäischen Gesellschaft mittlerweile akzeptiert werden und häufig nur noch aus gesundheitlichen Gründen bei der Jobsuche ein Problem darstellen, etwa in der Gastronomie. Im Beamtentum ist jedoch auffällig, dass dort selten jemand arbeitet, der gepierct ist. Werden gepiercte Personen absichtlich in der Personalauswahl nicht berücksichtigt?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung: Relevanz und Fragestellung
- 2 Theorie und Hypothesen H1 und H2
- 3 Hypothese H3
- 4 Methode und Auswertung zu H1 und H2
- 5 Methode und Auswertung zu H3
- 6 Fazit
- 7 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, ob offensichtlich gepiercte Personen bei der Personalauswahl im Beamtentum benachteiligt werden. Ziel ist es, ein Forschungsdesign zu entwickeln, das diese Hypothese überprüfen kann. Dazu werden Theorien der Diskriminierung herangezogen und Hypothesen formuliert.
- Diskriminierung von gepiercten Personen im Beamtentum
- Theorien der ökonomischen Diskriminierung (statistische und unmittelbare Diskriminierung)
- Zusammenhang zwischen Piercings, Stereotypen und Arbeitgeberpräferenzen
- Entwicklung eines Forschungsdesigns zur Überprüfung der Hypothesen
- Analyse von Informationsdefiziten bei Personalauswahlprozessen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Relevanz und Fragestellung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Diskriminierung offensichtlich gepiercter Personen bei der Bewerbung um Beamtepositionen. Sie betont die gesellschaftliche Relevanz des Themas im Kontext der zunehmenden Akzeptanz von Piercings und der dennoch auffälligen Unterrepräsentation gepiercter Personen im Beamtentum. Die Arbeit skizziert den Forschungsansatz: Entwicklung einer Theorie, Ableitung von Hypothesen, Entwicklung einer geeigneten Methode und Auswertung, um letztendlich ein Forschungsdesign zu erstellen, welches die Überprüfung der aufgestellten Hypothesen ermöglicht. Der Fokus liegt auf der Untersuchung, ob gepiercte Bewerber seltener zu Vorstellungsgesprächen eingeladen werden und welche Form der Diskriminierung dem zugrunde liegen könnte.
2 Theorie und Hypothesen H1 und H2: Dieses Kapitel entwickelt eine Theorie zur Diskriminierung gepiercter Bewerber im Beamtentum. Es stützt sich auf die Theorie der wortwörtlich unmittelbaren Diskriminierung und die statistische Diskriminierung als Teilbereich der ökonomischen Diskriminierung. Die statistische Diskriminierung wird als Ursprung der Stereotypisierung verstanden: ältere Personalarbeiter assoziieren Piercings möglicherweise mit niedrigeren Gesellschaftsschichten und bestimmten Subkulturen, was zu Vorurteilen und der Annahme von potentiellen Problemen im Team führen kann. Dies resultiert in der Hypothese H1: Offensichtlich gepiercte Bewerber werden bei der Bewerbung im Beamtentum häufiger abgelehnt. Hypothese H2 postuliert, dass dieses Informationsdefizit durch entsprechende Nachweise (z.B. Arbeitszeugnisse) behoben werden kann, wodurch gepiercte und ungepiercte Bewerber gleich behandelt werden sollten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Diskriminierung von gepiercten Personen im Beamtentum
Was ist das zentrale Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht, ob offensichtlich gepiercte Personen bei der Personalauswahl im Beamtentum benachteiligt werden. Sie konzentriert sich auf die Entwicklung eines Forschungsdesigns zur Überprüfung dieser Hypothese.
Welche Theorien werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Theorien der ökonomischen Diskriminierung, insbesondere die unmittelbare und die statistische Diskriminierung. Statistische Diskriminierung wird als Ursprung von Stereotypen verstanden, die mit Piercings assoziiert werden.
Welche Hypothesen werden aufgestellt?
Hypothese H1 besagt, dass offensichtlich gepiercte Bewerber im Beamtentum häufiger abgelehnt werden. Hypothese H2 postuliert, dass dieses Informationsdefizit durch entsprechende Nachweise (z.B. Arbeitszeugnisse) behoben werden kann, wodurch gepiercte und ungepiercte Bewerber gleich behandelt werden sollten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Theorie und Hypothesenbildung (H1 und H2), ein Kapitel zu Hypothese H3, Kapitel zur Methodik und Auswertung (für H1 und H2 sowie H3), ein Fazit und ein Literaturverzeichnis. Die Einleitung definiert die Forschungsfrage und den Ansatz. Die folgenden Kapitel entwickeln die Theorie, formulieren Hypothesen und beschreiben die Methoden zur Überprüfung der Hypothesen.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit beschreibt die Entwicklung eines Forschungsdesigns zur Überprüfung der aufgestellten Hypothesen, inklusive der Methodik und Auswertung. Die konkreten Methoden werden in den Kapiteln 4 und 5 detailliert dargestellt.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Begriffe sind: Diskriminierung, ökonomische Diskriminierung (statistische und unmittelbare Diskriminierung), Piercings, Stereotype, Arbeitgeberpräferenzen, Personalauswahl, Beamte, Informationsdefizite.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist die Entwicklung eines Forschungsdesigns, das die Hypothese der Diskriminierung von gepiercten Personen im Beamtentum überprüfen kann. Es geht darum, ein methodisch fundiertes Design zu erstellen, das die Untersuchung dieser Frage ermöglicht.
Was wird im Fazit zusammengefasst?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Untersuchung zusammen und bewertet die Gültigkeit der Hypothesen im Lichte der angewandten Methoden und der gewonnenen Daten. Es wird ein Ausblick auf weiterführende Forschungsfragen geben.
- Quote paper
- Olivia Mantwill (Author), 2017, Diskriminierung wegen Piercing. Werden gepiercte Personen bei der Personalauswahl im Beamtentum benachteiligt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/466036