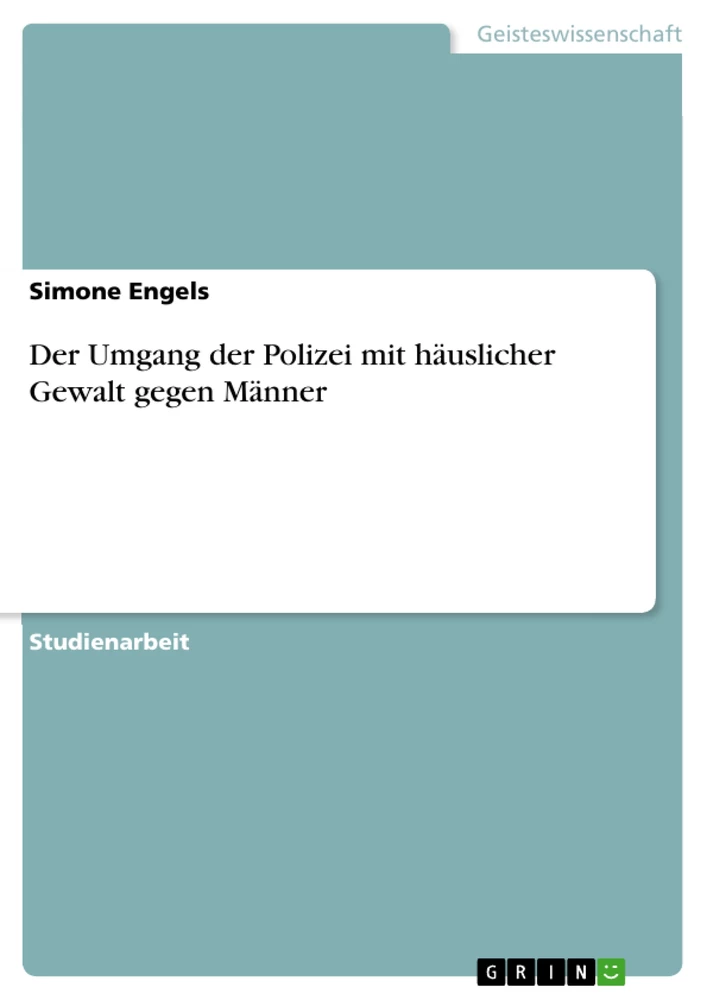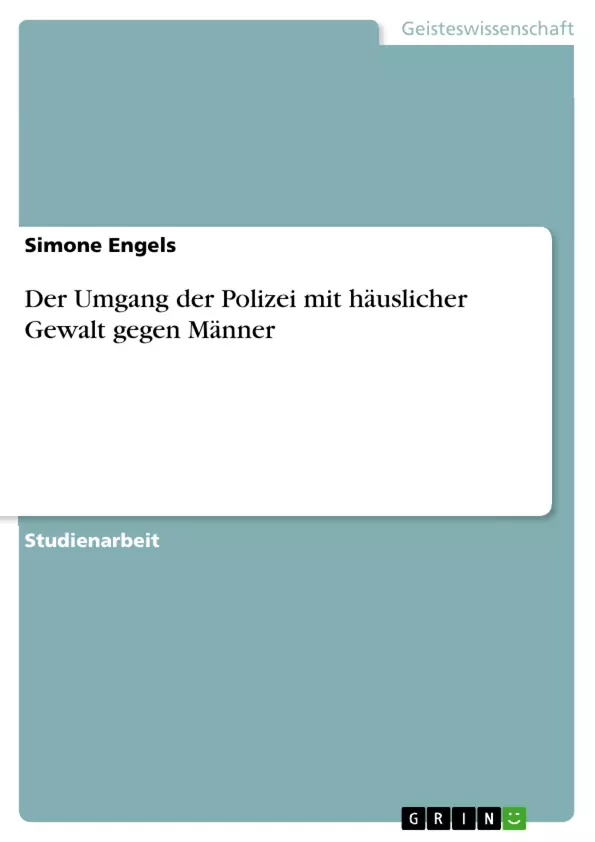Angesichts der Bedeutung des strukturellen Machtgefälles zwischen den Geschlechtern hat sich im Kontext häuslicher Gewalt eine generalisierte Zuschreibung von Opferschaft an Frauen und von Täterschaft an Männer manifestiert. Auch auf Fachtagungen, in Publikationen, den Massenmedien sowie in der Rechtsprechung findet häusliche Gewalt gegen Männer allenfalls als Fußnote oder Randbemerkung Beachtung. Die hierdurch transportierte Botschaft ist der Mythos häusliche Gewalt ist Männergewalt. Diese Arbeit thematisiert, inwiefern Polizeiangehörige entsprechend im Umgang mit häuslicher Gewalt gegen Männer geschult werden können.
Die Polizei hat, nicht zuletzt seit Inkrafttreten des sogenannten Gewaltschutzgesetzes, das Betätigungsfeld der Krisenintervention übernommen und sieht sich inzwischen selbst als eine Institution, die kontextual Erstintervention betreiben muss. Dabei werden solche Dienste stärker unter der Perspektive einer Parteilichkeit für die jeweils schwächere Partei und nicht unter der alleinigen Perspektive der Durchsetzung von Recht und Ordnung wahrgenommen. Häusliche Gewalt gegen Männer unterliegt jedoch nicht nur einem spezifischen situativ-motivationalen Kontext, sondern auch einem gesellschaftlichen, medialen sowie politischen Tabu und bedingt möglicherweise andere Orientierungsmuster als sie im Umgang mit häuslicher Gewalt gegen Frauen notwendig sind. Themenbezogen ist in diesem Zusammenhang aber fraglich, ob eine solche veränderte Perspektive unter den derzeitigen Problematisierungstendenzen von Polizeiangehörigen überhaupt erlernt und dadurch erwartet werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmung
- Wissenschaftliche Diskurse und Kontroversen
- Herausforderungen für gewalterfahrene Männer
- Die Polizei und häusliche Gewalt gegen Männer
- Das Gewaltschutzgesetz und seine (Aus-)Wirkung
- Gesellschaftspolitische Wahrnehmung und ihre (Aus-) Wirkung
- Ein Blick auf Männer als Opfer
- Ein Blick auf Frauen als Täterinnen
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Thema häusliche Gewalt gegen Männer aus einer theoretischen Perspektive. Sie beleuchtet die spezifischen Herausforderungen, die gewalterfahrene Männer im Umgang mit der Polizei und der Gesellschaft erleben. Die Arbeit analysiert, wie das Gewaltschutzgesetz und die gesellschaftliche Wahrnehmung auf Männer als Opfer von häuslicher Gewalt wirken.
- Der Fokus liegt auf der Auflösung des traditionellen Opfer-Täter-Schemas und der Berücksichtigung männlicher Opfererfahrungen.
- Die Arbeit beleuchtet die wissenschaftlichen Diskurse und Kontroversen im Bereich häuslicher Gewalt.
- Es werden die Herausforderungen für gewalterfahrene Männer im Umgang mit der Polizei und dem Gewaltschutzgesetz analysiert.
- Die Arbeit untersucht die gesellschaftliche Wahrnehmung von Männergewalt und deren Auswirkungen auf das Opferverhalten.
- Die Arbeit beleuchtet die unterschiedliche Behandlung von Männern und Frauen im Kontext von häuslicher Gewalt.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung beleuchtet die allgemeine Diskrepanz zwischen der gesellschaftlichen Wahrnehmung von häuslicher Gewalt und der Realität männlicher Opfererfahrungen.
- Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel behandelt die unterschiedlichen Definitionen von Gewalt und wie der Begriff "häusliche Gewalt" im Kontext dieser Arbeit verstanden wird.
- Wissenschaftliche Diskurse und Kontroversen: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über aktuelle wissenschaftliche Diskurse und Kontroversen im Bereich häuslicher Gewalt.
- Herausforderungen für gewalterfahrene Männer: Dieses Kapitel beleuchtet die spezifischen Herausforderungen und Folgen, die gewalterfahrene Männer aufgrund ihrer Erfahrungen erleben.
- Die Polizei und häusliche Gewalt gegen Männer: Dieses Kapitel analysiert die Rolle der Polizei im Umgang mit häuslicher Gewalt und die spezifischen Herausforderungen, die sich im Kontext männlicher Opfer ergeben.
Schlüsselwörter
Häusliche Gewalt, Männergewalt, Opfer, Täter, Gewaltschutzgesetz, Polizei, Geschlechterrollen, gesellschaftliche Wahrnehmung, wissenschaftliche Diskurse, Genderbias, Kontroversen, strukturelles Machtgefälle.
- Quote paper
- Simone Engels (Author), 2018, Der Umgang der Polizei mit häuslicher Gewalt gegen Männer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/468436