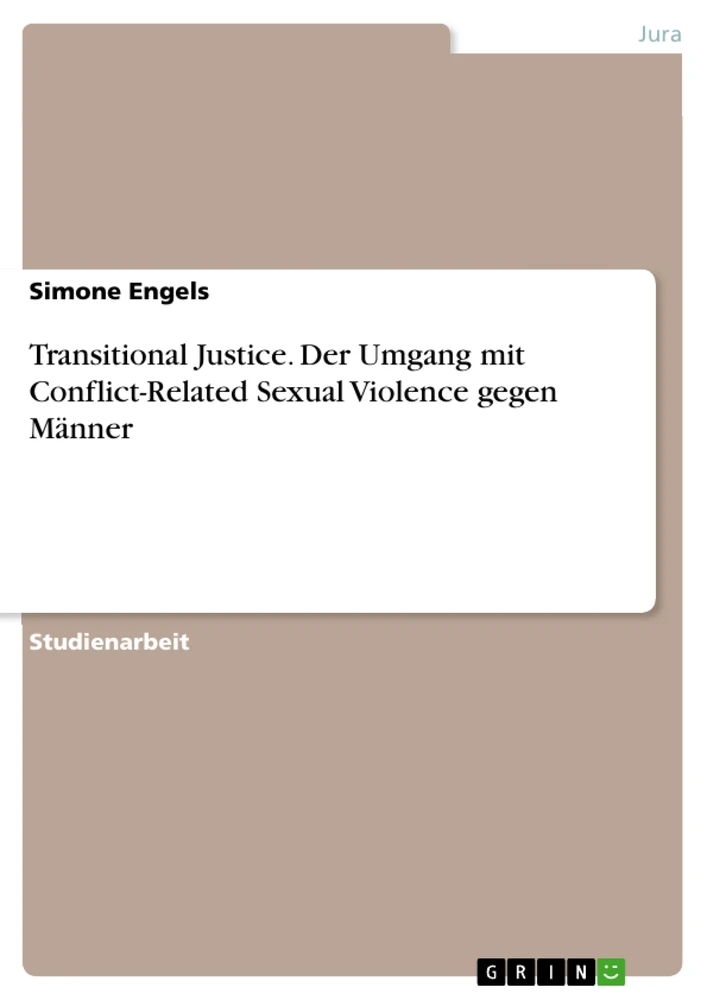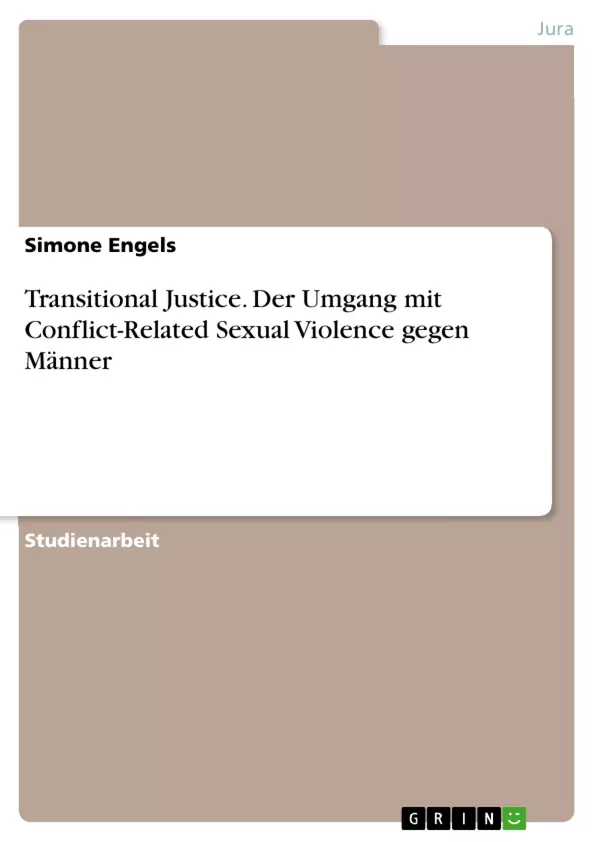Conflict-Related Sexual (and Gender-Based) Violence (CRS(GB)V) ist seit den 1990er Jahren Gegenstand der Forschung zu Transitional Justice (TJ). Maßgeblich dazu beigetragen haben Frauenrechtsorganisationen, insbesondere in den Post-Konfliktländern Südafrika, Ruanda und Ex-Jugoslawien. Die Verankerung ihrer Forderungen in TJ-Ansätze und Mechanismen ist dabei langwierig und wird - bis heute - von Ignoranz und Widerständen begleitet. Falls CRSGBV überhaupt beachtet wird, ist der Fokus auf Frauen als Opfer vorherrschend. Die vorliegende Arbeit wird über die Art und Weise der Thematisierung von und den Umgang mit CRS(GB)V gegen Männer in TJ-Prozessen, einen Einblick geben.
Möglicherweise mitunter der Tatsache, dass die mit CRS(GB)V gegen Männer häufig verbundene Vorstellung homophober Handlungen und Demütigungen zentrale kulturelle und religiöse Tabus bedienen. Obgleich ihr Geschlecht in einer patriarchalen Gesellschaft als eher privilegiert angesehen wird, wird gewalterfahrenen Männern häufig nicht nur die Anteilnahme an ihrem Schicksal verwehrt, sie werden zudem ihrem Schicksal überlassen und mitunter stigmatisiert.
Lenz begründet diesen Unterschied zwischen den Geschlechtern mit der hegemonial organisierten Gesellschaftskultur, welche auf Herrschaft und Kontrolle beruht. Mit diesem hegemonialen Konzept von Männlichkeit werden Verhaltensweisen der Unterwerfung, der Aneignung, des Sich-Erhebens assoziiert. Schwäche, Ohnmacht, Hilflosigkeit, also Gefühlszustände, die mit einem Opfersein verbunden werden, laufen hingegen konträr zu diesem hegemonialen Männerbild. In dieser Logik stellt der Begriff des männlichen Opfers ein gesellschaftliches Paradoxon dar: Entweder gilt jemand als Opfer oder er ist ein Mann.
Lag der Fokus in den 1990er Jahren zunächst auf der Suche nach Erklärungen für CRS(GB)V, richtet sich seit einigen Jahren das Forschungsinteresse auf Männer, Männlichkeiten sowie die Täterperspektive. Dabei wird immer wieder auch der vorsichtige Versuch unternommen, das dualistische Stereotyp von weiblichen Opfern und männlichen Tätern aufzubrechen, indem zögerlich, Männern ihre Opferschaft zugestanden wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- CRS(GB)V, TJ und Genderdimensionen
- Die zeitliche Kontingenz von TJ
- Genderdimensionen in TJ-Prozessen
- Forschungen zu CRSV gegen Männer (und Jungen)
- Die UN im Umgang mit und der Thematisierung von CRSV gegen Männer
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit setzt sich zum Ziel, die Thematisierung von und den Umgang mit Conflict-Related Sexual (and Gender-Based) Violence (CRS(GB)V) gegen Männer in Prozessen der Transitional Justice (TJ) zu beleuchten. Sie untersucht, wie dieses Thema in der Forschung und von den Vereinten Nationen (UN) behandelt wird, und analysiert die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Einbeziehung von männlichen Opfern von CRS(GB)V ergeben.
- Die Bedeutung der Genderdimension in TJ-Prozessen
- Die Herausforderungen der Thematisierung von CRSV gegen Männer in der Forschung und Praxis
- Der normative Umgang der UN mit CRS(GB)V gegen Männer
- Die Notwendigkeit eines umfassenden Verständnisses von TJ, das genderspezifische Perspektiven berücksichtigt
- Die Auswirkungen von CRS(GB)V auf Männer und die Notwendigkeit, ihnen Unterstützung und Schutz zukommen zu lassen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2.1. beleuchtet die zeitliche Kontingenz von TJ und zeigt auf, dass TJ als eine fixe Phase verstanden wird, die von einer gewalttätigen Vergangenheit in eine friedvolle, demokratische Zukunft führt. Das Kapitel argumentiert, dass eine genderspezifische Perspektive diese eindimensionale Sichtweise in Frage stellt und ein erweitertes Verständnis von TJ erfordert, das die Rolle von Normen und Machtstrukturen in TJ-Prozessen berücksichtigt.
Kapitel 2.2. analysiert den eindimensionalen Umgang mit CRS(GB)V in TJ-Prozessen. Es zeigt auf, dass die Genderdimension in TJ häufig auf die Perspektive von Frauen als Opfer reduziert wird, während Männer und ihre Erfahrungen mit CRS(GB)V oft ausgeklammert werden. Dieses Kapitel identifiziert drei wesentliche Schwierigkeiten dieser eindimensionalen Sichtweise und beleuchtet die Exklusion von CRSV gegen Männer als ein zentrales Problem.
Kapitel 3. gibt einen Einblick in die überschaubare Forschungslandschaft zu CRSV gegen Männer. Es untersucht, welche Faktoren dazu beitragen, dass dieses Thema in der Forschung nur begrenzt Beachtung findet und welche Folgen diese mangelnde Aufmerksamkeit für die gesellschaftliche Relevanz und normative Beachtung von CRSV gegen Männer hat.
Kapitel 4. befasst sich mit dem normativen Umgang der Vereinten Nationen (UN) mit CRS(GB)V gegen Männer. Es zeigt auf, dass trotz steigender Sensibilisierung für das Thema eine eindimensionale Themenbetrachtung auch hier zu beobachten ist. Das Kapitel untersucht die Bemühungen der UN, CRS(GB)V gegen Männer zu thematisieren und zu bekämpfen, und diskutiert die Herausforderungen, die sich aus der Integration einer genderspezifischen Perspektive in die Arbeit der UN ergeben.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen wie Transitional Justice, Conflict-Related Sexual (and Gender-Based) Violence, Gender, Männlichkeiten, Opferperspektive, Täterperspektive, Forschung, UN, normative Handlungsweisen und gesellschaftliche Relevanz.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Conflict-Related Sexual Violence" (CRSV)?
CRSV bezeichnet sexuelle Gewalt, die im Kontext von bewaffneten Konflikten ausgeübt wird, oft als Kriegswaffe zur Demütigung und Zerstörung von Gemeinschaften.
Warum werden männliche Opfer von CRSV oft ignoriert?
Hegemoniale Männlichkeitsbilder assoziieren Männer mit Stärke und Herrschaft. Das Bild des männlichen Opfers gilt gesellschaftlich oft als Paradoxon, was zu Tabus und Stigmatisierung führt.
Welche Rolle spielt Transitional Justice (TJ) in diesem Kontext?
Transitional Justice befasst sich mit der Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen nach Konflikten. Lange Zeit lag der Fokus dabei fast ausschließlich auf Frauen als Opfern sexueller Gewalt.
Wie geht die UN mit sexueller Gewalt gegen Männer um?
Obwohl die Sensibilisierung steigt, bleibt die Thematisierung bei der UN oft noch hinter der von Frauen zurück. Es gibt jedoch Bestrebungen, genderspezifische Perspektiven umfassender zu integrieren.
Was sind die Folgen von CRSV für betroffene Männer?
Neben physischen und psychischen Traumata leiden Männer oft unter dem Verlust ihrer sozialen Stellung und kulturellen Tabus, die eine Anteilnahme an ihrem Schicksal verhindern.
- Quote paper
- Simone Engels (Author), 2018, Transitional Justice. Der Umgang mit Conflict-Related Sexual Violence gegen Männer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/468437