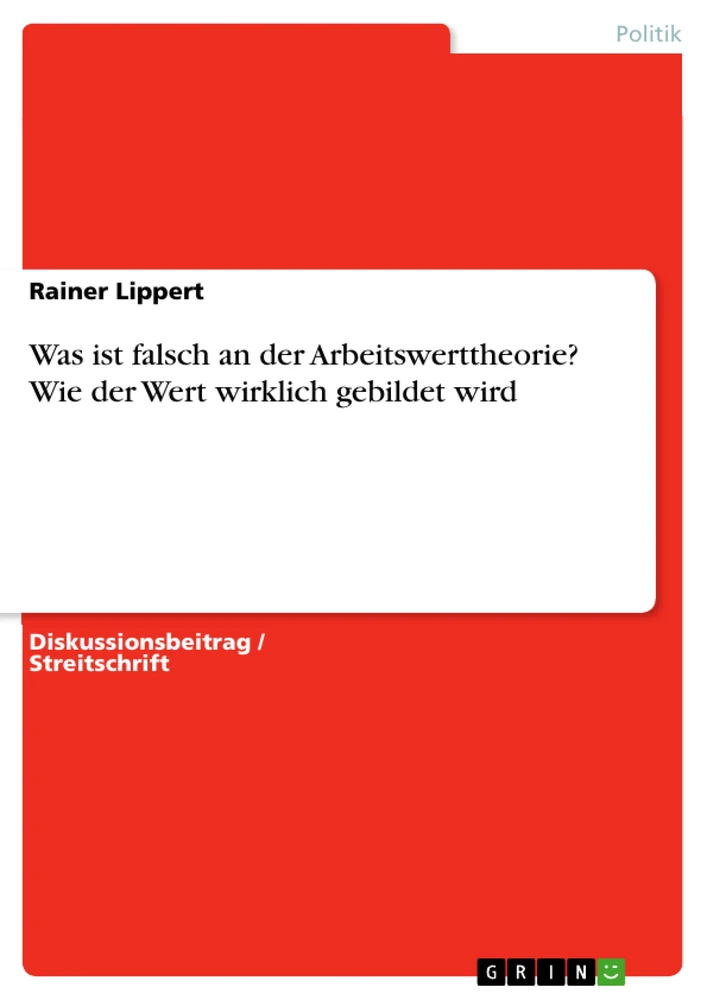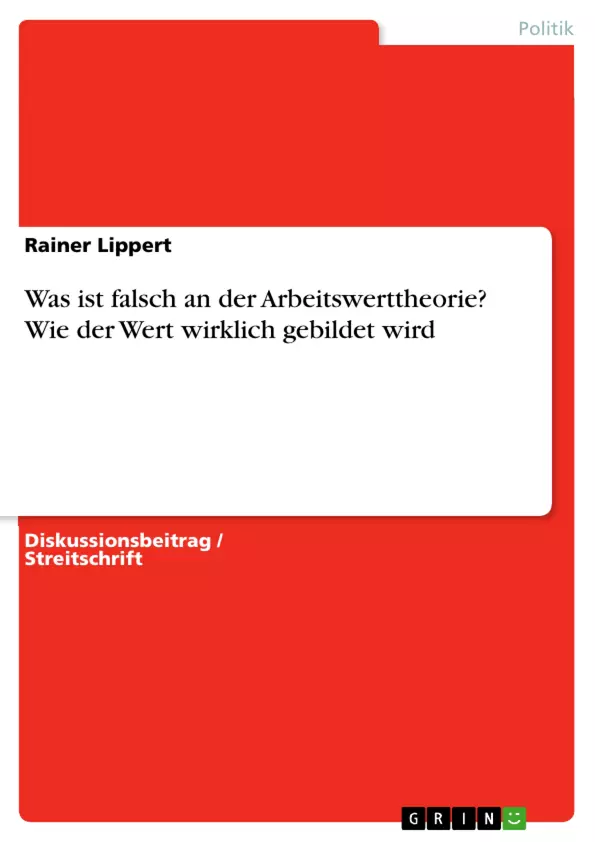Dieser Artikel soll in die Diskussion zur Marx'schen Arbeitswerttheorie und zur Werttheorie insgesamt neue Gedanken einbringen. Der Autor macht deutlich, dass die klassische Interpretation der Marx'schen Werttheorie fehlerbehaftet ist, weil damit ein ideeller Wertbegriff beschrieben wird.
Der Autor zeigt einen Weg, den Wert als wirkliches gesellschaftliches Verhältnis zu erfassen. Dabei wird deutlich gemacht, dass der Wert nicht nur auf Produkte menschlicher Arbeit bezogen werden kann. Der so gewonnene Wertbegriff kann für sämtliche dem Tausch unterliegenden Güter und Aktivitäten genutzt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkungen
- Kosten, Mehrwert und Wert
- Die unbezahlte Arbeitszeit kann nicht als Produktionsfaktor festgelegt werden
- Erwartungswert und Angebotspreis
- Erwartungswert
- Bezugspunkte für Wertbeziehungen
- Markt
- Der Wert wird auf dem Markt gebildet
- Die Triebkräfte für die Wertbildung
- Das gesellschaftliche Verhältnis Wert: Merkmale
- Die Bestandteile des Wertes
- Wert wird auf der gesellschaftlichen Ebene mittels Wertverhältnis den Waren und den Wertäquivalenten zugeordnet
- Die gesellschaftlichen Verhältnisse Wert und Eigentum
- Voraussetzungen für Wertbeziehungen
- Der Wert und seine Bezugspunkte - wie werden die Bezugspunkte gebildet
- Gegenüberstellung menschlicher und maschineller Arbeitskräfte sowie der Arbeitskraft Natur
- Wie Bezugspunkte von Wertbeziehungen in die Gesellschaft eingebunden werden
- Menschliche und maschinelle Arbeitskräfte und die Arbeitskraft Natur
- Der ökonomische Tausch
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text untersucht die Arbeitswerttheorie und stellt alternative Konzepte zur Wertbildung vor.
- Kritik der klassischen Arbeitswerttheorie
- Die Rolle des Erwartungswerts bei der Wertbildung
- Das gesellschaftliche Verhältnis von Wert und Eigentum
- Die Bedeutung des Marktes für die Wertbildung
- Die Interaktion von menschlicher, maschineller und natürlicher Arbeitskraft
Zusammenfassung der Kapitel
- Das Kapitel "Vorbemerkungen" stellt den Kontext des Textes dar und erklärt die Grundprinzipien der Wertbildung.
- Das Kapitel "Kosten, Mehrwert und Wert" analysiert die klassische Arbeitswerttheorie und ihre Schwächen.
- Im Kapitel "Die unbezahlte Arbeitszeit kann nicht als Produktionsfaktor festgelegt werden" wird argumentiert, dass die unbezahlte Arbeitszeit nicht als Produktionsfaktor betrachtet werden kann.
- Das Kapitel "Erwartungswert und Angebotspreis" führt den Begriff des Erwartungswerts ein und erklärt seine Bedeutung für die Preisbildung.
- Das Kapitel "Erwartungswert" vertieft die Analyse des Erwartungswerts und seiner Auswirkungen auf die Wertbildung.
- Die Kapitel "Bezugspunkte für Wertbeziehungen", "Der Wert wird auf dem Markt gebildet", und "Die Triebkräfte für die Wertbildung" untersuchen die Rolle des Marktes bei der Wertbildung.
- Das Kapitel "Das gesellschaftliche Verhältnis Wert: Merkmale" analysiert die Merkmale des gesellschaftlichen Wertverhältnisses.
- Das Kapitel "Die Bestandteile des Wertes" beschreibt die verschiedenen Bestandteile des Wertes.
- Das Kapitel "Wert wird auf der gesellschaftlichen Ebene mittels Wertverhältnis den Waren und den Wertäquivalenten zugeordnet" erklärt, wie der Wert auf gesellschaftlicher Ebene zugeordnet wird.
- Die Kapitel "Die gesellschaftlichen Verhältnisse Wert und Eigentum" und "Voraussetzungen für Wertbeziehungen" untersuchen die Beziehung zwischen Wert und Eigentum.
- Das Kapitel "Der Wert und seine Bezugspunkte - wie werden die Bezugspunkte gebildet" analysiert, wie die Bezugspunkte für Wertbeziehungen gebildet werden.
- Das Kapitel "Gegenüberstellung menschlicher und maschineller Arbeitskräfte sowie der Arbeitskraft Natur" untersucht die Interaktion verschiedener Arten von Arbeitskraft.
- Das Kapitel "Wie Bezugspunkte von Wertbeziehungen in die Gesellschaft eingebunden werden" erklärt, wie die Bezugspunkte für Wertbeziehungen in die Gesellschaft integriert werden.
- Das Kapitel "Menschliche und maschinelle Arbeitskräfte und die Arbeitskraft Natur" vertieft die Analyse der Interaktion verschiedener Arten von Arbeitskraft.
- Das Kapitel "Der ökonomische Tausch" beschreibt den ökonomischen Tauschprozess.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Arbeitswerttheorie, Wertbildung, Erwartungswert, Markt, gesellschaftliches Verhältnis, Eigentum, Bezugspunkte, menschliche Arbeitskraft, maschinelle Arbeitskraft, Arbeitskraft Natur, ökonomischer Tausch.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale Kritik an der Marx'schen Arbeitswerttheorie?
Der Autor argumentiert, dass die klassische Interpretation auf einem ideellen Wertbegriff basiert und den Wert nicht ausreichend als reales gesellschaftliches Verhältnis erfasst.
Wie wird der Wert laut diesem Text wirklich gebildet?
Der Wert bildet sich auf dem Markt durch gesellschaftliche Beziehungen und Austauschprozesse, nicht allein durch die aufgewendete Arbeitszeit.
Welche Rolle spielt der „Erwartungswert“?
Der Erwartungswert ist ein entscheidender Faktor für die Preisbildung und beeinflusst, wie Anbieter und Nachfrager den Wert eines Gutes im Tauschprozess einschätzen.
Können auch nicht-menschliche Faktoren Werte schaffen?
Ja, der Text stellt menschliche Arbeit, maschinelle Arbeitskraft und die „Arbeitskraft Natur“ gegenüber, um zu zeigen, dass Wertbeziehungen über rein menschliche Produkte hinausgehen.
Wie hängen Wert und Eigentum zusammen?
Wertbeziehungen setzen bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse und Eigentumsstrukturen voraus, die den ökonomischen Tausch erst ermöglichen.
- Quote paper
- Rainer Lippert (Author), 2019, Was ist falsch an der Arbeitswerttheorie? Wie der Wert wirklich gebildet wird, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/469059