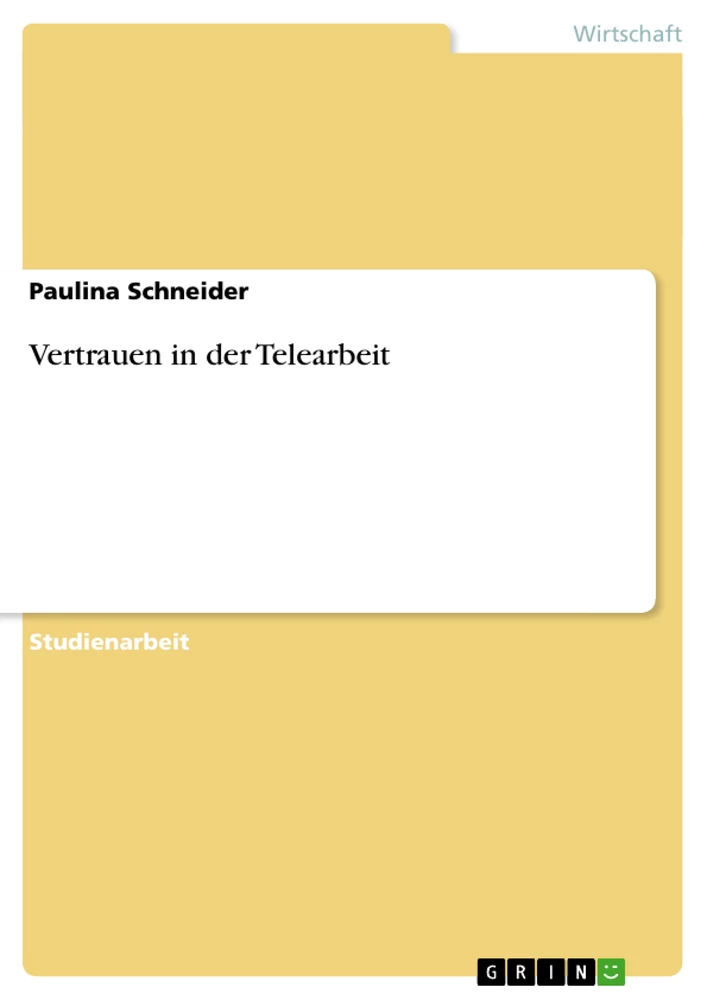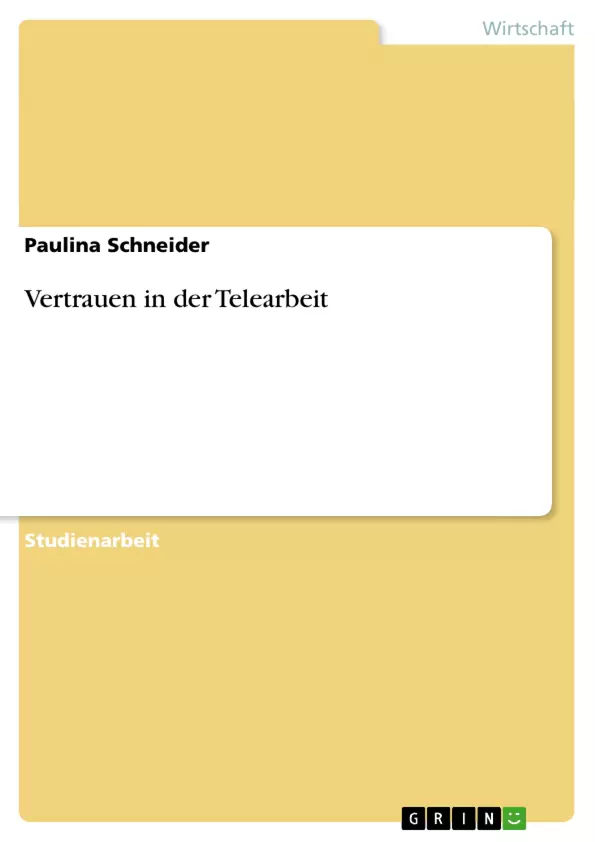Im Zeitalter der Globalisierung müssen sich Unternehmen, Manager und Mitarbeiter neuen Herausforderungen stellen. Mit der Globalisierung stehen nicht nur Unternehmenskonzepte auf dem Prüfstand, es müssen sich auch die traditionellen Arbeitsformen einem Wandel unterziehen. Gerade Form und Ablauf von Arbeitsprozessen unterliegen ständiger Kontrolle und Verbesserung. Als bisher beispielloses Konzept innerhalb der Arbeitsorganisation hat sich die Telearbeit entwickelt. Mit dem Konzept der Telearbeit sollen Arbeitstätigkeiten im Bereich von Computer- und Dienstleistungsarbeitsplätzen außerhalb der Unternehmung durchgeführt werden.
Anlass zur Idee der Telearbeit gab die Einsicht, dass es meist kostengünstiger ist, die Information mittels geeigneter technologischer Infrastruktur zwischen Mitarbeiter und der Organisation auszutauschen, als dass der Arbeitnehmer ständig zwischen Wohn- und Arbeitsstätte hin und her pendelt. „Mit Hilfe der Telearbeit wird der Mensch nicht mehr zu seiner Tätigkeit transportiert, sondern die Arbeit zum Menschen.“ Dies stellt für Telearbeiter und Unternehmung gleichermaßen Chancen dar. Es wird dem Telearbeiter beispielsweise in der alternierenden Telearbeit ermöglicht, sich seinen Arbeitsplatz zu Hause einzurichten. Dadurch kann er Beruf und Familie besser in Einklang bringen. Dieses Konzept stellt weiterhin die Kostenvorteile in Aussicht, die entstehen, indem der Telearbeiter Pendel- und Zeitkosten einspart. Die Unternehmung wiederum kann Kosten in den Bereichen von Büro- bzw. Mietkosten sparen.
Dieses Konzept der Arbeitsorganisation lässt Kostenvorteile erwarten und ist daher unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu befürworten. Dennoch birgt das Konzept der Telearbeit ein grundlegendes Problem. Wie sollen Arbeitsabläufe, die ehemals in der Unternehmung unter Kontrolle und Koordination durchgeführt wurden, künftig eigenständig vom Telearbeiter erbracht werden?
Da der Telearbeiter nicht mehr in den Betriebsstätten arbeitet, kann er auch nicht mehr von dem Vorgesetzten beim Arbeitsprozess beobachtet werden. Dies wird gerade von vielen Vorgesetzten als negativ empfunden, die noch alte Führungsmuster verfolgen, welche auf beobachtbarem Kontrollieren beruhen.
Da der Telearbeiter Arbeitsabläufe meist jedoch selbständig gestaltet soll, ist diese Form der Kontrolle nicht mehr durchzuführen. In diesem Zusammenhang rückt der Begriff Vertrauen immer mehr in den Mittelpunkt der Betrachtung.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- 1 VERTRAUEN
- 1.1 Wert des Vertrauens für die menschliche Gesellschaft
- 1.2 Vertrauen in sozialen Systemen
- 1.3 Vertrauen in zwischenmenschlichen Beziehungen
- 1.4 Vertrauensbeziehungen in (Klein-)Gruppen
- 1.5 Vertrauen zur Erlangung von komparativen Wettbewerbsvorteilen
- 1.6 Vertrauen zur Motivation, Führung und Zeilerreichung von Organisationen
- 1.7 Vertrauensspezifische Konzeption / Konfiguration / Implementierung elektronischer Netzwerke
- 2 TELEARBEIT
- 2.1 Zum Begriff der Telearbeit
- 2.2 Formen der Telearbeit
- 2.2.1 Isolierte Alternierende Telearbeit
- 2.2.2 Satellitenbüro
- 2.2.3 Nachbarschaftsbüro
- 2.2.4 Mobile Telearbeit
- 2.2.5 Mischformen der Telearbeit
- 3 DIE DETERMINANTE VERTRAUEN IN DER TELEARBEIT
- 3.1 Funktionen des Vertrauens
- 3.1.1 Reduktion der Handlungskomplexität
- 3.1.2 Kommunikations- und Kooperationswirkungen
- 3.1.2.1 Vertrauen und Kommunikation
- 3.1.2.2 Vertrauen und Kooperation
- 3.2 Akzeptanz der Telearbeit
- 3.2.1 Akzeptanz der Telearbeit aus der Sicht des Telearbeiters
- 3.2.2 Akzeptanz der Telearbeit aus der Sicht des Unternehmens
- 3.2.3 Akzeptanz der Telearbeit aus der Sicht der Mitarbeiter
- 3.3 Vertrauen als Management-Aufgabe in Organisationen
- 3.4 Vertrauen und interkulturelles Management im Blickwinkel der Telearbeit
- 3.5 Kontrolle, Vertrauen und Produktivität im Führungsprozess der Telearbeit
- 3.5.1 Rational-Choice-Theorie
- 3.5.2 Kontrolle
- 3.5.3 Vertrauen
- 3.5.4 Vertrauen und Produktivität
- FAZIT
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Bedeutung des Vertrauens im Kontext der Telearbeit. Sie untersucht, wie Vertrauen die Telearbeit determiniert und an die Stelle von Kontrolle tritt. Dabei werden die Funktionsweise des Vertrauens sowie die Akzeptanz der Telearbeit aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Rolle des Vertrauens im Managementprozess von Telearbeit, insbesondere im Hinblick auf interkulturelle Aspekte und die Verbindung von Vertrauen und Produktivität.
- Die Rolle des Vertrauens in der Telearbeit
- Die Akzeptanz von Telearbeit durch Telearbeiter, Unternehmen und Mitarbeiter
- Vertrauen als Management-Aufgabe in Organisationen
- Interkulturelle Aspekte des Vertrauens in der Telearbeit
- Die Beziehung zwischen Vertrauen, Kontrolle und Produktivität
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Telearbeit und die Bedeutung des Vertrauens im Kontext der modernen Arbeitswelt vor. Das erste Kapitel erläutert den Begriff des Vertrauens und untersucht seine unterschiedlichen Dimensionen in verschiedenen sozialen Kontexten. Das zweite Kapitel definiert Telearbeit und analysiert die verschiedenen Formen der Telearbeit, die sich in der Praxis etabliert haben.
Das dritte Kapitel widmet sich der Rolle des Vertrauens als Determinante der Telearbeit. Es analysiert die Funktionen des Vertrauens in der Telearbeit, insbesondere die Reduktion der Handlungskomplexität und die Förderung von Kommunikation und Kooperation. Der dritte Teil des Kapitels befasst sich mit der Akzeptanz von Telearbeit durch Telearbeiter, Unternehmen und Mitarbeiter. Abschließend werden die Bedeutung des Vertrauens im Managementprozess, die interkulturellen Herausforderungen der Telearbeit und die Beziehung zwischen Vertrauen, Kontrolle und Produktivität beleuchtet.
Schlüsselwörter
Telearbeit, Vertrauen, Kontrolle, Produktivität, Akzeptanz, Management, Interkulturelles Management, Kommunikation, Kooperation, Rational-Choice-Theorie, Globalisierung.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Vertrauen bei Telearbeit wichtiger als Kontrolle?
Da der Vorgesetzte den Arbeitsprozess zu Hause nicht direkt beobachten kann, ersetzt Vertrauen die physische Kontrolle als Basis für eine produktive Zusammenarbeit.
Welche Formen der Telearbeit gibt es?
Dazu zählen alternierende Telearbeit (Mix aus Homeoffice und Büro), mobile Telearbeit, Satellitenbüros und Nachbarschaftsbüros.
Welche Vorteile bietet Telearbeit für Unternehmen?
Unternehmen können Kosten für Büroflächen und Mieten einsparen und durch flexiblere Arbeitsmodelle die Attraktivität als Arbeitgeber steigern.
Wie wirkt sich Vertrauen auf die Produktivität aus?
Vertrauen reduziert die Komplexität, fördert die Eigenverantwortung und verbessert die Kommunikation, was langfristig zu einer höheren Arbeitseffizienz führt.
Was ist die Rational-Choice-Theorie im Kontext von Telearbeit?
Sie analysiert, wie Mitarbeiter und Manager rationale Entscheidungen treffen, um den Nutzen (z.B. Zeitersparnis) gegen Risiken (z.B. mangelnde Sichtbarkeit) abzuwägen.
- Citation du texte
- Paulina Schneider (Auteur), 2003, Vertrauen in der Telearbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46918