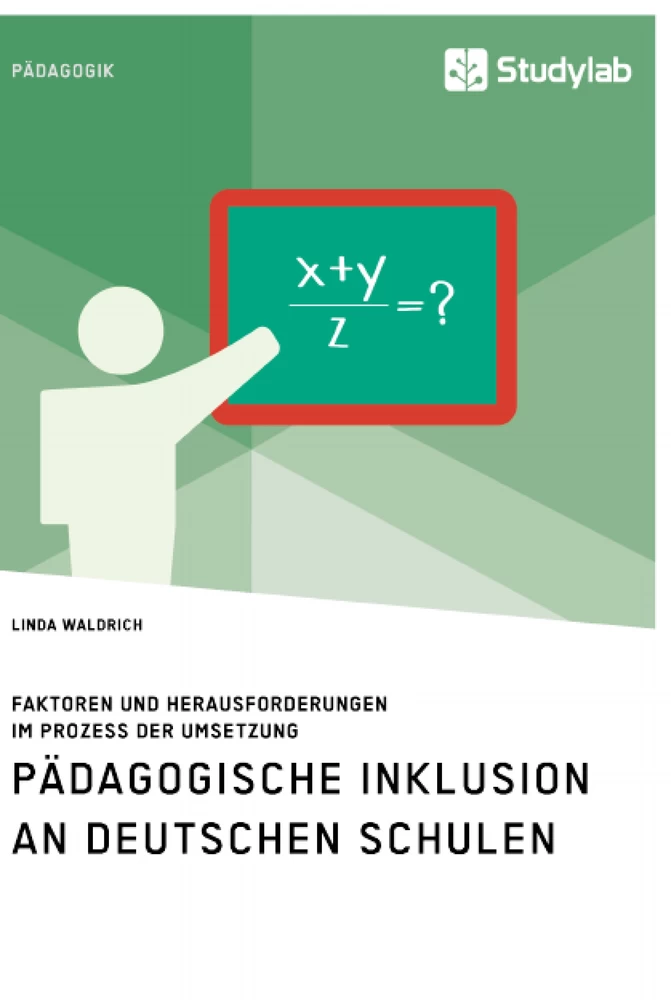In den letzten Jahren hat Deutschland wichtige Schritte in Richtung Inklusion gemacht. Vor allem in bildungspolitischen Debatten spielt die Inklusion auch weiterhin eine zentrale Rolle. Denn sie erfordert eine grundlegende Umstrukturierung des Schulsystems.
Wie weit ist die Inklusion an deutschen Schulen bereits fortgeschritten? Welche Herausforderungen stehen noch bevor? Linda Waldrich betrachtet den gesamten Prozess der Umsetzung und identifiziert Faktoren, die diesen beeinflussen.
Sie setzt sich dabei vor allem mit den Problemen auseinander, die bei der Umsetzung von Inklusion aufkommen. Außerdem beschäftigt sie sich kritisch mit den Auswirkungen und Herausforderungen von Inklusion. Ihre Untersuchung liefert so eine wichtige Grundlage für Lösungsansätze.
Aus dem Inhalt:
- Bildungssystem;
- Schule;
- Integration;
- Gleichberechtigung;
- Diskriminierung
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Grundlagen:
- 2.1 Der Begriff Inklusion
- 2.2 Historische Entwicklung im Umgang von Menschen mit Behinderung
- 3 Inklusion
- 3.1 Die Salamanca Erklärung
- 3.2 Die Rolle der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen für die Betrachtung von Inklusion in Schulen
- 4 Umsetzung pädagogischer Inklusion in Deutschland auf bildungspolitischer Ebene
- 4.1 Datenauswertung: Stand der Umsetzung von Inklusion in Deutschland
- 4.2 Herausforderungen
- 5 Umsetzung auf Ebene der Institution Schule – Aspekte qualitativer pädagogischer Inklusion
- 5.1 Inklusive Schulstruktur: Schulkonzept und Schulleitung
- 5.2 Differenzierter Unterricht
- 5.3 Pädagogische Inklusion und die Problematik der Sekundarstufe
- 5.4 Die Rolle der Lehrkräfte bei der Umsetzung pädagogischer Inklusion
- 5.5 Kooperationen
- 5.6 Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Stand der Umsetzung pädagogischer Inklusion an deutschen Schulen und arbeitet bestehende Herausforderungen kritisch heraus. Der Fokus liegt auf der Inklusion von Menschen mit Behinderungen, wobei der gesamte Umsetzungsprozess von der UN-Behindertenrechtskonvention bis zur schulischen Praxis betrachtet wird.
- Definition des Inklusionsbegriffs und Abgrenzung zur Integration
- Historische Entwicklung des Umgangs mit Menschen mit Behinderung
- Analyse des Stands der Inklusion in Deutschland anhand quantitativer Daten
- Herausforderungen auf bildungspolitischer und schulischer Ebene
- Rolle der Lehrkräfte und Notwendigkeit von Aus- und Weiterbildung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema pädagogische Inklusion ein, beschreibt die Heterogenität der heutigen Gesellschaft und die Notwendigkeit von Inklusion als Menschenrecht, insbesondere im Bildungssystem. Sie beleuchtet die kontroverse Diskussion um die Umsetzung von Inklusion in Schulen und betont die Notwendigkeit, den gesamten Umsetzungsprozess von der bildungspolitischen Ebene bis zur Praxis zu betrachten. Der Fokus der Arbeit liegt auf der Inklusion von Menschen mit Behinderungen und skizziert den Aufbau der Arbeit.
2 Theoretische Grundlagen:: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Arbeit fest. Es definiert den Inklusionsbegriff, grenzt ihn von der Integration ab und beschreibt die historische Entwicklung im Umgang mit Menschen mit Behinderung, beginnend mit der Exklusion in der Antike, über die Separation im Sonderschulwesen bis hin zu den Ansätzen der Integration und schließlich der Inklusion. Die verschiedenen Phasen werden im historischen Kontext erläutert und ihre Überschneidungen verdeutlicht.
3 Inklusion: Dieses Kapitel beleuchtet die Phase der Inklusion. Es beschreibt die Bedeutung der Salamanca Erklärung (1994), die den Inklusionsbegriff erstmals in den Fokus der Bildung rückte, und detailliert die UN-Behindertenrechtskonvention (2006) als zentralen Rechtsrahmen für die Umsetzung von Inklusion. Die Entstehung, der Inhalt, sowie die Überwachungsmechanismen der UN-BRK werden erläutert, mit besonderem Fokus auf Artikel 24, der sich mit dem Recht auf Bildung befasst. Die Problematik der deutschen Übersetzung der Konvention wird kritisch diskutiert.
4 Umsetzung pädagogischer Inklusion in Deutschland auf bildungspolitischer Ebene: Dieses Kapitel analysiert den Stand der Umsetzung von Inklusion in Deutschland auf bildungspolitischer Ebene. Es präsentiert und bewertet quantitative Daten zu Inklusions- und Exklusionsquoten, Förderquoten und deren Entwicklung. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern werden deutlich gemacht, und die Herausforderungen im Hinblick auf die Senkung der Exklusionsquote, die Schaffung einer bundesweiten Einheitlichkeit und die Umsetzung von Inklusion in allen Bildungsstufen werden beleuchtet. Der Kostenfaktor Inklusion wird ebenfalls diskutiert und relativiert.
5 Umsetzung auf Ebene der Institution Schule – Aspekte qualitativer pädagogischer Inklusion: Dieses Kapitel beleuchtet die Umsetzung von Inklusion auf Schulebene. Es betrachtet die Anforderungen an inklusive Schulstrukturen, Schulkonzepte und die Schulleitung. Differenzierter Unterricht als zentrale Anforderung an inklusive Schulen wird beschrieben und die spezifischen Herausforderungen der Sekundarstufe mit ihren leistungsorientierten Strukturen, der Entwicklungspsychologie Jugendlicher und der Rolle der Fachlehrer werden erläutert. Die zentrale Rolle der Lehrkräfte bei der Umsetzung von Inklusion wird detailliert analysiert, inklusive der Herausforderungen, ihrer Einstellungen und der Bedeutung von Aus- und Weiterbildung.
Schlüsselwörter
Pädagogische Inklusion, UN-Behindertenrechtskonvention, Salamanca Erklärung, Integration, Exklusion, Separation, inklusive Bildung, Sonderschulwesen, Regelschule, Differenzierter Unterricht, Lehrkräfte, Aus- und Weiterbildung, Bundesländer, Exklusionsquote, Inklusionsquote, Förderquote, Heterogenität, Schulpolitik, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Pädagogische Inklusion in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Stand der Umsetzung pädagogischer Inklusion an deutschen Schulen und analysiert kritisch die bestehenden Herausforderungen. Der Fokus liegt auf der Inklusion von Menschen mit Behinderungen, wobei der gesamte Prozess von der UN-Behindertenrechtskonvention bis zur schulischen Praxis betrachtet wird.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition des Inklusionsbegriffs und Abgrenzung zur Integration; die historische Entwicklung des Umgangs mit Menschen mit Behinderung; Analyse des Stands der Inklusion in Deutschland anhand quantitativer Daten; Herausforderungen auf bildungspolitischer und schulischer Ebene; die Rolle der Lehrkräfte und die Notwendigkeit von Aus- und Weiterbildung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung; Theoretische Grundlagen (Der Begriff Inklusion, Historische Entwicklung im Umgang von Menschen mit Behinderung); Inklusion (Die Salamanca Erklärung, Die Rolle der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen); Umsetzung pädagogischer Inklusion in Deutschland auf bildungspolitischer Ebene (Datenauswertung, Herausforderungen); Umsetzung auf Ebene der Institution Schule – Aspekte qualitativer pädagogischer Inklusion (Inklusive Schulstruktur, Differenzierter Unterricht, Problematik der Sekundarstufe, Rolle der Lehrkräfte, Kooperationen, Aus- und Weiterbildung); Fazit.
Wie wird der Inklusionsbegriff definiert und von der Integration abgegrenzt?
Das Kapitel "Theoretische Grundlagen" definiert den Inklusionsbegriff und grenzt ihn von der Integration ab. Es wird die historische Entwicklung des Umgangs mit Menschen mit Behinderung nachgezeichnet, von der Exklusion bis hin zu den Ansätzen der Integration und schließlich der Inklusion.
Welche Rolle spielt die UN-Behindertenrechtskonvention?
Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) von 2006 wird als zentraler Rechtsrahmen für die Umsetzung von Inklusion detailliert beschrieben. Besonderes Augenmerk liegt auf Artikel 24 (Recht auf Bildung) und der kritischen Diskussion der deutschen Übersetzung der Konvention.
Wie wird der Stand der Inklusion in Deutschland dargestellt?
Der Stand der Inklusion in Deutschland wird auf bildungspolitischer Ebene anhand quantitativer Daten (Inklusions-, Exklusions- und Förderquoten) analysiert. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern und die Herausforderungen bezüglich der Senkung der Exklusionsquote und der bundesweiten Einheitlichkeit werden beleuchtet.
Welche Herausforderungen auf Schulebene werden diskutiert?
Die Herausforderungen auf Schulebene betreffen inklusive Schulstrukturen, Schulkonzepte, die Schulleitung, differenzierten Unterricht, die spezifischen Probleme der Sekundarstufe, die Rolle der Lehrkräfte, Kooperationen und die Notwendigkeit von Aus- und Weiterbildung.
Welche Rolle spielen Lehrkräfte bei der Umsetzung der Inklusion?
Die Arbeit betont die zentrale Rolle der Lehrkräfte bei der Umsetzung von Inklusion, analysiert die Herausforderungen, ihre Einstellungen und die Bedeutung von Aus- und Weiterbildung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Pädagogische Inklusion, UN-Behindertenrechtskonvention, Salamanca Erklärung, Integration, Exklusion, Separation, inklusive Bildung, Sonderschulwesen, Regelschule, Differenzierter Unterricht, Lehrkräfte, Aus- und Weiterbildung, Bundesländer, Exklusionsquote, Inklusionsquote, Förderquote, Heterogenität, Schulpolitik, Deutschland.
- Arbeit zitieren
- Linda Waldrich (Autor:in), 2019, Pädagogische Inklusion an deutschen Schulen. Faktoren und Herausforderungen im Prozess der Umsetzung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/469301