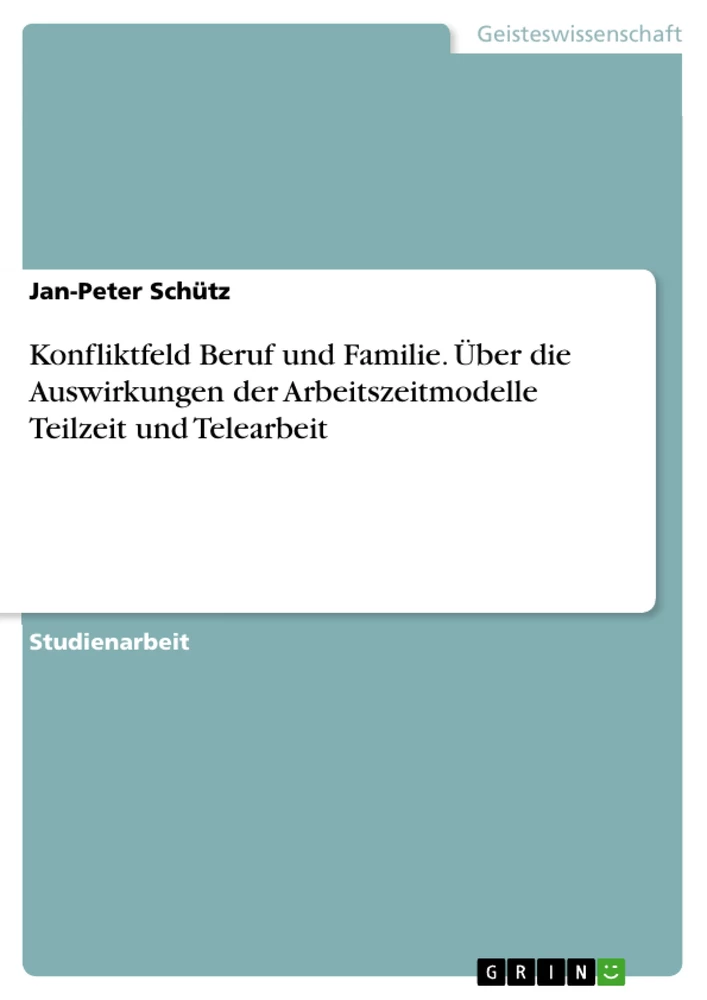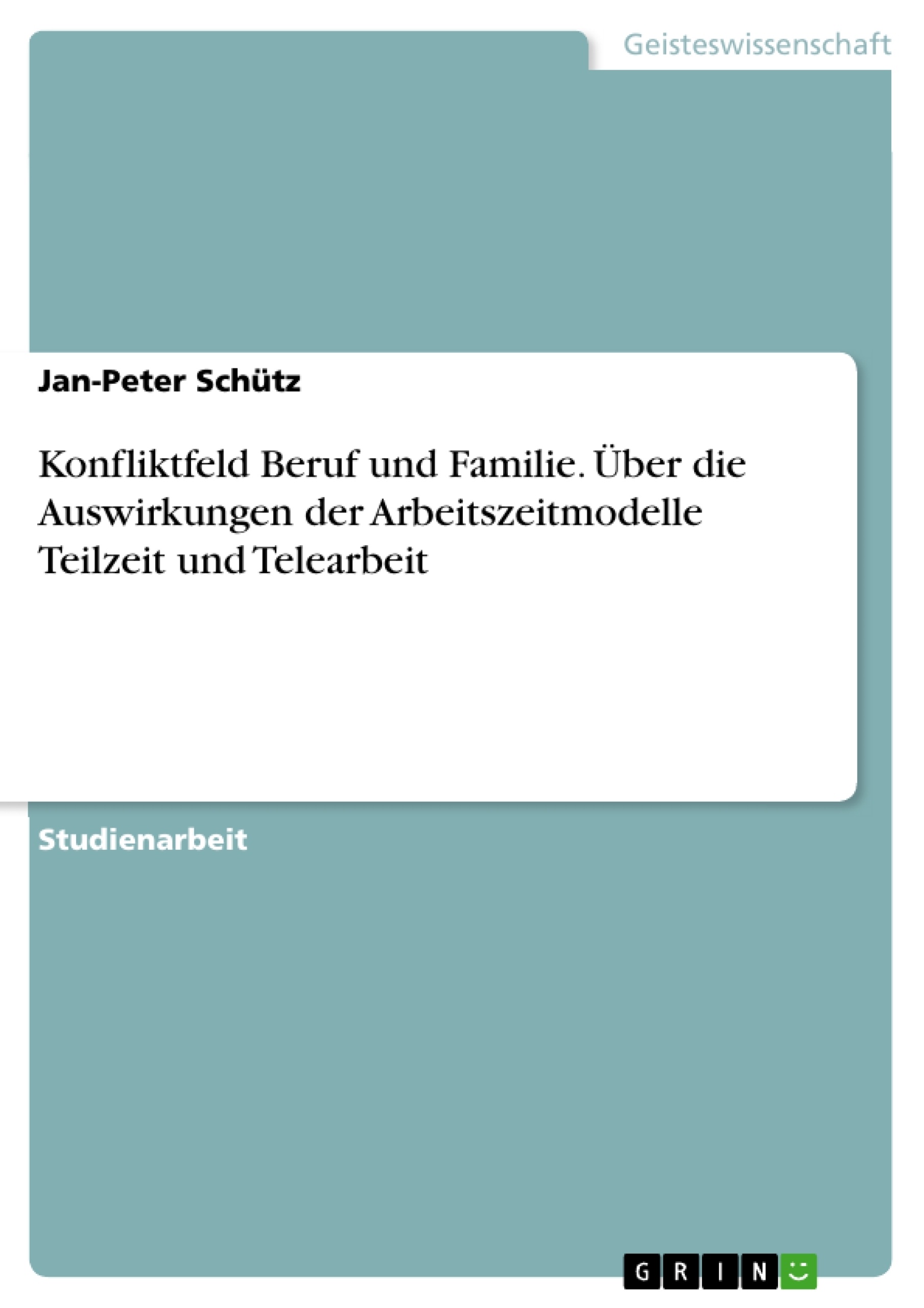Ziel dieser Hausarbeit ist es herauszufinden, worin diese Konflikte bestehen. Des Weiteren soll herausgearbeitet werden inwiefern die Arbeitszeitmodelle Teilzeit und Telearbeit dazu beitragen können diese Konflikte zu lösen. Letztendlich soll folgende Frage beantwortet werden: Inwiefern stellen Arbeitszeitmodelle, wie die der Teilzeit und Telearbeit eine Verbesserung der Work-Life-Balance in Bezug auf die Vereinbarkeit zwischen Berufs- und Familienleben dar?
"Trotz Bildungsrevolution und Frauenbewegung findet auch zu Beginn des neuen Jahrhunderts noch immer eine Hierarchisierung der Lebensbereiche statt. Zwar haben sich geschlechtsbezogene Zuweisungen auf die Lebens-bereiche und Arbeitszusammenhänge gelockert, doch stellen egalitäre Beziehungsmuster die Ausnahme dar. Nach wie vor sind es überwiegend Frauen, die nach der Familiengründung ihre Erwerbsarbeit reduzieren bzw. unterbrechen, um die Versorgung der Kinder zu übernehmen, während Männer ihre Erwerbsorientierung eher noch verstärken." (Jürgens 2003: 253) Das Zitat stammt von Kerstin Jürgens aus dem Jahre 2003 und sagt aus, dass nach wie vor traditionelle Rollenverteilungen nach der Familiengründung vorherrschen.
Eine aktuellere Statistik der OECD aus dem Jahre 2014 zeigt, wie lange Frauen beziehungsweise Männer am Tag durchschnittlich mit Haushaltsaufgaben verbringen. Die Statistik ergibt, dass Frauen im Schnitt 164 Minuten in Deutschland mit Haushaltsaufgaben verbringen. Männer hingegen nur rund 90 Minuten. Auch diese Statistik gibt einen Aufschluss darüber, dass die klassischen Rollenverteilungen weiterhin stark verbreitet sind. Aus dem Zitat von Jürgens geht außerdem hervor, dass aufgrund der vorliegenden klassischen Rollenverteilungen überwiegend Frauen ihre Erwerbsarbeit bei der Familiengründung reduzieren oder unterbrechen, während Männer diese eher noch verstärken. Aus diesem Sachverhalt heraus ergibt sich die Frage, welche Konflikte sich sowohl auf der beruflichen als auch auf der familiären Ebene für Männer und Frauen ergeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Hauptteil
- 2.1 Work-Life-Balance - Definition und Vorteile.
- 2.2 Arbeitszeitmodelle
- 2.2.1 Die Bedeutung von Teilzeit.
- 2.2.2 Die Bedeutung von Telearbeit.
- 2.2.3 Die Bedeutung der einschichtigen starren Arbeitszeit.
- 2.3 Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf - geschlechterspezifische Probleme.
- 2.4 Teilzeitarbeit - Gründe der Inanspruchnahme und Risiken.
- 2.5 Telearbeit - Gründe der Inanspruchnahme und Risiken.
- 2.6 Telearbeit und Teilzeit im Vergleich.
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Konflikte zwischen Beruf und Familie, insbesondere die Auswirkungen auf Frauen, die häufig ihre Erwerbsarbeit reduzieren oder unterbrechen, um die Kinderbetreuung zu übernehmen. Sie untersucht, inwiefern Arbeitszeitmodelle wie Teilzeit und Telearbeit dazu beitragen können, diese Konflikte zu lösen und die Work-Life-Balance zu verbessern.
- Definition und Vorteile von Work-Life-Balance
- Analyse der Arbeitszeitmodelle Teilzeit und Telearbeit
- Geschlechterspezifische Probleme bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Gründe und Risiken der Inanspruchnahme von Teilzeit und Telearbeit
- Beurteilung der Arbeitszeitmodelle im Hinblick auf die Verbesserung der Work-Life-Balance
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die traditionelle Rollenverteilung nach der Familiengründung und die daraus resultierenden Konflikte für Männer und Frauen. Sie stellt die Forschungsfrage, inwiefern Arbeitszeitmodelle wie Teilzeit und Telearbeit zur Verbesserung der Work-Life-Balance beitragen können.
- Kapitel 2.1: Work-Life-Balance - Definition und Vorteile
Dieses Kapitel definiert den Begriff "Work-Life-Balance" und beschreibt die Vorteile dieses Konzepts sowohl für die einzelnen MitarbeiterInnen als auch für Unternehmen. Es werden verschiedene Instrumente der Work-Life-Balance erläutert, wie flexible Arbeitszeitmodelle, die Möglichkeit der Selbststeuerung der Arbeitszeit und die ergebnisorientierte Leistungserbringung.
- Kapitel 2.2: Arbeitszeitmodelle
Kapitel 2.2 gibt einen Überblick über die Arbeitszeitmodelle Teilzeit und Telearbeit und stellt sie dem klassischen einschichtigen und starren Arbeitszeitmodell gegenüber. Es werden die wesentlichen Unterschiede zwischen den Modellen im Hinblick auf Flexibilität und Autonomie aufgezeigt.
- Kapitel 2.3: Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf - geschlechterspezifische Probleme
Dieses Kapitel analysiert die geschlechterspezifischen Konflikte, die entstehen, wenn versucht wird, Familie und Erwerbsarbeit in Einklang zu bringen. Es werden traditionelle Rollenbilder und die damit verbundenen Herausforderungen für Frauen beleuchtet.
- Kapitel 2.4: Teilzeitarbeit - Gründe der Inanspruchnahme und Risiken
Kapitel 2.4 stellt die wichtigsten Gründe für die Inanspruchnahme von Teilzeitarbeit dar und beleuchtet gleichzeitig die damit verbundenen Risiken. Diese Analyse dient dazu, die Potenziale und Herausforderungen von Teilzeit im Kontext der Work-Life-Balance zu beleuchten.
- Kapitel 2.5: Telearbeit - Gründe der Inanspruchnahme und Risiken
Dieses Kapitel widmet sich den Gründen für die Inanspruchnahme von Telearbeit und zeigt die damit verbundenen Risiken auf. Die Analyse untersucht die Vorteile und Nachteile von Telearbeit im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
- Kapitel 2.6: Telearbeit und Teilzeit im Vergleich
Kapitel 2.6 setzt die Erkenntnisse aus den vorherigen Kapiteln in Beziehung zueinander und vergleicht die Arbeitszeitmodelle der Telearbeit und Teilzeit im Hinblick auf ihre Eignung zur Lösung der in Kapitel 2.3 beschriebenen Konflikte.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit befasst sich mit den Themen Work-Life-Balance, Arbeitszeitmodelle, Teilzeit, Telearbeit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, geschlechterspezifische Probleme, traditionelle Rollenbilder und die Analyse von Gründen und Risiken der Inanspruchnahme dieser Arbeitszeitmodelle.
Häufig gestellte Fragen
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt dieser Hausarbeit?
Die Arbeit untersucht, inwiefern Arbeitszeitmodelle wie Teilzeit und Telearbeit eine Verbesserung der Work-Life-Balance und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie darstellen.
Was versteht man unter Work-Life-Balance?
Work-Life-Balance definiert das Gleichgewicht zwischen Berufs- und Privatleben, wobei Instrumente wie flexible Arbeitszeiten und Selbststeuerung zur Mitarbeiterzufriedenheit beitragen.
Welche geschlechterspezifischen Probleme werden thematisiert?
Es wird analysiert, dass nach wie vor traditionelle Rollenverteilungen vorherrschen, bei denen Frauen ihre Erwerbsarbeit für die Kinderbetreuung reduzieren, während Männer sie oft verstärken.
Was sind die Risiken von Teilzeitarbeit?
Die Arbeit beleuchtet neben den Gründen für die Inanspruchnahme auch die damit verbundenen beruflichen und finanziellen Risiken für die ArbeitnehmerInnen.
Wie unterscheiden sich Teilzeit und Telearbeit im Hinblick auf Flexibilität?
Beide Modelle bieten mehr Flexibilität als starre Arbeitszeiten, wobei Telearbeit zusätzlich die räumliche Autonomie fördert, während Teilzeit primär die zeitliche Belastung reduziert.
- Arbeit zitieren
- Jan-Peter Schütz (Autor:in), 2019, Konfliktfeld Beruf und Familie. Über die Auswirkungen der Arbeitszeitmodelle Teilzeit und Telearbeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/469438