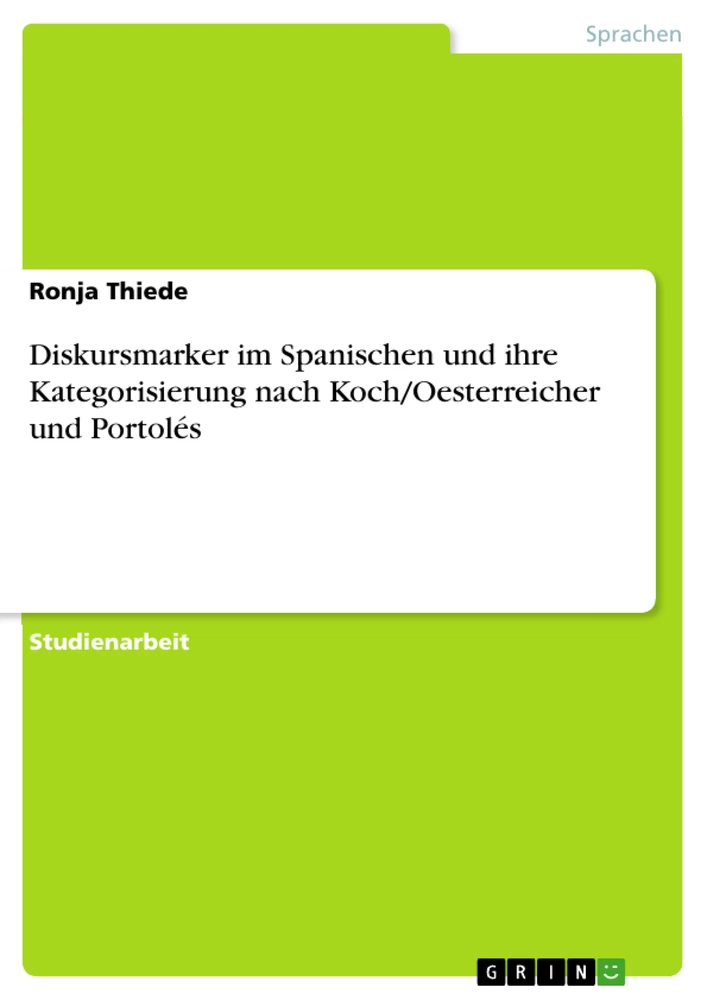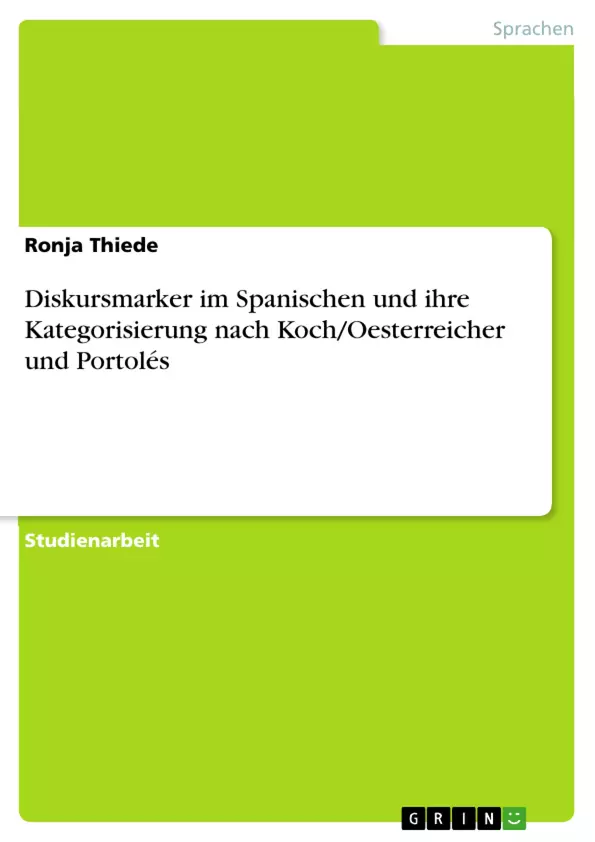Im Allgemeinen werden Diskursmarker als Gegenstandsbereich der Pragmatik verstanden und zeichnen sich besonders durch ihren prozeduralen Bedeutungsgehalt aus. Elena Landone bezeichnet sie als “los engranajes del discurso, […] ya que procesan su cohesión, coherencia, adecuación y eficacia” (2012: 431). Formal sind Diskursmarker den grammatikalischen Kategorien der Konjunktionen, der Adverbien und Interjektionen zuzuordnen und umfassen auch nominale und verbale appellativischen Formen. Sie sind syntaktisch gering bis nicht integriert und morphologisch invariabel.
Die Kategorisierung der marcadores in eine homogene Gruppe gestaltet sich äußerst schwierig. Zwar sind sich die meisten Forscher darüber einig, dass die Hauptfunktion der Marker darin liegt, unterschiedliche Arten sprachlicher Einheiten miteinander in Verbindung zu setzen, oder – besser gesagt – deren Verbindung klar zu markieren; allerdings handelt es sich doch um sehr komplexe sprachliche Elemente, deren Zusammenfassung in eine neue Wortgruppe bisher nicht in zufriedenstellender Form erreicht werden konnte.
Dementsprechend soll in der vorliegenden Arbeit zunächst diese Schwierigkeit der Kategorisierung genauer erläutert werden, bevor dann zwei mögliche Kategorisierungsvorschläge vorgestellt werden. Dabei wird zunächst auf die Klassifizierung Koch Oesterreichers und anschließend auf die Portolés‘ eingegangen. Abschließend werden die gesammelten Erkenntnisse zusammengefasst, wobei die beiden Kategorisierungsentwürfe einander gegenübergestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Diskursmarker: eine neue Wortklasse?
- 3. Kategorisierung nach Koch Oesterreicher
- 3.1. Gliederungssignale
- 3.2. Turn-taking-Signale
- 3.3. Kontaktsignale
- 3.3.1. Sprechersignale
- 3.3.2. Hörersignale
- 3.4. Überbrückungsphänomene
- 3.5. Korrektursignale
- 3.6. Interjektionen
- 3.7. Abtönungsphänomene
- 4. Kategorisierung nach Portolés
- 4.1. Los estructuradores de la información
- 4.1.1. Los comentadores
- 4.1.2. Los ordenadores
- 4.1.3. Los digresores
- 4.2. Los conectores
- 4.2.1. Los conectores aditivos
- 4.2.2. Los conectores consecutivos
- 4.2.3. Los conectores contraargumentativos
- 4.3. Los reformuladores
- 4.3.1. Los reformuladores explicativos
- 4.3.2. Los reformuladores rectificativos
- 4.3.3. Los reformuladores de distanciamiento
- 4.3.4. Los reformuladores recapitulativos
- 4.4. Los operadores discursivos
- 4.4.1. Los operadores de refuerzo argumentativo
- 4.4.2. Los operadores de concreción
- 4.4.3. El operador de formulación
- 4.5. Los marcadores de control de contacto
- 4.1. Los estructuradores de la información
- 5. Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Kategorisierung von Diskursmarkern im Spanischen. Ziel ist es, die Schwierigkeiten bei der Einordnung dieser sprachlichen Elemente in bestehende grammatische Kategorien zu beleuchten und zwei existierende Kategorisierungsansätze (Koch/Oesterreicher und Portolés) gegenüberzustellen.
- Schwierigkeiten bei der Kategorisierung von Diskursmarkern
- Vergleichende Analyse der Kategorisierungsansätze von Koch/Oesterreicher und Portolés
- Funktionale Aspekte von Diskursmarkern im Spanischen
- Formale Merkmale von Diskursmarkern
- Der Diskursmarker als eigene Wortklasse
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Diskursmarker ein, definiert den Begriff und seine verschiedenen Bezeichnungen im Deutschen und Spanischen. Sie hebt die wachsende Forschungsaktivität auf diesem Gebiet hervor und betont die Bedeutung von Diskursmarkern für die kommunikative Nähe. Die Einleitung benennt die Schwierigkeiten bei der Kategorisierung dieser Marker und kündigt die Vorstellung zweier Kategorisierungsansätze (Koch/Oesterreicher und Portolés) an.
2. Diskursmarker: eine neue Wortklasse?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage, ob Diskursmarker eine eigene, neue Wortklasse bilden sollten. Es werden Argumente für und wider eine solche Einteilung präsentiert, wobei die formalen Kriterien im Vordergrund stehen. Cuencas Kriterien für eine neue Klasse werden vorgestellt und kritisch hinterfragt, insbesondere von Garcés Gómez, die auf die Grenzen dieser Kriterien hinweist. Die Diskussion zeigt die Komplexität einer rein formalen Kategorisierung auf.
3. Kategorisierung nach Koch Oesterreicher: Dieses Kapitel beschreibt den Kategorisierungsvorschlag von Koch und Oesterreicher, der sich an verschiedenen Funktionsdimensionen der Diskursmarker orientiert. Die verschiedenen Kategorien – Gliederungs-, Turn-taking-, Kontakt-, Überbrückung-, und Korrektursignale sowie Interjektionen und Abtönungspartikeln – werden erläutert. Der Fokus liegt auf den funktionalen Aspekten und der damit verbundenen Schwierigkeit einer rein formalen Klassifizierung.
Schlüsselwörter
Diskursmarker, marcadores discursivos, Kategorisierung, Koch Oesterreicher, Portolés, Spanisch, Pragmatik, Grammatikalisierung, Subjektivierung, kommunikative Nähe.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Kategorisierung von Diskursmarkern im Spanischen
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Kategorisierung von Diskursmarkern im Spanischen. Sie vergleicht zwei existierende Kategorisierungsansätze (Koch/Oesterreicher und Portolés), beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Einordnung dieser sprachlichen Elemente und untersucht funktionale und formale Merkmale von Diskursmarkern.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Schwierigkeiten bei der Kategorisierung von Diskursmarkern, einen Vergleich der Kategorisierungsansätze von Koch/Oesterreicher und Portolés, funktionale Aspekte von Diskursmarkern im Spanischen, formale Merkmale von Diskursmarkern und die Frage, ob der Diskursmarker als eigene Wortklasse betrachtet werden sollte.
Welche Kategorisierungsansätze werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Kategorisierungsansätze von Koch/Oesterreicher und Portolés. Koch/Oesterreicher kategorisiert Diskursmarker nach funktionalen Dimensionen (Gliederungs-, Turn-taking-, Kontakt-, Überbrückungs-, Korrektursignale, Interjektionen, Abtönungspartikeln), während Portolés eine differenziertere Klassifizierung mit Kategorien wie Strukturgeber, Konnektoren, Reformulierer und Diskursoperatoren verwendet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel zur Frage nach den Diskursmarkern als eigener Wortklasse, Kapiteln zur detaillierten Beschreibung der Kategorisierung nach Koch/Oesterreicher und Portolés, und einer Schlussfolgerung. Ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Welche Schwierigkeiten bei der Kategorisierung werden angesprochen?
Die Arbeit thematisiert die Schwierigkeiten, Diskursmarker aufgrund ihrer oft fließenden Grenzen und multifunktionalen Natur in bestehende grammatische Kategorien einzuordnen. Die rein formale Klassifizierung wird als problematisch dargestellt.
Welche Rolle spielen formale und funktionale Aspekte?
Sowohl formale als auch funktionale Aspekte der Diskursmarker werden untersucht. Die Arbeit zeigt, dass eine reine formale Kategorisierung unzureichend ist und die funktionalen Aspekte für eine adäquate Einordnung entscheidend sind.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Diskursmarker, marcadores discursivos, Kategorisierung, Koch Oesterreicher, Portolés, Spanisch, Pragmatik, Grammatikalisierung, Subjektivierung, kommunikative Nähe.
Werden die Kriterien von Cuenca diskutiert?
Ja, die Kriterien von Cuenca für eine neue Wortklasse werden vorgestellt und kritisch hinterfragt, insbesondere im Hinblick auf die Grenzen dieser Kriterien, wie von Garcés Gómez aufgezeigt.
Gibt es Kapitelzusammenfassungen?
Ja, die Arbeit enthält kurze Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, welche die wichtigsten Inhalte jedes Abschnitts zusammenfassen.
- Citation du texte
- Ronja Thiede (Auteur), 2018, Diskursmarker im Spanischen und ihre Kategorisierung nach Koch/Oesterreicher und Portolés, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/469958