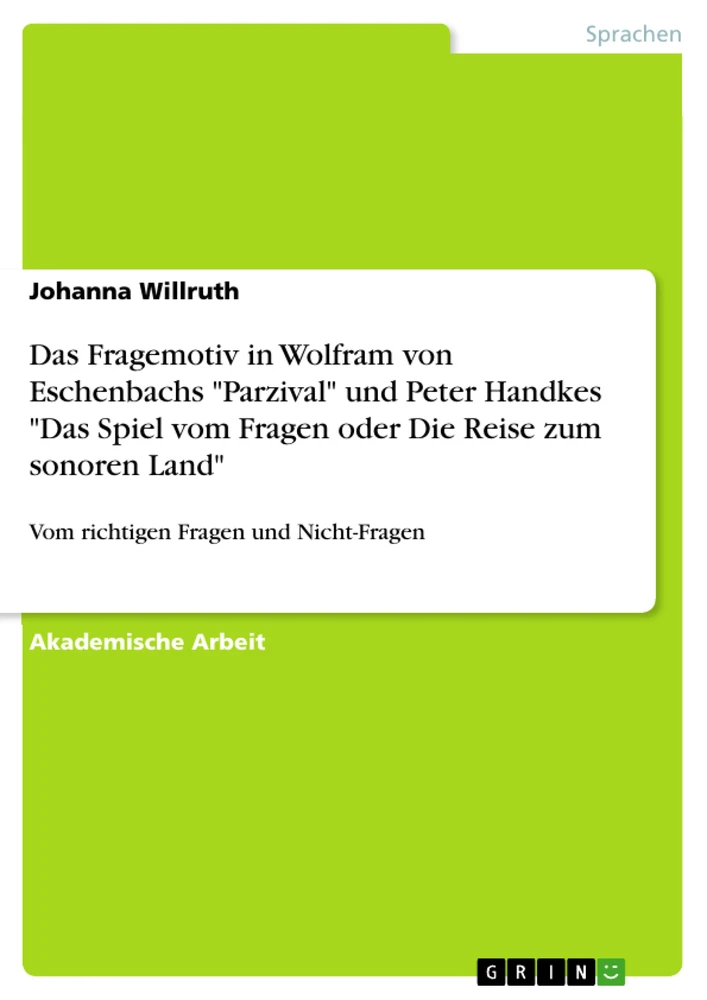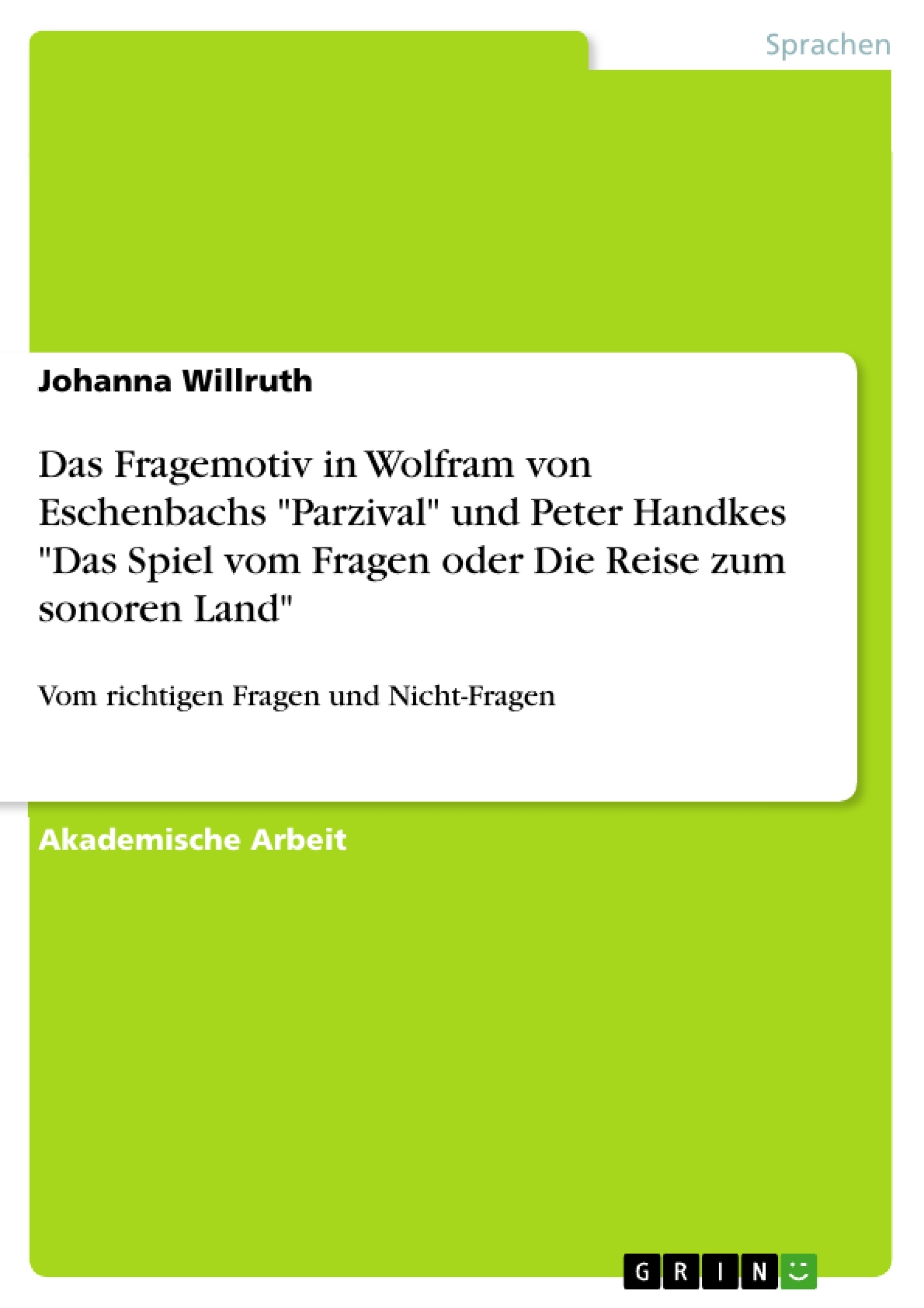Die Frage nach dem richtigen Fragen, dem echten Fragen und dem Nicht-Fragen durch Barrieren, die auf Gesellschaftsnormen wie Höflichkeit und Taktgefühl bauen, beschäftigt bereits mehrere Epochen das Miteinander der Menschen. Wann überschreitet das Stellen einer Frage eine Grenze, gilt als unhöflich, dringt zu sehr in den Gefragten ein und wann ist aber das unterlassene Stellen einer Frage, das Nicht-Fragen, ein Frageversäumnis, welches lasterhafte Konsequenzen mit sich zieht, vielleicht sogar sündhaft ist. Dass eine Differenzierung von echten und unechten Fragen problematisch ist, zeigen Verfehlungen von Kommunikation, bei denen eine Antwort verwehrt bleibt.
Bereits im Mittelalter stellt sich die Fage nach dem richtigen Fragen, Wolfram von Eschenbachs Parzival scheitert durch eine unzureichende Einschätzungskompetenz und fehlenden Sinn für situatives Entscheiden kläglich an der wohl bedeutendsten Frage des Werkes, nämlich nach dem Befinden des Gralskönigs Anfortas, durch ein einfaches Nicht-Stellen dieser Frage. Erst viel später schafft Parzival diese entscheidende Frage zu stellen und erlöst damit die Gralsgesellschaft, um schließlich selbst zum Gralskönig zu werden. Die richtige Frage bringt Erlösung und eine Fragekompetenz erweist sich als notwendig, um als ausgezeichneter Ritter alle aventiure zu bestehen.
Auch der österreichische Dramaturg Peter Handke geht auf die Suche nach dem richtigen, nach dem echten Fragen, indem er in seinem Theaterstück „Das Spiel vom Fragen oder Die Reise zum sonoren Land“ eine Fragegesellschaft auf die Reise in ein mythisches Land schickt, mit dem Ziel dort durch das richtige Fragen zu sich selbst zu finden. Auch hier tritt ein Parzival auf, der mit dem mittelalterlichen Ritter kaum etwas gemein hat, bis auf die fehlende Fragekompetenz. Stumm und gewalttätig, fast wie ein wildes Kind, beginnt dieser Parzival ebenfalls eine Reise und erfährt ganz zum Schluss auch seine Erlösung, durch Selbsterkenntnis und das Erreichen des mythischen Ortes wird er schlussendlich zum rationalen Sprecher.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Fragemotiv in Wolframs „Parzival“
- Höfische Kommunikationsnormen und der tumbe Parzival
- Parzival in der Gralsburg Munsalvaesche
- Das Verbot nach dem Namen zu fragen
- Das Fragen bei Gawan
- Das Fragemotiv bei Peter Handkes „Das Spiel vom Fragen oder Die Reise zum sonoren Land“
- Die verschiedenen Fragen der Fragegesellschaft
- Mauerschauer und Spielverderber
- Das alte Paar
- Die jungen Schauspieler
- Peter Handkes Parzival
- Peter Handkes Rezeption von „Parzival“
- Motive von „Parzival“ in „Das Spiel vom Fragen“
- Handkes Motivation
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Motiv des Fragens in Wolfram von Eschenbachs „Parzival“ und Peter Handkes „Das Spiel vom Fragen oder Die Reise zum sonoren Land“. Sie untersucht, wie das Fragemotiv in beiden Werken vorkommt und welche Bedeutung es für die Handlung und die Figuren hat. Dabei werden die verschiedenen Arten von Fragen sowie die Auswirkungen von richtigem und falschem Fragen analysiert.
- Das richtige und falsche Fragen in mittelalterlicher und moderner Literatur
- Höfische Kommunikationsnormen und ihre Auswirkungen auf das Frageverhalten
- Die Rolle des Frageversäumnisses und seine Folgen für den Protagonisten
- Die Bedeutung des Fragens für die Selbsterkenntnis und die Erlösung des Helden
- Die Rezeption von „Parzival“ durch Peter Handke und die Herausarbeitung von Parallelen zwischen den Werken
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema des richtigen und falschen Fragens in den Kontext von Kommunikations- und Dialogformen in der Postmoderne und beleuchtet die Bedeutung von Fragen für das menschliche Miteinander. Sie führt das Fragemotiv anhand von „Parzival“ und „Das Spiel vom Fragen“ ein und verdeutlicht die zentrale Rolle des Frageversäumnisses im mittelalterlichen Roman und in Handkes Theaterstück. Die Kapitelübersichten geben einen Einblick in die zentralen Thesen und Argumentationslinien der einzelnen Kapitel, ohne jedoch die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit zu verraten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Fragen, Frageversäumnis, Höflichkeit, Kommunikation, Selbsterkenntnis, Erlösung, „Parzival“, „Das Spiel vom Fragen“, Wolfram von Eschenbach, Peter Handke, mittelalterlicher Roman, Theaterstück, Rezeption.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale „Frage“ in Wolframs „Parzival“?
Die wichtigste Frage ist die Mitleidsfrage nach dem Befinden des Gralskönigs Anfortas („Oheim, was wirret dir?“), die Parzival bei seinem ersten Besuch versäumt zu stellen.
Warum stellt Parzival die Frage beim ersten Mal nicht?
Er scheitert an falsch verstandenen höfischen Kommunikationsnormen und Verboten (Höflichkeit), die ihn daran hindern, situativ richtig und aus echtem Mitgefühl zu handeln.
Wie greift Peter Handke das Parzival-Motiv auf?
In seinem Stück „Das Spiel vom Fragen“ tritt ebenfalls ein Parzival auf, der stumm und gewalttätig ist und erst durch eine Reise und das richtige Fragen zu Selbsterkenntnis und Sprache findet.
Was unterscheidet „echte“ von „unechten“ Fragen?
Die Arbeit untersucht, wann Fragen nur aus Taktgefühl (unecht) gestellt werden und wann sie aus einer inneren Notwendigkeit oder echtem Interesse (echt) entspringen.
Welches Ziel verfolgt die „Fragegesellschaft“ bei Handke?
Die Gruppe begibt sich auf eine Reise in ein mythisches Land, um durch das Stellen der richtigen Fragen zu sich selbst und zu einer neuen Form des Miteinanders zu gelangen.
- Arbeit zitieren
- Johanna Willruth (Autor:in), 2018, Das Fragemotiv in Wolfram von Eschenbachs "Parzival" und Peter Handkes "Das Spiel vom Fragen oder Die Reise zum sonoren Land", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/469977