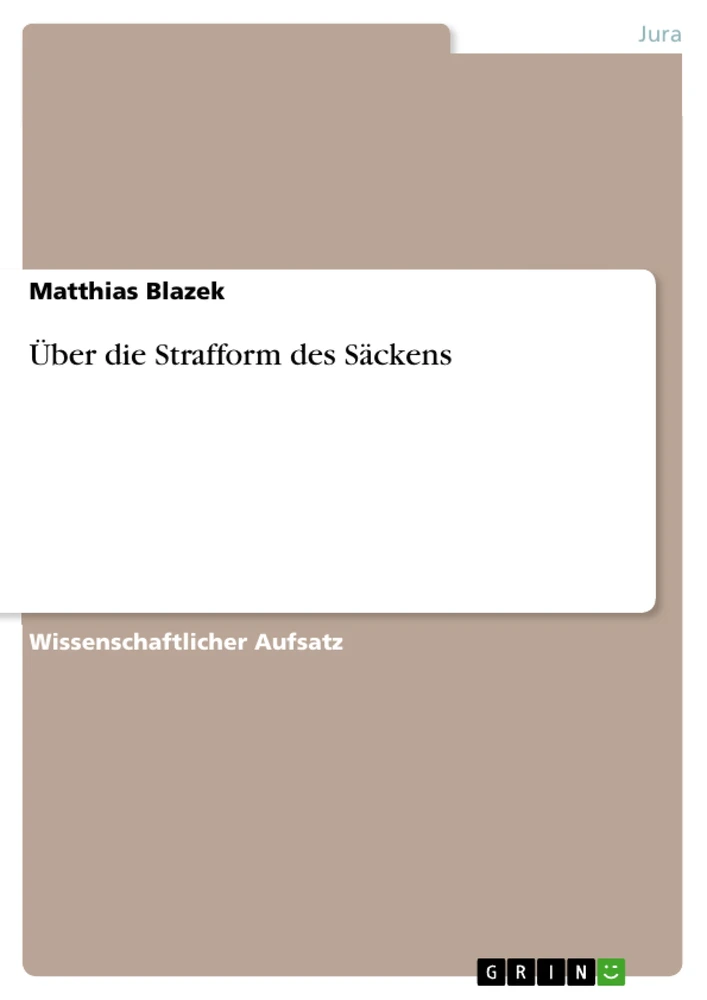Die Strafform des „Säckens“, aus dem römischen Recht übernommene Hinrichtungsart, die 1532 in die „Carolina“ übernommen worden ist und meistens an Frauen praktiziert wurde, die – ja zumeist in der persönlichen Not – ihre Kinder getötet haben, lässt heute viele Fragen offen. Das Hinzunehmen einer Menagerie von Tieren (Hund, Hahn, Schlange und Affe) in den mit der Delinquentin unterzutauchenden Sack stößt heute auf Unverständnis. Es war aber gesetzlich verankert, und die Gerichte hatten sich – mit wenig Spielraum – daran zu halten.
Die hier beschriebene Strafform ist die am wenigsten studierte oder ergründete Art und Weise, Angeklagte in früheren Zeiten vom Leben zum Tode zu bringen. Die Hintergründe sind heute fast ausschließlich nicht mehr nachvollziehbar, sie bleiben im Dunkeln. Die Zahl der überlieferten Fälle ist übersichtlich. Weshalb die Mütter ihre Kinder getötet haben – ungewünschte Schwangerschaften, Vergewaltigungen durch Haus- und Hofherren, Behinderung beim Beibringen des Lebensunterhaltes – wird nirgends deutlich. Gnade war selten, die Richter waren dem Buchstaben des Gesetzes verpflichtet.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungen
- Zum Geleit
- Einleitung
- Historisch belegte Einzelfälle
- Literaturverzeichnis
- Über den Autor
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Strafform des „Säckens“, einer Hinrichtungsart aus dem römischen Recht, die im 16. Jahrhundert in die „Carolina“ aufgenommen wurde und vor allem an Frauen angewandt wurde, die ihre Kinder getötet hatten. Der Autor zeichnet ein Bild dieser mittelalterlichen Todesstrafe und untersucht ihre Anwendung und Bedeutung im Kontext der damaligen Rechtsprechung.
- Die Strafform des „Säckens“ als Bestandteil der deutschen Rechtsgeschichte
- Die Anwendung der Todesstrafe an Frauen, die ihre Kinder getötet hatten
- Die historischen Hintergründe und Beweggründe für die Anwendung dieser Strafform
- Die Rolle der Tiere (Hund, Hahn, Schlange, Affe) in der Hinrichtung
- Die Abschaffung der Todesstrafe in Kursachsen und Preußen
Zusammenfassung der Kapitel
Zum Geleit
Der Autor gibt einen kurzen Überblick über die Thematik der Arbeit und beleuchtet die dunkle Seite der deutschen Justizgeschichte. Er stellt die Strafform des „Säckens“ als ein wenig erforschtes Kapitel dar, das viele Fragen aufwirft.
Einleitung
Die Strafform des „Säckens“ wird als befremdlich und altertümlich beschrieben. Der Autor stellt fest, dass es nur wenige Beispiele in der Vergangenheit gibt und die Hintergründe oft im Dunkeln bleiben. Er erläutert die historische Einordnung der Todesstrafe im Kontext des römischen Rechts und der „Carolina“.
Historisch belegte Einzelfälle
Dieses Kapitel befasst sich mit konkreten Beispielen der Anwendung der Strafform des „Säckens“. Der Autor beleuchtet verschiedene Fälle aus der deutschen Geschichte und bezieht sich dabei auf historische Quellen und Sekundärliteratur. Er zeigt die unterschiedlichen Hintergründe für die Tötung von Kindern durch ihre Mütter und die unterschiedliche Auslegung der Strafform.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe der Arbeit sind: Strafform des „Säckens“, Todesstrafe, Hinrichtung, Carolina, römisches Recht, Verwandtenmord, Parricidium, Poena Cullei, Säckung, Mittelalter, Rechtsgeschichte, Frauen, Kindermord, historische Quellen, Sekundärliteratur, Rechtsprechung.
- Citar trabajo
- Matthias Blazek (Autor), 2019, Über die Strafform des Säckens, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/470651