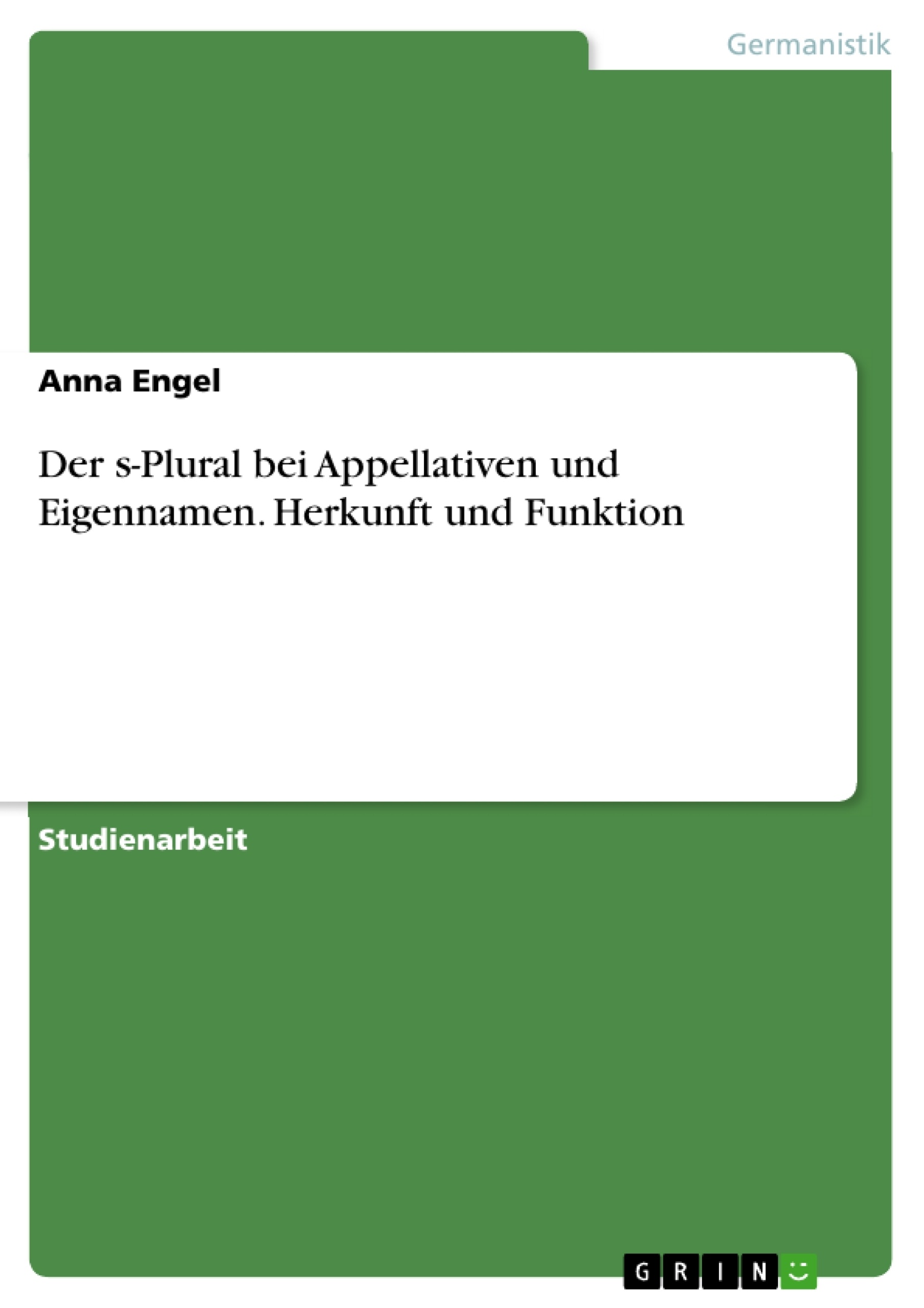Die vorliegende Hausarbeit konzentriert sich auf die Entwicklung, Herkunft und Funktion des Plural-s im Deutschen. Beschäftigt man sich mit der diachronen Entwicklung des Plural-s, wird schnell deutlich, dass man sich auf dem Gebiet der Sprachwissenschaften sehr kontrovers mit dessen Ursprung auseinandergesetzt hat und diverse anfechtbare Theorien zur Herkunft dieses sprachwissenschaftlichen Phänomens aufgestellt wurden.
Um dies zu zeigen, werde ich im Folgenden die wichtigsten Theorien kurz vorstellen, im Anschluss daran ausführlich auf den tatsächlichen Ursprung des Plural-s zu sprechen kommen und außerdem (s)eine Sonderform vorstellen, um die Logik dieser Theorie noch deutlicher unter Beweis zu stellen. Schließlich werde ich in dem Zusammenhang die Funktion des Plural-s untersuchen, indem ich die verschiedenen Wortformen, an die er sich anhängt, genauer betrachte, vergleiche und unterscheide.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Ursprung des s-Plurals
- Entlehnung
- Oder einheimisches Suffix?
- Die Reanalyse des Plural-s aus dem Genitiv-Singular-s
- Vom Allomorph zum überstabilen Marker
- Die Reanalyse zum Pluralmarker
- Besondere Formen - Elliptische Genitivkonstruktionen
- Die heutige Funktion des Plural-s
- Allgemein
- Übergangs- bzw. Transparenzplural
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Ursprung und die Funktion des s-Plurals im Deutschen. Ziel ist es, die Entstehung dieses grammatischen Merkmals zu klären und seine heutige Verwendung zu beschreiben. Dabei werden verschiedene Theorien zur Herkunft des s-Plurals diskutiert und bewertet.
- Die Entwicklung des s-Plurals im Deutschen
- Die Rolle von Entlehnungen und einheimischen Suffixen
- Die Reanalyse des Genitiv-s als Pluralmarker
- Die Funktion des s-Plurals in verschiedenen Wortklassen
- Besondere Fälle wie elliptische Genitivkonstruktionen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des s-Plurals ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dessen Herkunft und Funktion. Sie erläutert die Bedeutung des s-Plurals im modernen Deutsch und hebt die lange bestehende Unsicherheit über seinen Ursprung hervor. Die Arbeit kündigt die Vorstellung verschiedener Theorien an und verspricht eine detaillierte Untersuchung des tatsächlichen Ursprungs sowie der Funktion des s-Plurals anhand verschiedener Wortarten.
Der Ursprung des s-Plurals: Dieses Kapitel behandelt verschiedene Theorien zur Herkunft des s-Plurals, darunter die Annahme einer Entlehnung aus dem Niederländischen, Altfranzösischen oder Altenglischen. Diese Theorien werden kritisch bewertet und verworfen. Es wird die Hypothese eines einheimischen Suffixes aus dem Altsächsischen diskutiert, ebenfalls mit kritischen Anmerkungen zu zeitlichen Lücken und geographischen Ungleichheiten. Die These des s-Plurals als gemeinsames Phänomen des nordseegermanischen Sprachbundes wird ebenfalls erörtert und widerlegt. Abschließend wird die Theorie von Salverda de Grave vorgestellt, die den s-Plural aus dem Genitiv Singular ableitet und ihn als Phänomen der Abstraktbildung betrachtet, welche anfänglich als wenig überzeugend empfunden wurde.
Die Reanalyse des Plural-s aus dem Genitiv-Singular-s: Dieses Kapitel befasst sich mit der detaillierten Analyse der Entwicklung des s-Plurals aus dem Genitiv Singular. Es wird die Rolle von Kollektivbildungen bei Eigennamen hervorgehoben. Die Veränderung der Flexion von Eigennamen im 19. Jahrhundert, mit dem Genitiv-s als "überstabilem Marker", der das schwache en-Genitivsuffix verdrängt, wird erläutert. Die Bevorzugung des s-Suffixes wird mit dem Problem der Fehlidentifizierung des onymischen Stammes bei Verwendung des en-Suffixes begründet. Die Entstehung des ens-Doppelsuffixes bei sibilantisch auslautenden Eigennamen wird ebenfalls behandelt. Eine Tabelle veranschaulicht die Flexion von Personennamen im 19. Jahrhundert.
Schlüsselwörter
s-Plural, Genitiv, Pluralbildung, Eigennamen, Appellative, Sprachgeschichte, Diachronie, Reanalyse, überstabiler Marker, Kollektivbildung, Altsächsisch, Niederländisch, Altfranzösisch, Altenglisch, nordseegermanischer Sprachbund.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Entstehung und Funktion des s-Plurals im Deutschen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht umfassend den Ursprung und die heutige Funktion des s-Plurals im Deutschen. Sie beleuchtet die Entwicklung dieses grammatischen Merkmals von seinen historischen Anfängen bis zur modernen Verwendung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Theorien zur Herkunft des s-Plurals, darunter die Annahme einer Entlehnung aus anderen Sprachen (Niederländisch, Altfranzösisch, Altenglisch) und die Hypothese eines einheimischen Suffixes. Ein Schwerpunkt liegt auf der Reanalyse des Genitiv-s als Pluralmarker, der Rolle von Kollektivbildungen und der Entwicklung der Flexion von Eigennamen. Besondere Fälle wie elliptische Genitivkonstruktionen werden ebenfalls betrachtet. Die heutige Funktion des s-Plurals, einschließlich des Übergangs- bzw. Transparenzplurals, wird ausführlich beschrieben.
Welche Theorien zur Herkunft des s-Plurals werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Theorien, darunter die Entlehnungstheorien aus dem Niederländischen, Altfranzösischen und Altenglischen, die Hypothese eines einheimischen Suffixes aus dem Altsächsischen und die These eines gemeinsamen Phänomens im nordseegermanischen Sprachbund. Im Detail wird die Theorie von Salverda de Grave behandelt, die den s-Plural aus dem Genitiv Singular ableitet.
Wie wird die Reanalyse des Genitiv-s als Pluralmarker erklärt?
Die Arbeit analysiert detailliert die Entwicklung des s-Plurals aus dem Genitiv Singular. Dabei wird die Rolle von Kollektivbildungen bei Eigennamen hervorgehoben, die Veränderung der Flexion von Eigennamen im 19. Jahrhundert und die Bevorzugung des s-Suffixes aufgrund der Vermeidung von Fehlidentifizierungen des onymischen Stammes erklärt. Die Entstehung des ens-Doppelsuffixes bei sibilantisch auslautenden Eigennamen wird ebenfalls behandelt.
Welche Rolle spielen Eigennamen in der Entwicklung des s-Plurals?
Eigennamen spielen eine wichtige Rolle, da sie die Veränderung der Flexion im 19. Jahrhundert veranschaulichen. Die Reanalyse des Genitiv-s als Pluralmarker wird insbesondere anhand der Entwicklung der Eigennamenflexion erklärt, wobei das "überstabile" Genitiv-s das schwache en-Genitivsuffix verdrängt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: s-Plural, Genitiv, Pluralbildung, Eigennamen, Appellative, Sprachgeschichte, Diachronie, Reanalyse, überstabiler Marker, Kollektivbildung, Altsächsisch, Niederländisch, Altfranzösisch, Altenglisch, nordseegermanischer Sprachbund.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Einleitung, dem Ursprung des s-Plurals, der Reanalyse des Plural-s aus dem Genitiv-Singular-s, besonderen Formen (elliptische Genitivkonstruktionen), der heutigen Funktion des Plural-s, einem Fazit und einem Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung der Arbeit ist es, den Ursprung und die Funktion des s-Plurals im Deutschen zu klären. Es werden verschiedene Theorien diskutiert und bewertet, um die Entstehung dieses grammatischen Merkmals zu verstehen und seine heutige Verwendung zu beschreiben.
- Citar trabajo
- Anna Engel (Autor), 2017, Der s-Plural bei Appellativen und Eigennamen. Herkunft und Funktion, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/470863