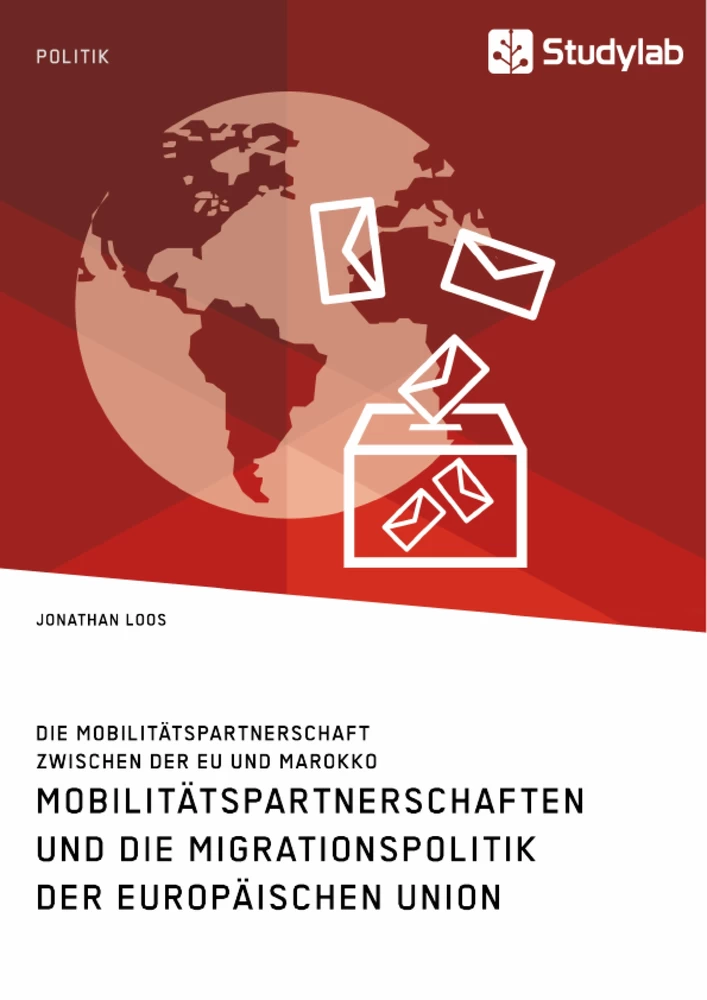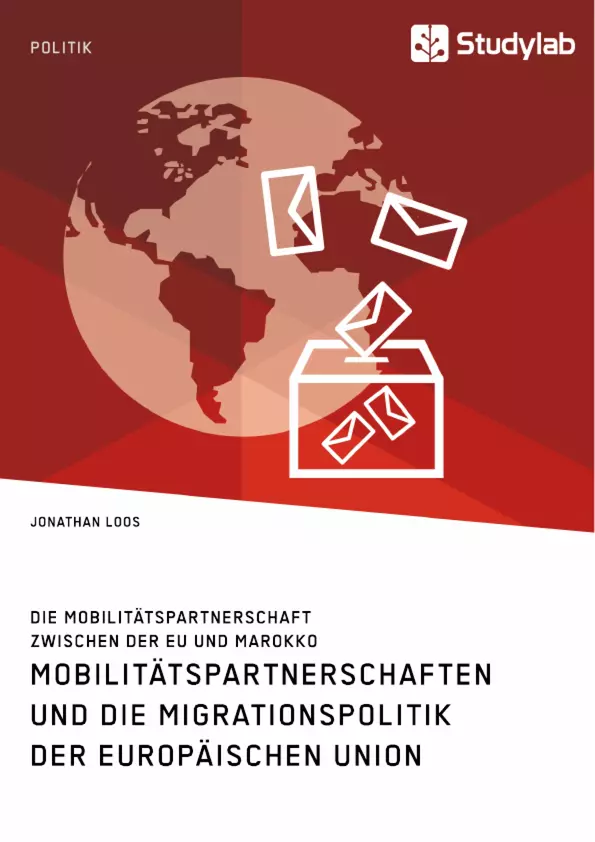Im Verlauf des Jahres 2016 hat sich die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union zunehmend handlungsunfähig gezeigt. Zu groß waren die Herausforderungen, die sich aus den internationalen Wanderungsbewegungen ergaben. Und zu groß waren auch die Differenzen zwischen den Mitgliedsstaaten.
Um zukünftig chaotischen Zuständen vorzubeugen, bedarf es gemeinsamer europäischer Regelungen. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Kooperation mit Herkunfts- und Transitländern. Doch wie kann die EU ihre Konflikte um die migrationspolitische Ausrichtung lösen? Jonathan Loos stellt in seiner Publikation die sogenannten Mobilitätspartnerschaften vor.
Dabei handelt es sich um ein flexibles Instrument für die Zusammenarbeit mit Drittstaaten. Es verbindet so entwicklungspolitische Ziele mit migrationspolitischen Maßnahmen. Loos erklärt, wie die EU in der Migrationspolitik agiert und setzt sich mit den Zielen und Problembereichen von Mobilitätspartnerschaften auseinander.
Aus dem Inhalt:
- EU-Außengrenze;
- Flüchtlingskrise;
- Zuwanderung;
- Immigration;
- Marokko
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Politiktheoretische Einordnung
- Konzeptionelle Grundlagen der EU-Migrationspolitik
- Migration als steuerbares Element im europäischen Kontext
- Europäisierung der Migrationspolitik
- Migrationsmanagement als neue Politikstrategie
- Externalisierung der EU-Migrationspolitik
- Der Gesamtansatz für Migration und Mobilität als Strategiepapier eines umfassenden Migrationsmanagements
- Die EU-Migrationspolitik als ambivalenter Entwicklungsprozess
- Mobilitätspartnerschaften als Instrument der EU-Migrationspolitik
- Form der Mobilitätspartnerschaften
- Triple-Win-Ansatz als umfassende Zielsetzung
- Verpflichtungen seitens der EU
- Verpflichtungen seitens der Drittstaaten
- Die Mobilitätspartnerschaft als Kooperationsmaschine
- Politikfeldvernetzung als Schlüssel zur Kooperation
- Problembereiche
- Partnerschaftskonzept als Leerformel?
- Unklare politische Ziele seitens der europäischen Partner
- Inhaltliche Flexibilität - auch ein Schwachpunkt?
- Objektivierung von Migranten
- Fehlende legale Zugangswege
- Defizite bei Koordination, Monitoring und Evaluierung
- Realpolitik statt ausgewogenem Migrationsmanagement
- Mobilitätspartnerschaften in der Praxis - Fallstudie am Beispiel Marokkos
- Fallstudie als passgenaue Methode
- Die besondere Stellung Marokkos in der EU-Migrationspolitik
- Die Mobilitätspartnerschaft zwischen der EU und Marokko
- Inhaltliche Prioritäten und konkrete Projekte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Instrument der Mobilitätspartnerschaften im Kontext der EU-Migrationspolitik. Dabei werden die konzeptionellen Grundlagen und die politischen Ziele dieser Partnerschaften analysiert und anhand der Fallstudie der EU-Marokko-Mobilitätspartnerschaft konkret beleuchtet.
- Die EU-Migrationspolitik als Reaktion auf gestiegene Migrationsbewegungen
- Mobilitätspartnerschaften als Instrument der EU-Migrationspolitik
- Kritik an den Mobilitätspartnerschaften als Instrument der Externalisierung
- Die EU-Marokko-Mobilitätspartnerschaft als Fallbeispiel
- Menschenrechtliche und politische Herausforderungen der Mobilitätspartnerschaften
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Das Kapitel skizziert die aktuelle Situation der EU-Migrationspolitik und die Notwendigkeit flexibler Instrumente zur Kooperation mit Drittstaaten.
- Politiktheoretische Einordnung: Dieses Kapitel ordnet Mobilitätspartnerschaften in den Kontext relevanter politischer Theorien ein und analysiert die dahinterstehenden Konzepte.
- Konzeptionelle Grundlagen der EU-Migrationspolitik: Das Kapitel beleuchtet die Entwicklung der EU-Migrationspolitik und analysiert verschiedene Aspekte wie die Europäisierung, das Migrationsmanagement und die Externalisierung.
- Mobilitätspartnerschaften als Instrument der EU-Migrationspolitik: Dieses Kapitel untersucht die Funktionsweise der Mobilitätspartnerschaften, ihre Ziele und die jeweiligen Verpflichtungen der beteiligten Akteure.
- Problembereiche: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Kritikpunkte an den Mobilitätspartnerschaften und diskutiert die damit verbundenen Herausforderungen.
- Mobilitätspartnerschaften in der Praxis - Fallstudie am Beispiel Marokkos: Das Kapitel stellt die Fallstudie der EU-Marokko-Mobilitätspartnerschaft vor und analysiert deren konkrete Umsetzung und Auswirkungen.
Schlüsselwörter
EU-Migrationspolitik, Mobilitätspartnerschaften, Externalisierung, Migrationsmanagement, Drittstaaten, Kooperation, Fallstudie, Marokko, Menschenrechte, Grenzmanagement.
Häufig gestellte Fragen
Was sind EU-Mobilitätspartnerschaften?
Es sind flexible, rechtlich nicht bindende Abkommen zwischen der EU und Drittstaaten, die eine Zusammenarbeit in Bereichen wie legale Migration, Bekämpfung illegaler Einwanderung und Entwicklungshilfe regeln.
Was ist der „Triple-Win-Ansatz“?
Dieser Ansatz strebt einen Nutzen für drei Parteien an: das Herkunftsland (Entwicklung), das Zielland (Arbeitskräfte) und die Migranten selbst (legale Wege und Schutz).
Warum ist Marokko ein wichtiger Partner für die EU?
Marokko ist sowohl Herkunfts- als auch ein zentrales Transitland für Migration nach Europa. Die Mobilitätspartnerschaft soll helfen, die Migrationsströme an der EU-Außengrenze besser zu steuern.
Was wird an Mobilitätspartnerschaften kritisiert?
Kritiker bemängeln eine einseitige Fokussierung auf Grenzsicherung (Externalisierung), fehlende legale Zugangswege für Geringqualifizierte und Defizite beim Schutz der Menschenrechte.
Was bedeutet „Externalisierung der Migrationspolitik“?
Damit ist die Verlagerung der Migrationskontrolle in Staaten außerhalb der EU gemeint, um Migranten bereits vor Erreichen der europäischen Grenzen aufzuhalten.
- Quote paper
- Jonathan Loos (Author), 2019, Mobilitätspartnerschaften und die Migrationspolitik der Europäischen Union. Die Mobilitätspartnerschaft zwischen der EU und Marokko, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/471300