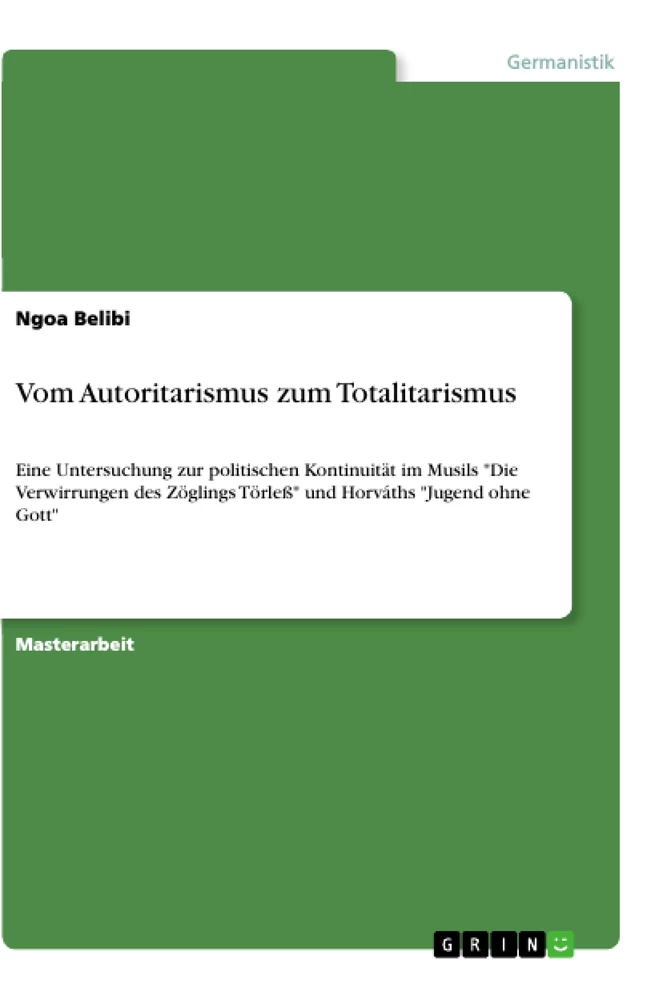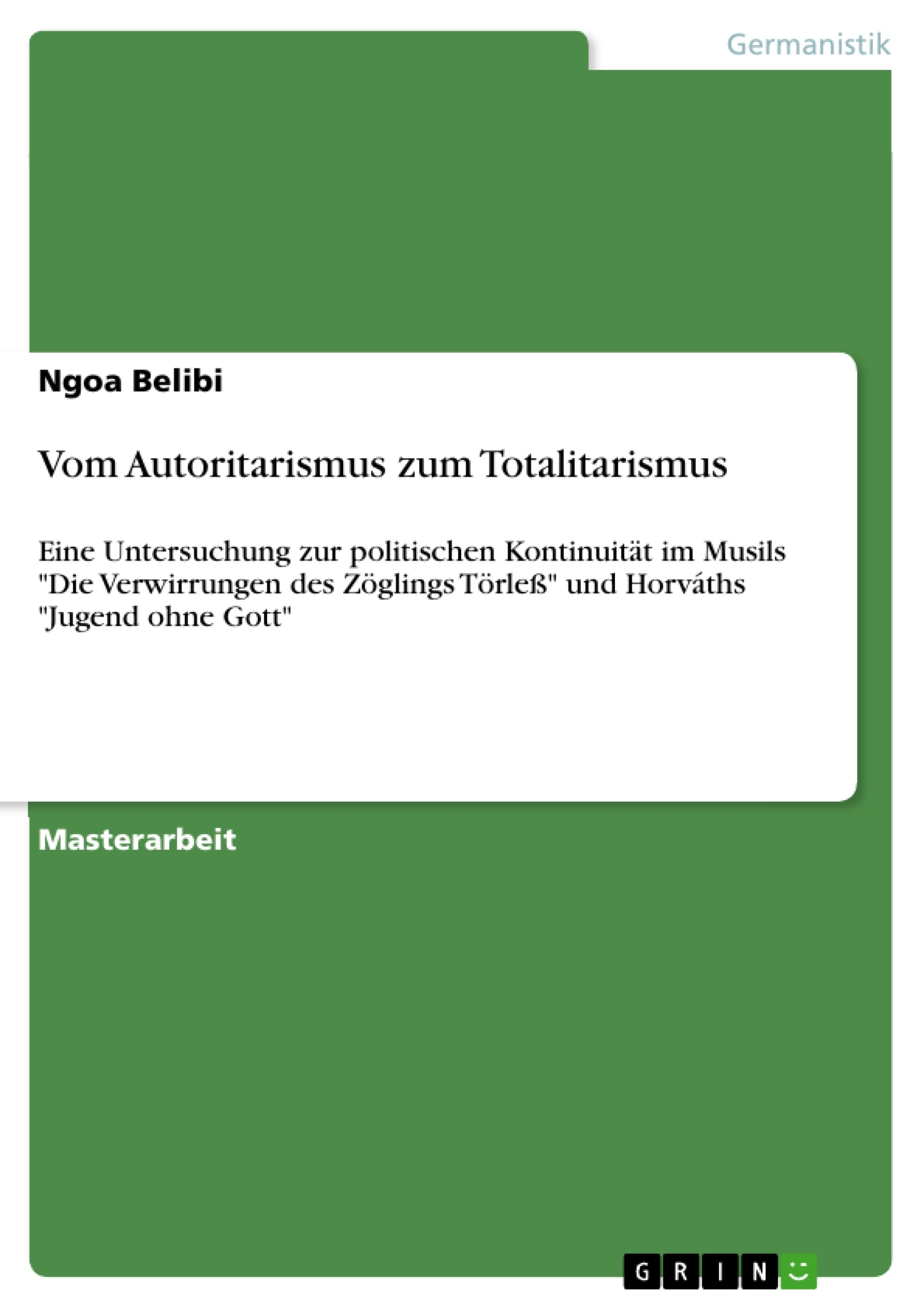Das Thema der vorliegenden Arbeit bringt zwei Gegenstände ans Licht: Es geht um Literatur und Gesellschaft. Beide bleiben eng miteinander verbunden. In diesem Zusammenhang analysiere ich, wie die Literatur die Politik vorzeigt. Darüber hinaus erkläre ich, wie sich die Politik von einem Zeitraum zu einem anderen verändert, wenn die Gesellschaft dynamisch bleibt. Konkreter gesagt, befasst sich meine Analyse mit jener Politik, die Europa am Anfang des 20. Jahrhunderts erlebt hat: es geht um Totalitarismus. Es wird also literarisch dargestellt, wie der Autoritarismus, den Boden zum Totalitarismus vorbereitet hat. Ich untersuche die Art und Weise, wie die Literatur als geistige Produktion durch eigene Stilmittel den Autoritarismus der Donaumonarchie und den Totalitarismus des Dritten Reiches verarbeitet. Ich hebe hervor, dass diese jeweiligen erwähnten Staaten in verschiedenen Zeiträumen existiert haben. Die Romane von zwei deutschsprachigen Schriftstellern werden mir helfen, ihre jeweiligen politischen Systeme zu untersuchen. Diese Kunstwerke sind Robert Musils Die Verwirrungen des Zöglings Törleß1(1906) und Ödön von Horváth Jugend ohne Gott2 (1937). Deshalb lautet mein Thema Vom Autoritarismus zum Totalitarismus: eine Untersuchung zur politischen Kontinuität in Musils Die Verwirrungen des Zöglings Törleß und Horváths Jugend ohne Gott.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Fragestellung und Zielsetzung
- Methodik
- Relevanz der Thematik
- Theoretischer Rahmen
- Autoritarismus und Totalitarismus
- Die Rolle der Literatur
- Analyse
- Musils ,,Die Verwirrungen des Zöglings Törleß"
- Die Schulgemeinschaft als autoritäres System
- Die Figur des Törleß als Spiegel der Gesellschaft
- Horváths ,,Jugend ohne Gott"
- Die totalitäre Gesellschaft
- Die Rolle der Ideologie
- Der Verlust der Individualität
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die politische Kontinuität vom Autoritarismus zum Totalitarismus anhand von Robert Musils ,,Die Verwirrungen des Zöglings Törleß" und Ödön von Horváths ,,Jugend ohne Gott". Das Ziel ist es, zu zeigen, wie diese beiden Romane die politischen und gesellschaftlichen Veränderungen in Österreich und Deutschland im frühen 20. Jahrhundert widerspiegeln.
- Die Entstehung und Entwicklung von autoritären und totalitären Systemen
- Die Folgen von politischer Unterdrückung für den Einzelnen
- Die Rolle der Literatur als Spiegel und Kritik der Gesellschaft
- Die Bedeutung der Individualität und der Freiheit
- Die Kontinuität von autoritären Tendenzen in der Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Fragestellung sowie die Zielsetzung der Arbeit vor. Es werden die Methodik und die Relevanz der Thematik erläutert.
Im theoretischen Rahmen werden die Konzepte von Autoritarismus und Totalitarismus definiert und die Rolle der Literatur in der Gesellschaft beleuchtet.
Die Analyse befasst sich mit den beiden Romanen, wobei die Kapitel getrennt die jeweiligen Werke betrachten. Musils ,,Die Verwirrungen des Zöglings Törleß" wird als Darstellung einer autoritären Schulgemeinschaft analysiert, die die gesellschaftlichen Verhältnisse der Zeit widerspiegelt. In Bezug auf Horváths ,,Jugend ohne Gott" wird die totalitäre Gesellschaft des Dritten Reichs und die Folgen der Unterdrückung für den Einzelnen untersucht.
Schlüsselwörter
Autoritarismus, Totalitarismus, politische Kontinuität, Literatur, Robert Musil, Ödön von Horváth, ,,Die Verwirrungen des Zöglings Törleß", ,,Jugend ohne Gott", Gesellschaft, Individualität, Freiheit, Unterdrückung, Ideologie.
Häufig gestellte Fragen
Welche literarischen Werke werden in der Analyse verglichen?
Die Analyse basiert auf Robert Musils „Die Verwirrungen des Zöglings Törleß“ (1906) und Ödön von Horváths „Jugend ohne Gott“ (1937).
Was ist das Hauptthema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die politische Kontinuität und den Übergang vom Autoritarismus der Donaumonarchie zum Totalitarismus des Dritten Reiches.
Welche Rolle spielt die Literatur in dieser Untersuchung?
Die Literatur wird als Spiegel der Gesellschaft betrachtet, der politische Veränderungen und deren Auswirkungen auf das Individuum mittels stilistischer Mittel verarbeitet.
Was symbolisiert die Schulgemeinschaft in Musils Roman?
Die Schulgemeinschaft wird als ein autoritäres System analysiert, welches die gesellschaftlichen Machtstrukturen der damaligen Zeit widerspiegelt.
Was sind die Folgen der totalitären Ideologie in Horváths Werk?
Im Fokus stehen der Verlust der Individualität und die Folgen politischer Unterdrückung für die Freiheit des Einzelnen.
- Citar trabajo
- Ngoa Belibi (Autor), 2018, Vom Autoritarismus zum Totalitarismus, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/471591