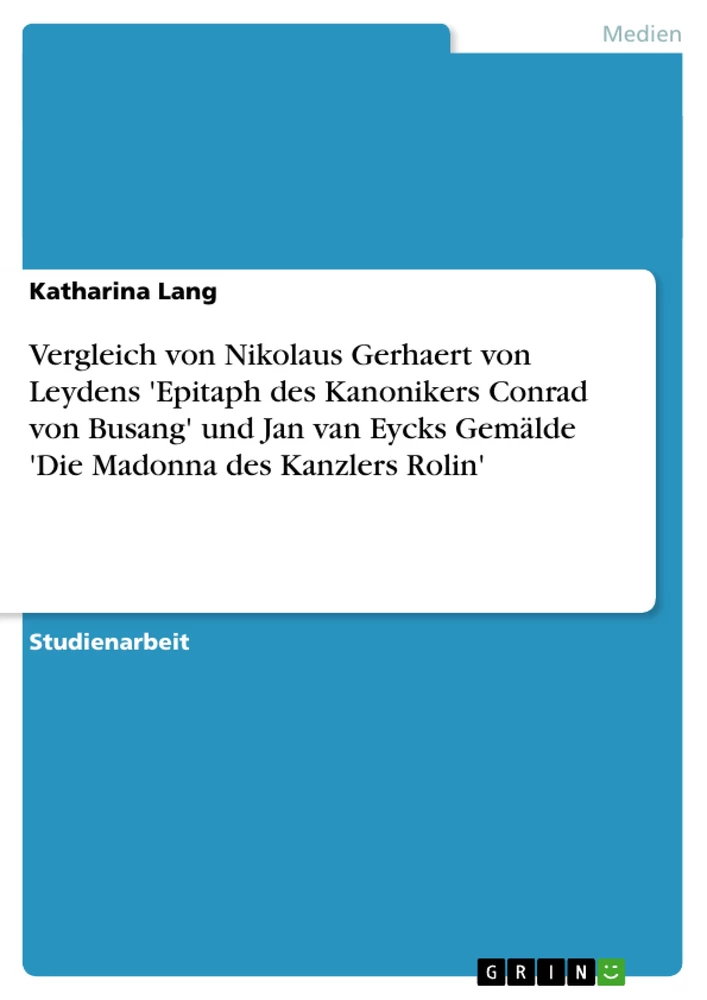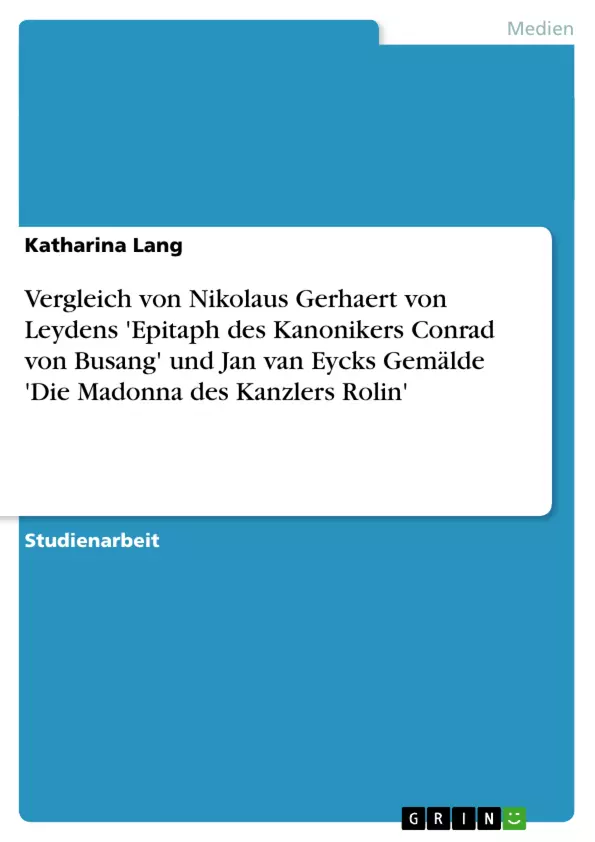Die um etwa 1130 aufkommende und erst im Nachhinein von dem italienischen Kunsttheoretiker Giorgio Vasari als solche titulierte Epoche der Gotik - für deren Namensfindung die barbarischen Goten Pate standen - wurde nach anfänglicher Verachtung umso stärker verehrt. 1 Die sich hauptsächlich auf Architektur und Plastik, aber auch auf die Malerei sowie das Kunsthandwerk auswirkende Stilepoche gilt als die unabhängigste der europäischen Kunstgeschichte seit der Antike. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf zwei Werken der Spätgotik, welche bis ins 16. Jahrhundert für die Kunst bestimmend war, jedoch erst seit dem 20. Jahrhundert als selbständige Stileinheit begriffen wird. 2 „Die Spätgotik lässt sich als der Raumstil bezeichnen, der, während er die letzten Konsequenzen aus dem klassischen gotischen System zieht, seiner Raumidee nach schon die Renaissance in sich trägt.“ 3 Die vorliegende Arbeit thematisiert einen Werkvergleich von Nikolaus Gerhaert von Leydens Epitaph des Kanonikers Conrad von Busang mit Jan van Eycks Madonna des Kanzlers Rolin. Über den, als Bahnbrecher des spätgotischen Stils in der deutschen Plastik geltenden 4 Nikolaus Gerhaert von Leyden ist aufgrund mangelnder Überlieferung sowie seines nur fragmentarisch erhaltenen Œuvres kaum etwas bekannt. 5 So ist weder die Frage bezüglich seines tatsächlichen Namens oder seines Geburtsjahres, noch die seiner Herkunft - Holland oder Deutschland -geklärt. Einzig die letzten elf Jahre bis zum Tode des 1473 verstorbenen größten Bildhauers des 15. Jahrhunderts nördlich der Alpen 6 finden in der Literatur Erwähnung. 7 Anregungen für die Kunst Nikolaus Gerhaerts lieferte die französische Skulptur, die ihrerseits im 15. Jahrhundert an der niederländischen Malerei orientiert war. 8 Als größter niederländischer Maler dieser Zeit 9 und zugleich Begründer der spätgotischen Malerei gilt Jan van Eyck, der für die Malerei nördlich der Alpen jene
Bedeutung beanspruchen darf, die Masaccio für die italienische Malerei zukommt. 10 Der flämische Maler, der 1391 vermutlich in Maaseyck bei Maastricht zur Welt gekommen ist, 11 überwand mit seiner Kunst die Sichtweise des Mittelalters 12 und lehrte „den abendländischen Menschen sehen“ 13 . [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorikonographie, Ikonographie und Ikonologie
- Nikolaus Gerhaert von Leyden: Epitaph des Kanonikers Conrad von Busang
- Jan van Eyck: Die Madonna des Kanzlers Rolin
- Werkvergleich
- Der Aspekt der Kommunikation
- Göttliches vs. Weltliches
- Resümee
- Abbildungsnachweise
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, einen Werkvergleich zwischen Nikolaus Gerhaerts Epitaph des Kanonikers Conrad von Busang und Jan van Eycks Madonna des Kanzlers Rolin durchzuführen. Die Analyse konzentriert sich auf die Spätgotik und untersucht die künstlerischen Besonderheiten beider Werke im Kontext ihrer jeweiligen Stilepoche.
- Vergleich der künstlerischen Stile von Nikolaus Gerhaert und Jan van Eyck
- Analyse der ikonographischen Elemente beider Werke
- Untersuchung des Aspekts der Kommunikation in den Kunstwerken
- Erörterung des Verhältnisses von Göttlichem und Weltlichem in den Darstellungen
- Einordnung der Werke in den Kontext der spätgotischen Kunst
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Epoche der Gotik ein und betont deren Bedeutung für die europäische Kunstgeschichte. Sie beschreibt den Fokus der Arbeit auf einen Werkvergleich zwischen zwei Werken der Spätgotik: Nikolaus Gerhaerts Epitaph des Kanonikers Conrad von Busang und Jan van Eycks Madonna des Kanzlers Rolin. Die Einleitung hebt die Bedeutung beider Künstler und die Herausforderungen aufgrund von fehlenden Informationen über Gerhaerts Leben und Werk hervor. Sie skizziert den weiteren Aufbau der Arbeit, der sich mit Vorikonographie, Ikonographie, Ikonologie und einem detaillierten Werkvergleich beschäftigt. Die Einleitung stellt den Kontext für die Analyse bereit und verdeutlicht den Anspruch der Arbeit, die beiden Werke in ihrer jeweiligen künstlerischen und historischen Bedeutung zu beleuchten.
Vorikonographie, Ikonographie und Ikonologie: Dieses Kapitel behandelt die detaillierte Beschreibung und Analyse von Nikolaus Gerhaerts Epitaph des Kanonikers Conrad von Busang und Jan van Eycks Madonna des Kanzlers Rolin. Es wird jeweils die Ikonographie und Ikonologie der Werke behandelt. Die detaillierte Beschreibung des Busang-Epitaphs umfasst die drei Figuren (Frau, Kind, Mann), ihre Kleidung, Körperhaltung und deren symbolische Bedeutung. Die Analyse betont die Interaktion der Figuren und deren räumliche Anordnung. Für die Madonna des Kanzlers Rolin wird auf die ikonographischen Aspekte eingegangen und deren Bedeutung im Kontext der religiösen und gesellschaftlichen Verhältnisse der Zeit erörtert. Das Kapitel legt die Grundlage für den folgenden Werkvergleich, indem es die einzelnen Elemente der Kunstwerke minutiös beschreibt und analysiert.
Schlüsselwörter
Spätgotik, Nikolaus Gerhaert von Leyden, Jan van Eyck, Epitaph, Madonna, Werkvergleich, Ikonographie, Ikonologie, Kommunikation, Göttliches, Weltliches, deutsche Plastik, niederländische Malerei.
Häufig gestellte Fragen (FAQ): Werkvergleich: Nikolaus Gerhaerts Epitaph und Jan van Eycks Madonna
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit führt einen detaillierten Werkvergleich zwischen Nikolaus Gerhaerts Epitaph des Kanonikers Conrad von Busang und Jan van Eycks Madonna des Kanzlers Rolin durch. Der Fokus liegt auf der Spätgotik und den künstlerischen Besonderheiten beider Werke im Kontext ihrer jeweiligen Stilepoche.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Vorikonographie, Ikonographie und Ikonologie beider Kunstwerke. Sie vergleicht die künstlerischen Stile von Gerhaert und van Eyck, analysiert ikonographische Elemente, untersucht die Aspekte der Kommunikation in den Werken und erörtert das Verhältnis von Göttlichem und Weltlichem in den Darstellungen. Die Einordnung der Werke in den Kontext der spätgotischen Kunst ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Vorikonographie, Ikonographie und Ikonologie (mit detaillierten Analysen des Epitaphs und der Madonna), ein Kapitel zum Werkvergleich (einschließlich der Aspekte Kommunikation und Göttliches vs. Weltliches), ein Resümee, Abbildungsnachweise und ein Literaturverzeichnis.
Wie werden die Kunstwerke analysiert?
Die Analyse beinhaltet eine detaillierte Beschreibung der Figuren, ihrer Kleidung, Körperhaltung und symbolischen Bedeutung (am Beispiel des Epitaphs: Frau, Kind, Mann). Die räumliche Anordnung und Interaktion der Figuren werden ebenso berücksichtigt wie die ikonographischen Aspekte und ihre Bedeutung im gesellschaftlichen und religiösen Kontext der jeweiligen Entstehungszeit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Spätgotik, Nikolaus Gerhaert von Leyden, Jan van Eyck, Epitaph, Madonna, Werkvergleich, Ikonographie, Ikonologie, Kommunikation, Göttliches, Weltliches, deutsche Plastik, niederländische Malerei.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist ein fundierter Vergleich der beiden Kunstwerke, um ihre künstlerischen Besonderheiten und ihre Bedeutung innerhalb der spätgotischen Kunst aufzuzeigen. Die Arbeit berücksichtigt die Herausforderungen, die sich aus den fehlenden Informationen über Gerhaerts Leben und Werk ergeben.
Welche Aspekte des Werkvergleichs werden besonders hervorgehoben?
Der Werkvergleich konzentriert sich insbesondere auf die künstlerischen Stile, die ikonographischen Elemente, die Aspekte der Kommunikation innerhalb der Kunstwerke und die Darstellung des Verhältnisses von Göttlichem und Weltlichem.
- Citar trabajo
- Katharina Lang (Autor), 2004, Vergleich von Nikolaus Gerhaert von Leydens 'Epitaph des Kanonikers Conrad von Busang' und Jan van Eycks Gemälde 'Die Madonna des Kanzlers Rolin', Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47720