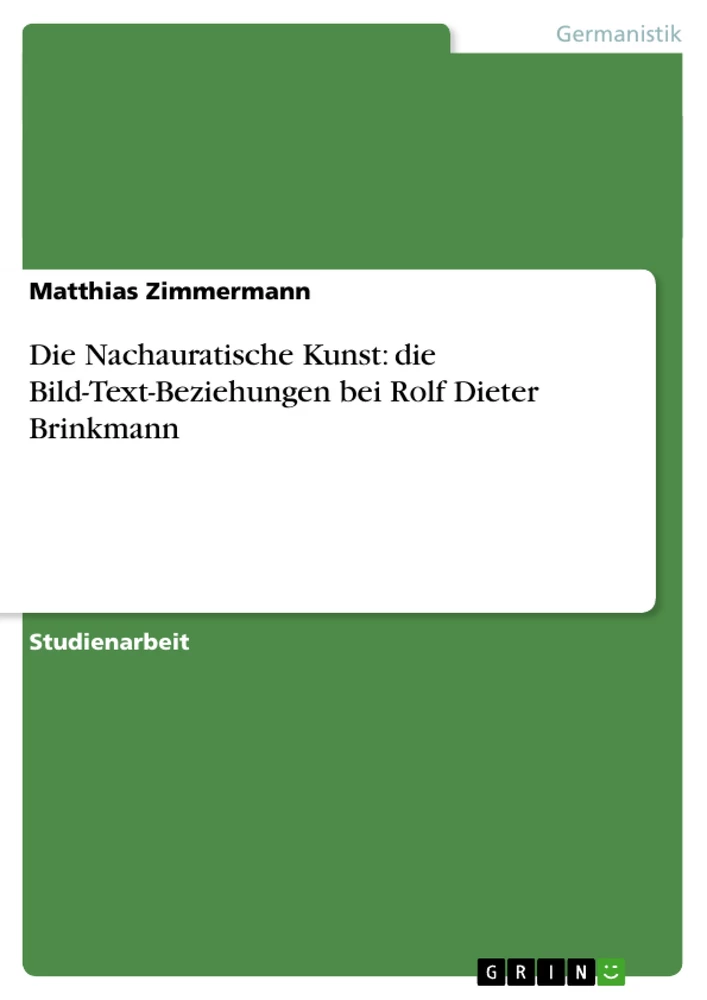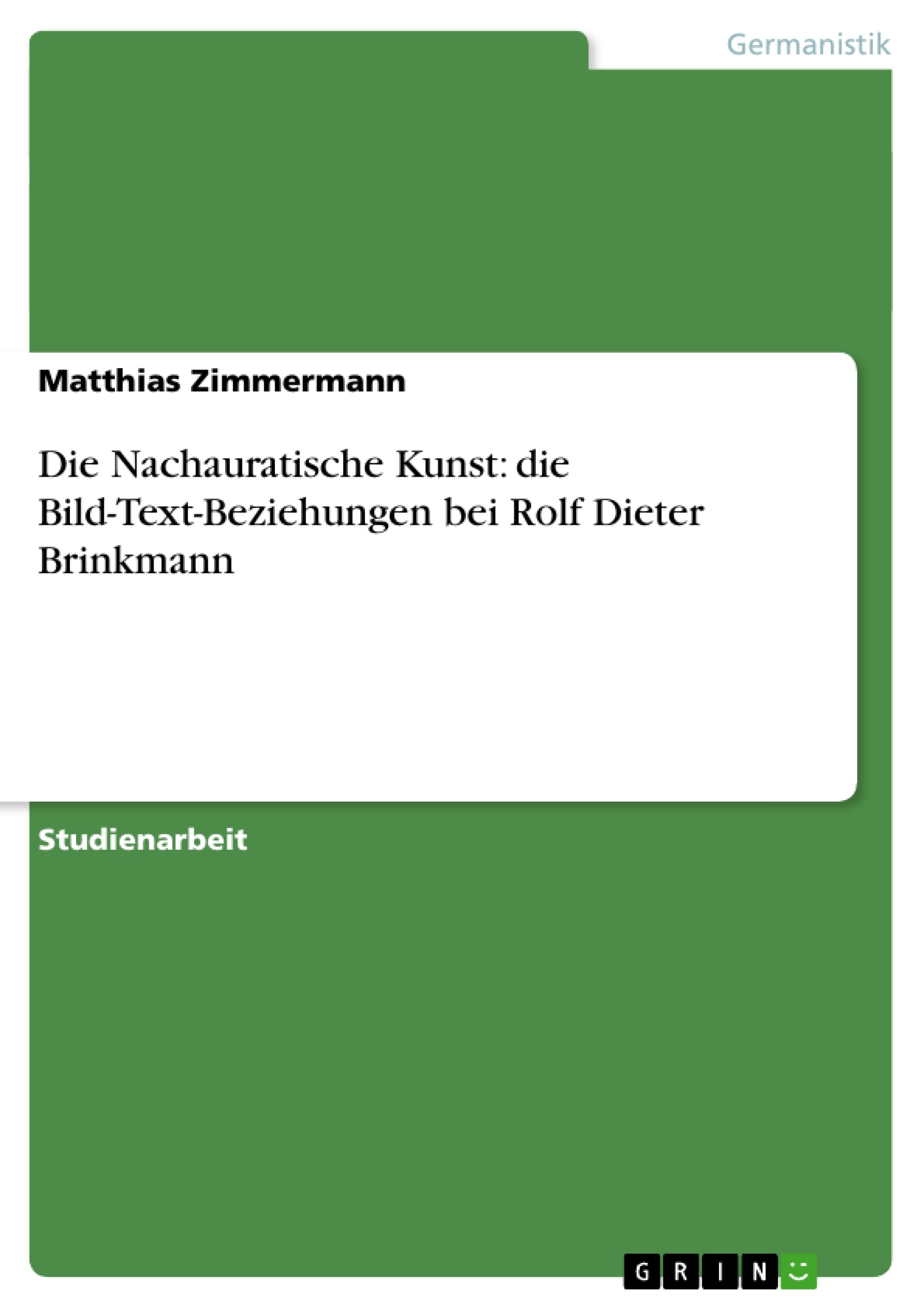Diese Arbeit wäre wohl zu beginnen mit einem Satz wie diesem: Kaum ein Schriftsteller ist derart umstritten, wie Rolf Dieter Brinkmann, die Spanne der Kritiken reicht von (...) bis zu (...). Was jedoch wirklich der Fall ist, steht in solchen Zitaten nicht. Daher sei an dieser Stelle gesagt, dass sich das Werk von Rolf Dieter Brinkmann zu großen Teilen jeglicher Interpretation entzieht. Zum einen strebt er eine Literatur an, die durch ihre Form umsetzt, was sie zu zeigen versucht – eine neue, der veränderten Wahrnehmung adäquate Kunst, die sich althergebrachten, im Besonderen reflexiven Rezeptionsmustern widersetzt. Zum anderen hat er sich früh ausdrücklich vom organisierten Literaturbetrieb distanziert, vor allem, weil dieser Anfang der 60er Jahre zwar wie er ein sprachkritisches Programm vertrat, in dessen Ausführung – seiner Meinung nach – dann aber doch wieder in tradierte Formen zurückfiel und somit seiner eigenen Aufgabe nicht gerecht wurde, sich in ihr jedoch gefiel. Eine Opposition zu bisherigen literarischen Positionen wollten sie alle sein, doch Brinkmann bezog selbst zu ihnen noch eine Außenseiterstellung. Im Folgenden soll gezeigt werden, warum und wie RDB, durch innere Zwänge getrieben, der Ausdrucksfähigkeit von Sprache misstrauend, mehr und mehr dazu übergeht, ihre Form zu erweitern – den materiellen Aspekt von Schrift zu betonen, Bilder und Text zu kombinieren um sie schließlich soweit einander anzunähern, dass sie nicht nur nicht mehr zu trennen sind, sondern, dass scheinbar Schrift und Bild ihre Wirkungsweisen vertauschen (oder zumindest die jeweils andere negieren). Schreiben wird zum Selbstzweck, der Inhalt verkümmert, wird magere, geduldete Randerscheinung, die der gesuchten Form notwendiges Spielmaterial liefert, oder wird gar ganz zerhackt um nicht abzulenken. Diese Form des Schreibens wird besonders in den im Titel aufgeführten Bänden deutlich, die erst nach Brinkmanns Tod erscheinen. Dies zu zeigen, wird im kurzen, zweiten Teil versucht werden. Im abschließenden Fazit soll die These gestützt werden, dass diese Vorstellung und Umsetzung von Literatur und Kunst der von Walter Benjamin in seinem Aufsatz „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ beschriebenen entauratisierten Kunst nahe kommt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Mann ohne Worte
- II. Der Aufbruch ins Ende - Oder das Ende des Aufbruchs (? )
- III. Schnitt
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Werk von Rolf Dieter Brinkmann, mit besonderem Fokus auf seine späten Materialbände "Schnitte" und "Rom, Blicke". Sie untersucht, wie Brinkmann durch innere Zwänge getrieben, Sprache und Form in seinen Werken erweitert, um eine neue, der veränderten Wahrnehmung adäquate Kunst zu schaffen.
- Brinkmanns Distanzierung vom organisierten Literaturbetrieb und seine Kritik an traditionellen Rezeptionsmustern
- Brinkmanns Entwicklung einer neuen Kunstform, die Schrift und Bild miteinander verbindet und traditionelle Grenzen verschmilzt
- Die Nähe von Brinkmanns Kunstkonzept zu Walter Benjamins Thesen über das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit
- Die Rolle des Inhalts im Werk von Brinkmann und seine Verlagerung in den Hintergrund zugunsten der Form
- Brinkmanns Experimente mit verschiedenen Medien wie Hörspiel, Film und Malerei
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt Rolf Dieter Brinkmann als umstrittenen Schriftsteller vor, der sich jeder eindeutigen Interpretation entzieht. Sie beschreibt die Herausforderungen, die sich bei der Analyse seines Werkes stellen, und legt den Fokus auf seine Kritik an traditioneller Literatur und seine Suche nach neuen Ausdrucksformen.
- I. Mann ohne Worte: Dieses Kapitel beleuchtet Brinkmanns Sprachkritik und seinen Wunsch, eine Kunstform zu entwickeln, die sich den herkömmlichen, reflexiven Rezeptionsmustern widersetzt. Es werden seine frühen Werke und seine Distanzierung vom organisierten Literaturbetrieb beleuchtet.
- II. Der Aufbruch ins Ende - Oder das Ende des Aufbruchs (?): Dieses Kapitel setzt sich mit Brinkmanns Entwicklung einer neuen Kunstform auseinander, die Schrift und Bild miteinander verbindet und traditionelle Grenzen verschmilzt. Es beleuchtet die Rolle des Inhalts im Werk von Brinkmann und seine Verlagerung in den Hintergrund zugunsten der Form.
- III. Schnitt: Dieses Kapitel analysiert die Materialbände "Schnitte" und "Rom, Blicke" und untersucht, wie Brinkmann in diesen Werken seine experimentellen Ansätze konsequent verfolgt. Es werden die formalen Aspekte seiner Werke und die Bedeutung des Bildes in seiner Kunst hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Rolf Dieter Brinkmann, Nachauratische Kunst, Bild-Text-Beziehungen, Materialbände, "Schnitte", "Rom, Blicke", Walter Benjamin, "Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit", Sprachkritik, Form, Inhalt, Rezeption, Kunst, Literatur, Sprache, Malerei, Film, Hörspiel.
- Arbeit zitieren
- Matthias Zimmermann (Autor:in), 2001, Die Nachauratische Kunst: die Bild-Text-Beziehungen bei Rolf Dieter Brinkmann, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47793