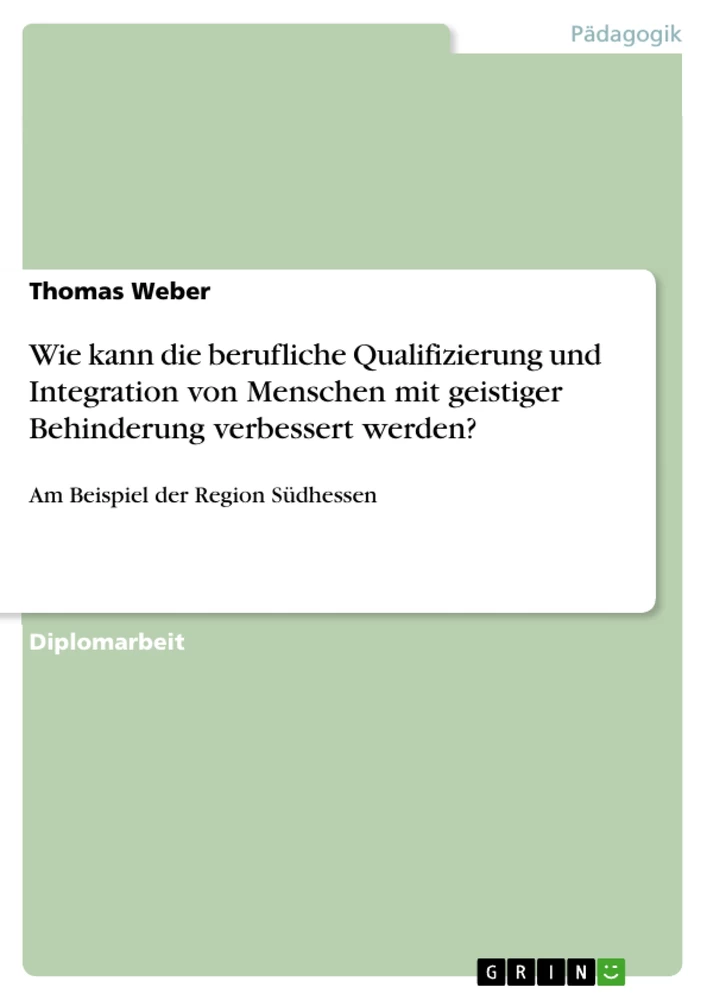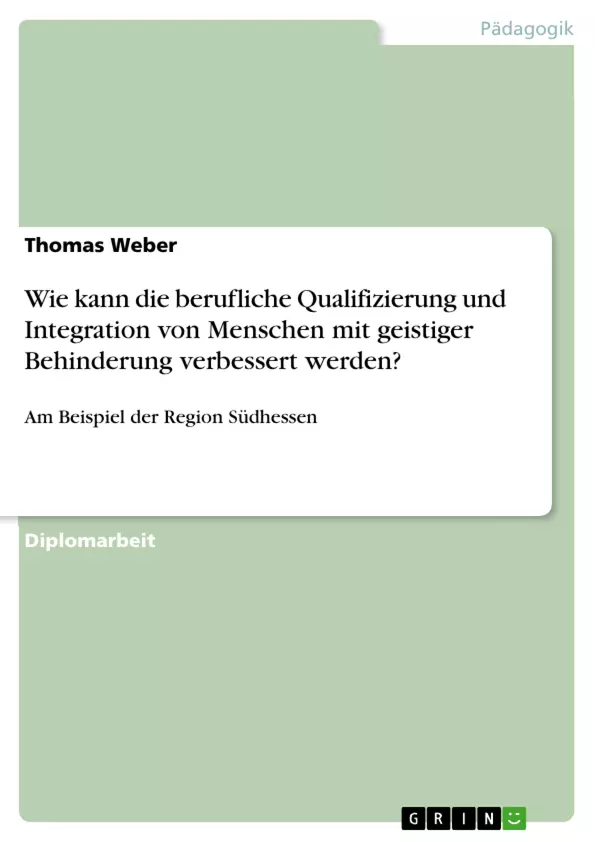Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit.
Mit dem Phänomen „Behinderung“ bin ich als Sohn einer von Geburt an körperlich beeinträchtigten Mutter bereits in alltäglicher Normalität aufgewachsen.
Wie schwierig es ist, als Mensch mit Beeinträchtigungen einen Arbeitsplatz1 zu finden, musste unsere Familie schmerzlich erfahren, als sich meine Mutter nach „Kinderpause“ trotz abgeschlossener Berufsausbildung lange vergeblich um einen angemessenen Arbeitsplatz bemühte.
In meinem zwanzigmonatigen Zivildienst in einer Schule für Praktisch Bildbare konnte ich mein Interesse an der Förderung von Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen in angeleitete praktische Tätigkeit umsetzen. Dort lernte ich Regina ein charakterstarkes Mädchen mit geistigen Beeinträchtigungen kennen und ihre Mutter. Sie begleiten und prägen seither mein Leben.
In meinem Hochschulstudium in Heidelberg und Frankfurt beschäftigte ich mich u.a. besonders mit der Förderung und Integration von Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen.
Nachdem gemeinsame Vorschulerziehung und Grundschule von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen in den vergangenen Jahren ansatzweise im Bereich der Sekundarstufe fortgesetzt wurde, rückte für mich die Frage: „Was kommt nach der Schule? “ zunehmend in den Mittelpunkt des Interesses.
In Seminaren u.a bei Herrn Prof. Dr. Jacobs befasste ich mich intensiv mit der beruflichen Qualifizierung und Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen. Einen besonderen Schwerpunkt legte ich auf die didaktische und methodische Gestaltung der Übergangsphase von der Schule in die Arbeitswelt.
Um theoretische Erkenntnisse in praktisches Handeln umzusetzen, absolvierte ich ein halbjähriges Vollzeitpraktikum im Arbeitstrainingsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen. Dort erlebte ich täglich, wie institutionelle Vorgaben und daraus entstehende Zwänge pädagogische Handlungsfelder einschränken können.2
[...]
_____
[...]
1 Im Jahr 2000 waren in Deutschland 190.000, im Arbeitsamtbezirk Darmstadt 1726 sog. Schwerbehinderte arbeitslos, Quelle: BMA, Arbeitsamt Darmstadt.
2 Siehe dazu auch den ausführlichen Praktikumsbericht des Verfassers vom 11.10.2000
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Mensch mit geistiger Beeinträchtigung - Ein Überblick
- Definitionen und Begriffsklärungen
- Ursachen und Formen geistiger Beeinträchtigung
- Entwicklung und Förderung von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung
- Die Situation am Arbeitsmarkt
- Der Arbeitsmarkt in Deutschland
- Die Arbeitsbedingungen für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung
- Rechtliche Grundlagen und Fördermaßnahmen
- Möglichkeiten und Maßnahmen zur Verbesserung der beruflichen Qualifizierung und Integration von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung
- Der Berufsbildungsbereich in der Sonderschule
- Die Berufsbildungswerke
- Die Werkstätten für behinderte Menschen
- Der Integrationsfachdienst
- Die Rehaberatung
- Das Arbeitsamt
- Die Lebenshilfe
- Fallbeispiele
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Verbesserung der beruflichen Qualifizierung und Integration von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Sie analysiert die Herausforderungen und Chancen im Übergang von der Schule in die Arbeitswelt und stellt verschiedene Möglichkeiten und Maßnahmen vor, die die Integration dieser Personengruppe fördern.
- Die Bedeutung von Inklusion und Teilhabe am Arbeitsmarkt
- Die Herausforderungen bei der beruflichen Qualifizierung von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung
- Die Rolle von Bildungseinrichtungen und Unterstützungseinrichtungen
- Die Bedeutung von individuellen Fördermaßnahmen
- Die Perspektiven für die berufliche Integration von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Definition des Begriffs "geistige Beeinträchtigung" und stellt die verschiedenen Ursachen und Formen dieser Beeinträchtigung dar. Die Situation am Arbeitsmarkt für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung wird im zweiten Kapitel beleuchtet, wobei die rechtlichen Grundlagen und Fördermaßnahmen im Fokus stehen. Das dritte Kapitel widmet sich den verschiedenen Möglichkeiten und Maßnahmen, die die berufliche Qualifizierung und Integration von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung fördern. Hier werden unter anderem der Berufsbildungsbereich in der Sonderschule, die Berufsbildungswerke, die Werkstätten für behinderte Menschen, der Integrationsfachdienst, die Rehaberatung und das Arbeitsamt vorgestellt.
Das vierte Kapitel enthält Fallbeispiele, die die konkreten Herausforderungen und Chancen in der beruflichen Integration von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung aufzeigen.
Schlüsselwörter
Geistige Beeinträchtigung, Inklusion, Teilhabe, Berufsbildung, Integration, Arbeitsmarkt, Sonderschule, Berufsbildungswerk, Werkstätten für behinderte Menschen, Integrationsfachdienst, Rehaberatung, Arbeitsamt, Lebenshilfe.
Häufig gestellte Fragen
Wie kann die Integration von Menschen mit geistiger Behinderung verbessert werden?
Durch individuelle Fördermaßnahmen, eine bessere Vernetzung von Schulen und Arbeitswelt sowie den Einsatz von Integrationsfachdiensten.
Was ist die Rolle von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)?
WfbM bieten einen geschützten Raum zur beruflichen Bildung und Beschäftigung, stehen aber auch vor der Herausforderung, den Übergang auf den ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen.
Was sind Integrationsfachdienste?
Diese Dienste unterstützen Menschen mit Behinderung direkt bei der Suche nach Arbeitsplätzen und beraten Arbeitgeber bei der Einstellung und Integration.
Welche rechtlichen Grundlagen fördern die berufliche Teilhabe?
In Deutschland gibt es spezifische Gesetze und Förderprogramme der Arbeitsämter und Rentenversicherungen, die die berufliche Rehabilitation und Inklusion regeln.
Warum ist die Übergangsphase von der Schule in den Beruf so kritisch?
Hier entscheidet sich oft, ob ein junger Mensch mit Behinderung eine Perspektive auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erhält oder dauerhaft in Sondereinrichtungen verbleibt.
- Citation du texte
- Thomas Weber (Auteur), 2002, Wie kann die berufliche Qualifizierung und Integration von Menschen mit geistiger Behinderung verbessert werden?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4871