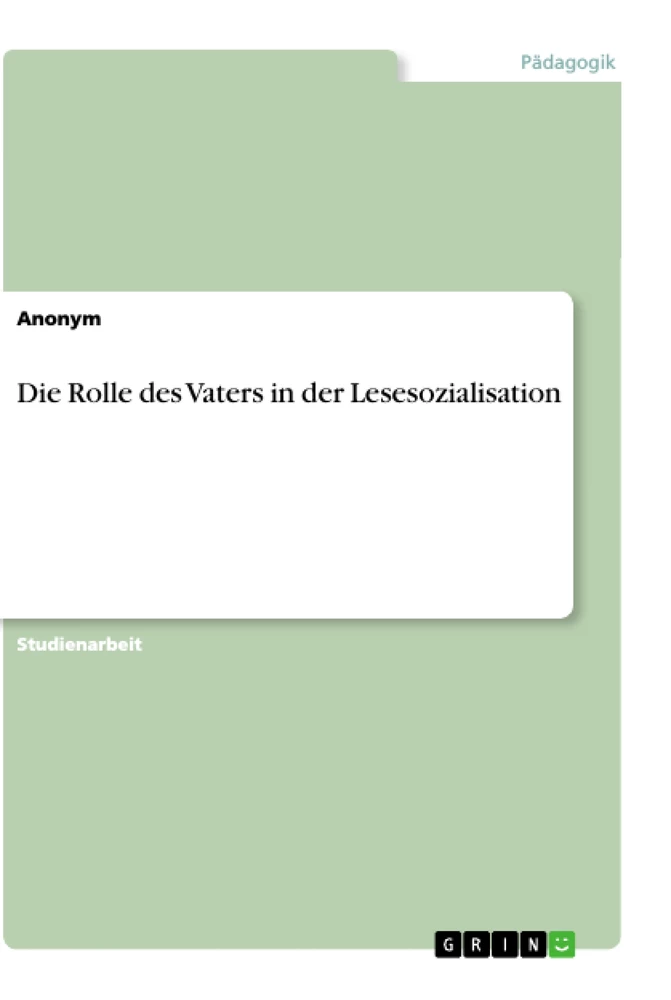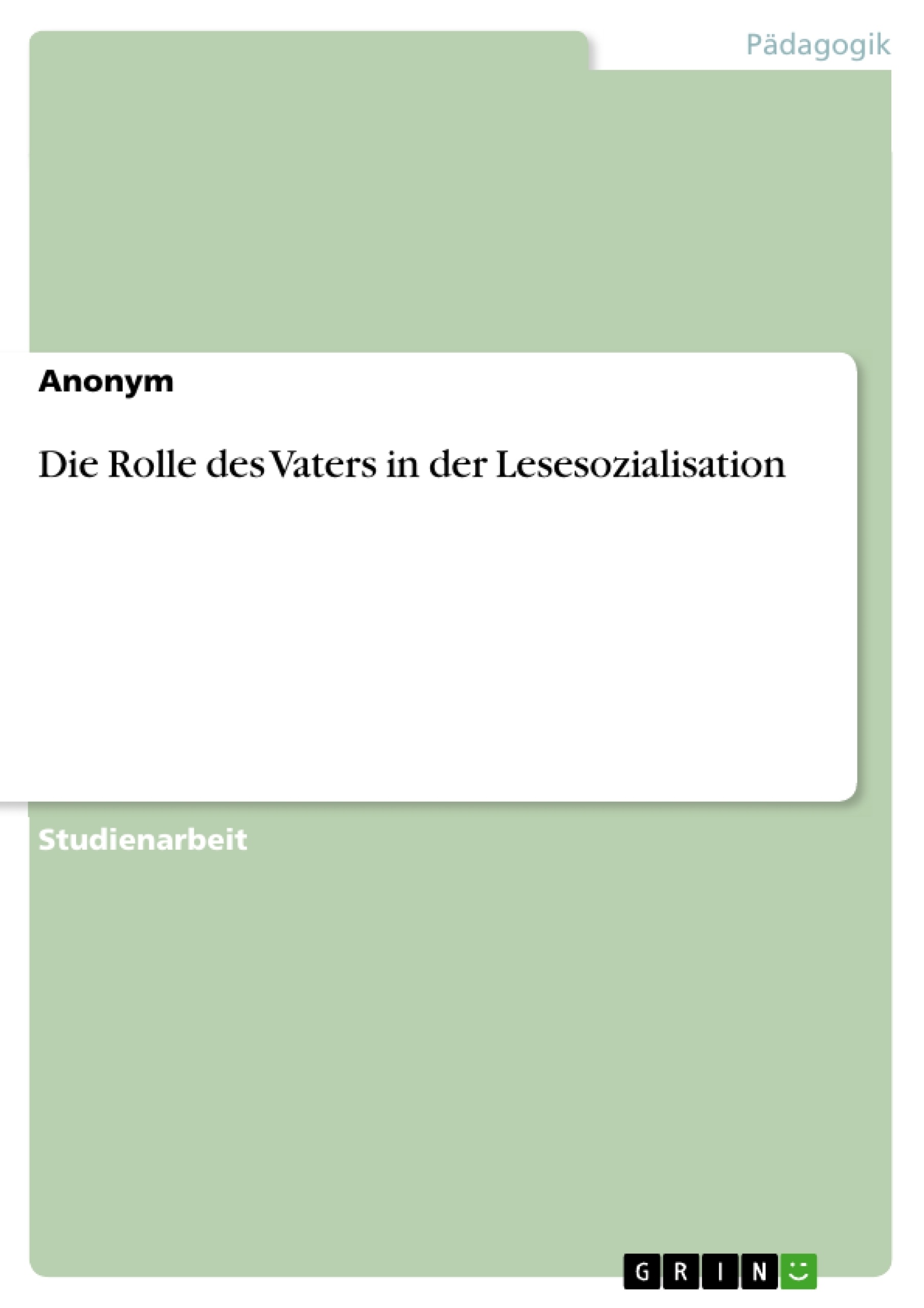Die Frage, die sich mir stellt, ist, warum das väterliche Vorlesen nur minimal vertreten ist. Diesbezüglich müssen Gründe ermittelt werden, weshalb sich Väter vom Vorlesen distanzieren, wenngleich sie diesem eine hohe Bedeutung zuschreiben. Genau diese Frage bewegte mich dazu, das entsprechende Thema gezielter zu untersuchen.
Eine Antwort darauf versuche ich - auch wenn Studien hierzu noch sehr limitiert sind - durch diese Seminararbeit zu finden. Es soll dabei zuerst ein grober Hintergrund über die Vorlesesituation in Deutschland geschaffen und im Anschluss erarbeitet werden, warum sich Väter diesbezüglich zurückhalten, welche Auswirkungen damit einhergehen und, wie man der Diskrepanz entgegenwirken könnte.
Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass der Großteil der Forschungsergebnisse, auf welche ich im Laufe der Arbeit zugreife, zum Teil noch hypothetisch sind beziehungsweise nur Orientierungsrichtungen geben. Das liegt daran, dass Kinder zum Beispiel bedingt durch Erinnerungsfehler und Eltern aufgrund von sozialer Erwünschtheit häufig verzerrte Antworten geben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Familie als wichtigste informelle Instanz im Rahmen der Lesesozialisation
- Einleitendes zum Vorlesen
- Die Bedeutung des Vorlesens
- Die Einstellung der Eltern zum Vorlesen
- Faktoren, die die Vorlesehäufigkeit bestimmen
- Vergleich der mütterlichen und väterlichen Vorleseart
- Die Rolle des Vaters in der Familie
- Väterliches Vorlesen
- Die Bedeutung und Auswirkungen des väterlichen (Nicht-) Vorlesens
- Warum Väter nicht vorlesen
- (Väter) Zum Vorlesen motivieren
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Rolle des väterlichen Vorlesens im Kontext der Lesesozialisation. Der Fokus liegt auf den Gründen, warum Väter trotz der hohen Bedeutung des Vorlesens für die Entwicklung ihrer Kinder, häufig nicht vorlesen. Die Arbeit analysiert die Ursachen für diese Diskrepanz und erarbeitet mögliche Lösungsansätze, um Väter zum Vorlesen zu motivieren.
- Bedeutung des Vorlesens für die Entwicklung von Kindern
- Gründe für die geringe Beteiligung von Vätern am Vorlesen
- Auswirkungen des (Nicht-) Vorlesens auf die Lesesozialisation
- Möglichkeiten zur Förderung des väterlichen Vorlesens
- Zusammenhang zwischen Lesekompetenz und familiärer Lesesozialisation
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt den Forschungsgegenstand der Arbeit dar: Die geringe Beteiligung von Vätern am Vorlesen trotz der hohen Bedeutung, die sie dem Vorlesen zuschreiben.
- Familie als wichtigste informelle Instanz im Rahmen der Lesesozialisation: Dieser Abschnitt beschreibt die Familie als wichtigen Faktor in der frühen Lesesozialisation und betont die Bedeutung der Leseatmosphäre, die Eltern und Geschwister schaffen.
- Einleitendes zum Vorlesen: Dieses Kapitel beleuchtet die Wichtigkeit des Vorlesens für die Entwicklung der Sprach- und Lesekompetenz von Kindern, sowie die Bedeutung von Interaktion während des Vorlesens.
- Die Rolle des Vaters in der Familie: Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Bedeutung des Vaters in der Familie im Hinblick auf die Lesesozialisation.
- Väterliches Vorlesen: In diesem Kapitel werden die Auswirkungen des (Nicht-) Vorlesens durch den Vater auf die Entwicklung des Kindes analysiert. Zudem werden Ursachen für die geringe Beteiligung von Vätern am Vorlesen betrachtet und Lösungsansätze aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Lesesozialisation, Väterliches Vorlesen, Familiäre Leseatmosphäre, Sprachentwicklung, Lesekompetenz und die Rolle des Vaters in der Familie. Die Bedeutung des Vorlesens für die kindliche Entwicklung und die Herausforderungen, Väter zum Vorlesen zu motivieren, stehen im Mittelpunkt der Analyse.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2015, Die Rolle des Vaters in der Lesesozialisation, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/489399