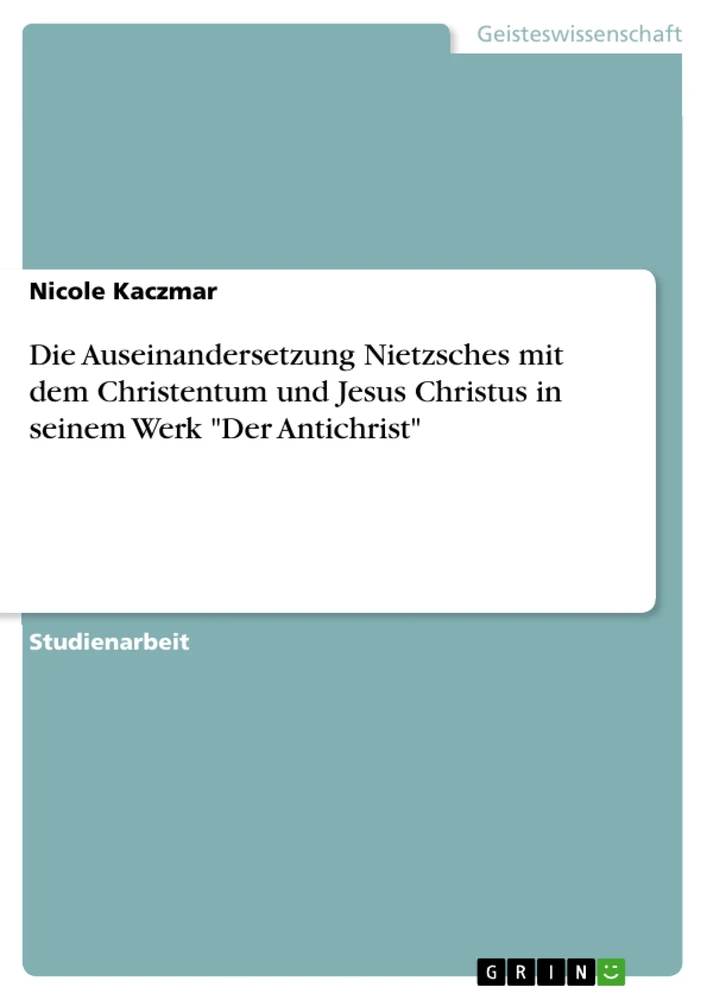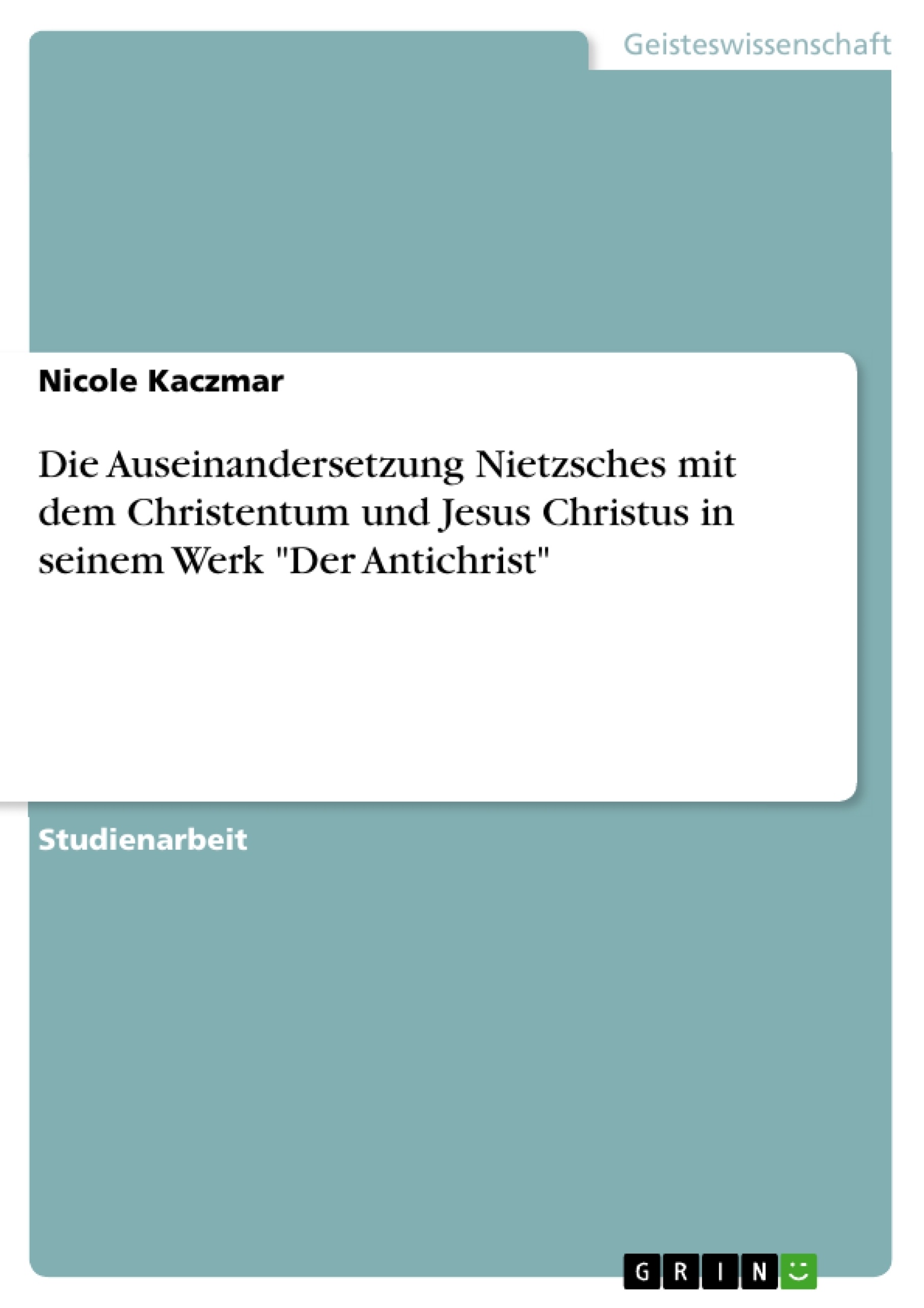"Der Antichrist – Versuch einer Kritik des Christentums" gehört zu den Spätwerken Nietzsches, welches er im Spätsommer/Herbst 1888 niedergeschrieben hat. Kurze Zeit später erlitt er Anfang 1889 einen geistigen Zusammenbruch. Das in seinem Umfang überschaubare Werk gliedert sich in 62 Kapitel. Die vorliegende Arbeit nimmt den zweiten Teil des Werkes "Der Antichrist" in den Fokus kritischer Analyse.
In den genannten Aphorismen erörtert Nietzsche seine Auseinandersetzung mit der Person Jesu Christi und dem Christentum. Hierbei ist zu bemerken, dass Nietzsche Sohn eines evangelischen Pfarrers war und ihm die biblischen Thematiken durchaus vertraut waren. Deshalb ist das vorliegende Werk auch als ernsthafter Versuch einer Kritik am Christentum anzusehen. Dennoch handelt es sich bei diesem Werk nicht um eine systematisch-theologische Auseinandersetzung mit der Person Jesu Christi und dem Christentum, vielmehr skizziert Nietzsche in sprachlicher Ausdruckskraft eine polemische Abrechnung mit dem Christentum. Unter Rückgriff auf einige seiner früheren Schriften bündelt er seine Kritik am Christentum, der er eine bisher nicht gekannte Schärfe gibt.
Inhaltsverzeichnis
- I. "Der Antichrist - Versuch einer Kritik des Christentums" von Friedrich Nietzsche
- II. Die Person Jesus Christus
- III. Das Christentum
- 3.1. Paulus als die Ursache der Fehlentwicklung des Christentums
- 3.2. Verkündung wider das Christentum (Sieben Sätze gegen das Christentum)
- IV. Diskussion, Zusammenfassung und Ausblick
- 4.1. Diskussion
- 4.2. Zusammenfassung
- 4.3. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht Nietzsche's Kritik am Christentum und seiner Interpretation der Person Jesu Christi, insbesondere im Kontext des zweiten Teils von „Der Antichrist“. Nietzsche's Ziel ist eine „Umwerthung aller Werthe“, die auf eine Rückkehr zu einer agonalen Kultur mit dem Prinzip des Wettkampfs der Besten abzielt.
- Nietzsche's psychologischer Ansatz zur Interpretation Jesu Christi
- Kritik am Christentum und seinen Predigern
- Nietzsche's Sicht auf das Leben und die Lehre Jesu im Vergleich zum christlichen Glauben
- Die Rolle des Leidens und des Martyriums in Nietzsche's Kritik
- Die Verbindung zwischen Nietzsche's Kritik und seiner Philosophie des „Übermenschen“
Zusammenfassung der Kapitel
Der zweite Teil von „Der Antichrist“ analysiert Nietzsche's Interpretation von Jesus Christus und das Christentum. Er stellt fest, dass Nietzsche Jesus nicht als eine konkrete historische Person, sondern als ein „psychologisches Symbol“ betrachtet. Nietzsche interpretiert Jesus als einen sanftmütigen Menschen, der die Liebe in ihrer höchsten Form verkörpert. Seine Lebensweise, die auf Frieden und Nächstenliebe fokussiert, wird von Nietzsche als ein Ausdruck der „frohen Botschaft“ vom „Reich Gottes“ verstanden.
Die Arbeit beleuchtet auch Nietzsche's Kritik am Christentum. Er sieht in Paulus die Ursache für eine Fehlentwicklung des Christentums, welche seiner Meinung nach die ursprüngliche Botschaft Jesu verfälscht. Die Kritik an der christlichen Kirche und ihren Predigern gipfelt in sieben „Gesetzen wider das Christentum“, die Nietzsche im letzten Kapitel formuliert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Jesus Christus, Christentum, Kritik, „Der Antichrist“, Nietzsche, „Übermensch“, Psychologie, Lebensbejahung, Liebe, Leid, Martyrium, Paulus, „Umwerthung aller Werthe“.
- Quote paper
- Nicole Kaczmar (Author), 2018, Die Auseinandersetzung Nietzsches mit dem Christentum und Jesus Christus in seinem Werk "Der Antichrist", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/489405