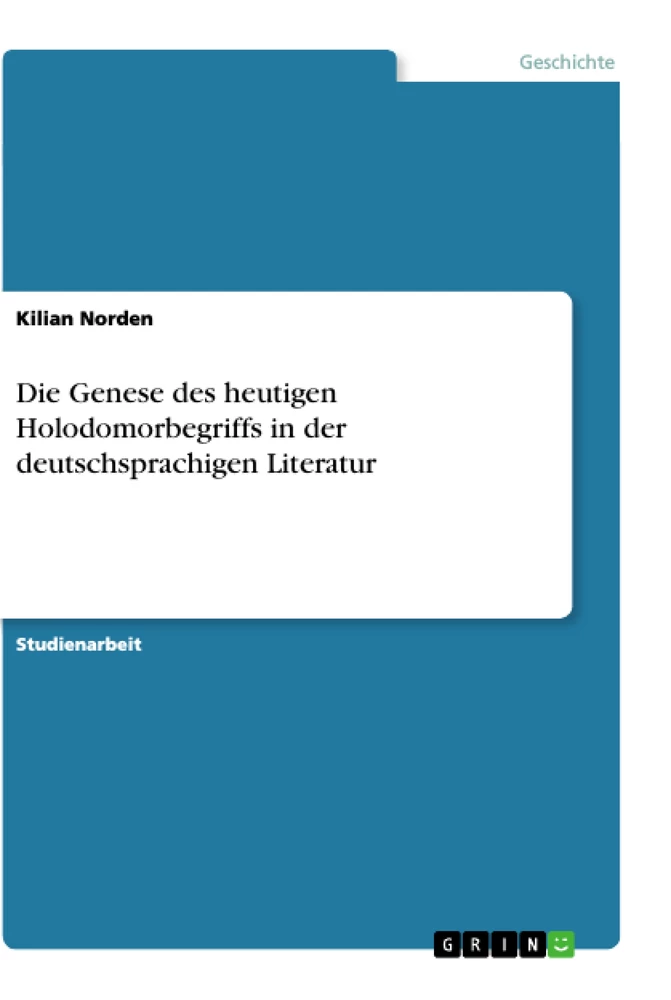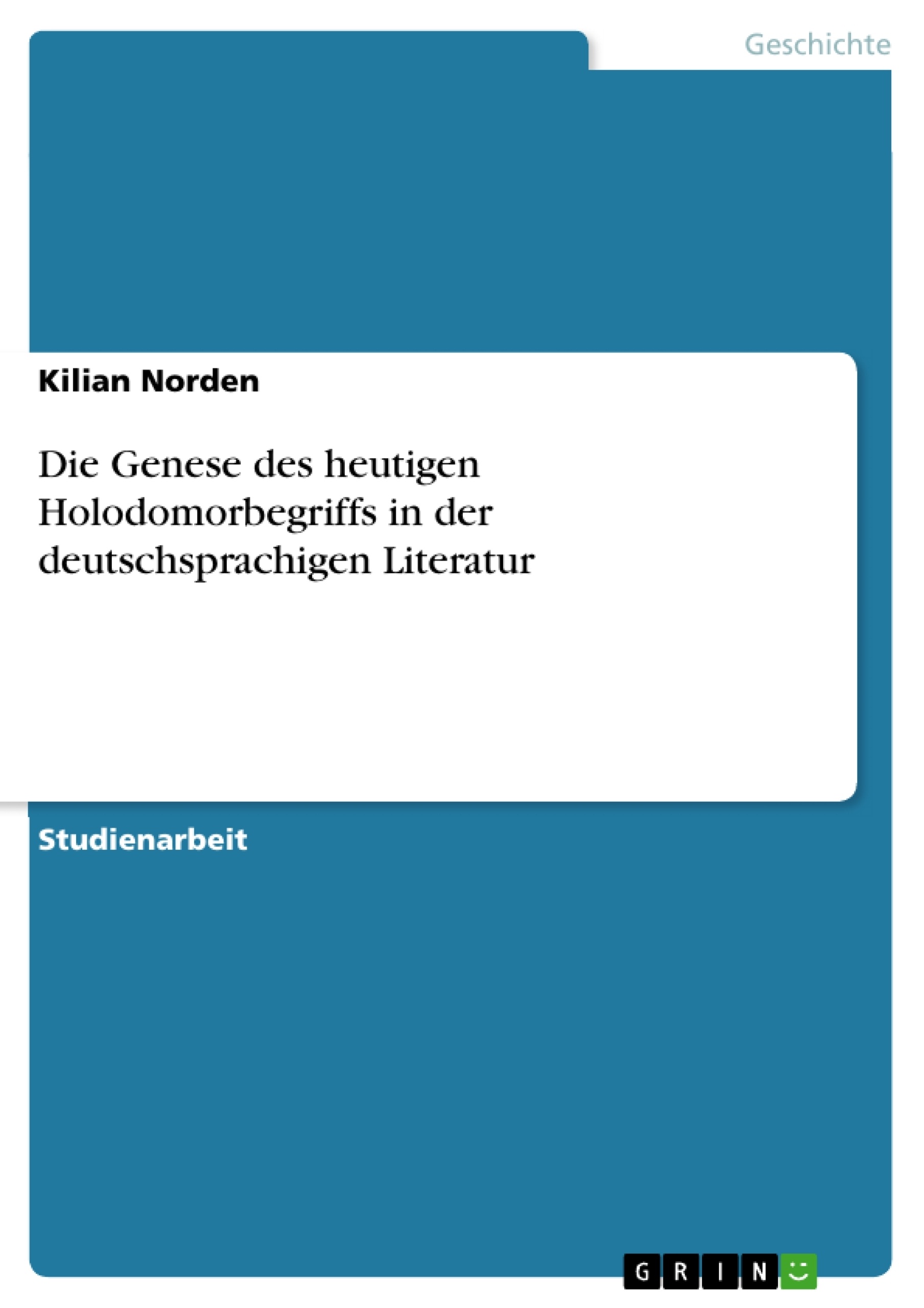In dieser Arbeit soll die Genese, d.h. die Entwicklung des Holodomorbegriffs in der deutschsprachigen Literatur, auf die Ukraine bezogen, nachgezeichnet werden. Die Literaturauswahl umfasst hierbei nicht nur originär auf Deutsch erschienene Werke, sondern beinhaltet auch Werke welche in die Deutsche Sprache übersetzt wurden. Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass in der Folge keine Suche nach Schuldigen oder einem Schuldigen am Holodomor erfolgen soll. Des Weiteren muss teilweise auf eine in die Tiefe gehende Darstellung, zu Gunsten einer auf Vollständigkeit wertlegenden Darstellung, aufgrund von Formatauflagen verzichtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Holodomor - Einige Fakten
- Die Rezeption in der Zeit des Stattfindens
- Bearbeitung ab Mitte/Ende der 80er Jahre
- Mögliche Erklärungen für die Nichtbearbeitung in der geschichtswissenschaftlichen Literatur, im Zeitraum ab Mitte der 30er Jahre bis Mitte/Ende der 80er Jahre
- Aktuelle Russisch-Ukrainische Rezeption, im Kontext ihrer bilateralen Beziehungen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zeichnet die Entwicklung des Holodomor-Begriffs in der deutschsprachigen Literatur nach und analysiert die Rezeption des Themas in verschiedenen Zeitabschnitten. Dabei wird die Relevanz des Holodomor als eine der größten Hungersnöte des 20. Jahrhunderts hervorgehoben und die historische Bedeutung des Themas für das deutschsprachige Bewusstsein untersucht.
- Die Genese des Holodomor-Begriffs in der deutschsprachigen Literatur
- Die Rezeption des Holodomor in der Zeit des Stattfindens
- Die Rolle der Sowjetführung und des Völkerbundes in Bezug auf den Holodomor
- Die Reaktion des Auslands auf die Hungersnot
- Die Bedeutung des Holodomor für die deutschsprachige Geschichtswissenschaft und die heutigen deutsch-ukrainischen Beziehungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Zielsetzung und den Umfang der Arbeit dar. Kapitel 2 bietet eine kurze Zusammenfassung der Fakten zum Holodomor, einschließlich der zeitlichen Einordnung, der Opferzahlen und der geographischen Ausdehnung der Hungersnot. Kapitel 3 konzentriert sich auf die Rezeption des Holodomor während der Zeit des Geschehens. Es werden die Reaktionen der Sowjetführung, des Völkerbundes und des Auslands beleuchtet. Kapitel 4 beschreibt die Bearbeitung des Themas in der deutschsprachigen Literatur ab Mitte/Ende der 80er Jahre und untersucht die Gründe für die späte Auseinandersetzung mit dem Thema. Kapitel 5 widmet sich möglichen Erklärungen für die Nichtbearbeitung des Holodomor in der geschichtswissenschaftlichen Literatur zwischen Mitte der 30er und Mitte/Ende der 80er Jahre. Kapitel 6 analysiert die aktuelle russisch-ukrainische Rezeption des Holodomor im Kontext ihrer bilateralen Beziehungen.
Schlüsselwörter
Holodomor, Ukraine, Hungersnot, Sowjetunion, Stalinismus, Völkerbund, Rezeption, Geschichtswissenschaft, deutschsprachige Literatur, russisch-ukrainische Beziehungen
Häufig gestellte Fragen zum Holodomor in der Literatur
Was bedeutet der Begriff Holodomor?
Der Holodomor bezeichnet die durch das Stalin-Regime herbeigeführte Hungersnot in der Ukraine in den Jahren 1932 und 1933, der Millionen Menschen zum Opfer fielen.
Warum wurde das Thema in der deutschsprachigen Literatur lange nicht bearbeitet?
Gründe für die Nichtbearbeitung zwischen den 1930er und 1980er Jahren waren politische Rücksichten, der Einfluss der sowjetischen Propaganda und fehlender Zugang zu Archiven.
Wann begann die verstärkte wissenschaftliche Auseinandersetzung?
Eine intensive Bearbeitung des Holodomor-Themas in der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft und Literatur setzte erst ab Mitte bis Ende der 1980er Jahre ein.
Wie reagierte das Ausland während der Hungersnot?
Obwohl Berichte über die Hungersnot existierten, blieben offizielle Reaktionen des Völkerbundes und vieler ausländischer Regierungen aufgrund diplomatischer Interessen gegenüber der Sowjetunion verhalten.
Welche Rolle spielt der Holodomor heute in den ukrainisch-russischen Beziehungen?
Der Holodomor ist ein zentraler und hochsensibler Punkt in den bilateralen Beziehungen, da die Ukraine ihn als Genozid einstuft, was von russischer Seite oft anders bewertet wird.
- Quote paper
- Kilian Norden (Author), 2009, Die Genese des heutigen Holodomorbegriffs in der deutschsprachigen Literatur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/489488