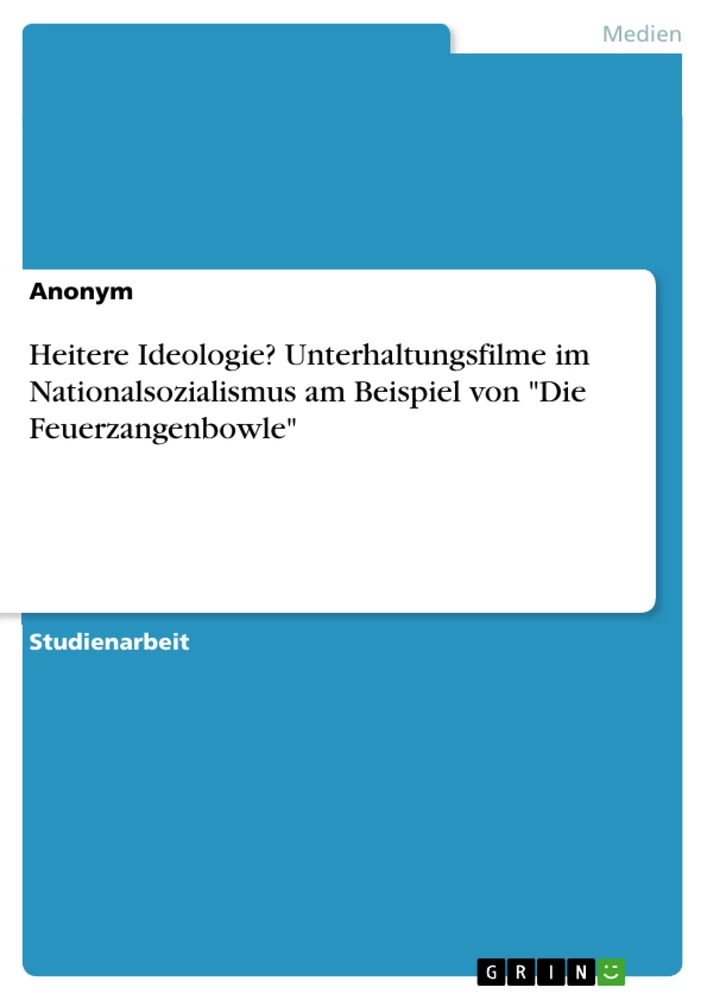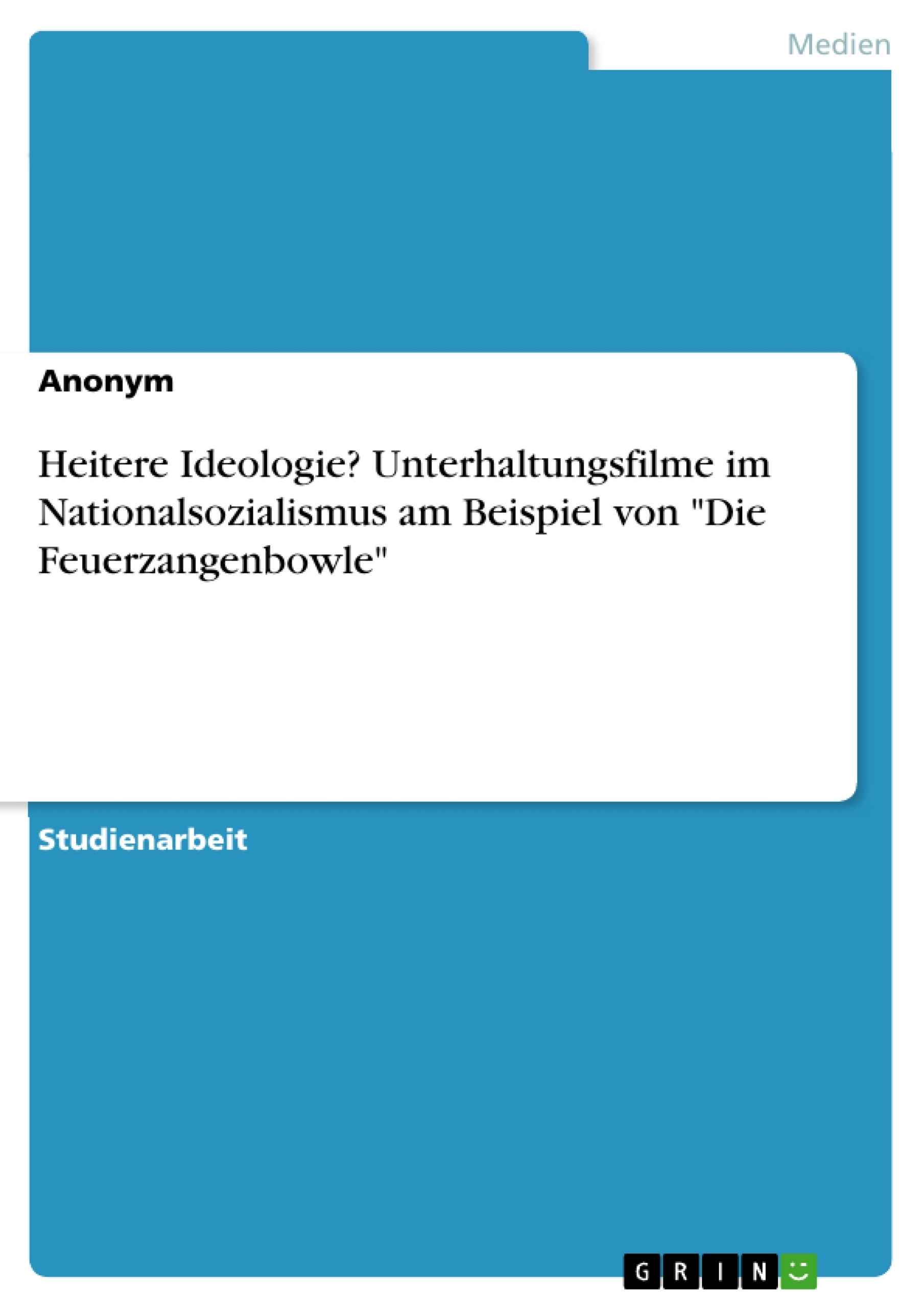Es ist zur Tradition geworden: Tausende Studenten versammeln sich in der Adventszeit in den Hörsälen, um gemeinsam Die Feuerzangenbowle und das gleichnamige Getränk zu genießen. Dabei wird vor allem eines: herzlich gelacht. Von Hamburg bis München, von Köln bis Berlin: In studentischen Kreisen wird die Komödie mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle als Pfeiffer mit drei F geradezu verehrt. Die Feuerzangenbowle ist ein Klassiker und gehört auch noch heute zu den beliebtesten deutschen Filmen aller Zeiten.
Wer den deutschen Kultfilm von Regisseur Helmut Weiss aus dem Jahr 1944 kritisieren will, scheint zunächst eine Spaßbremse zu sein. Die Entstehungszeit der Feuerzangenbowle gibt allerdings jeglichen Anlass zu einer kritischen Betrachtungsweise.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Begriffsklärung Propaganda
- III. Kinofilme im Dritten Reich
- .1 Nationalsozialistische Filmpoltik
- .3 Kino und Unterhaltungsfilme
- .5 Die Feuerzangenbowle
- IV. Die Feuerzangenbowle
- .12 Inhalt
- .12 Entstehungsgeschichte im gesellschaftlich-historischen Kontext
- .15 Versteckte Propaganda
- V. Der Starkult im Dritten Reich am Beispiel von Heinz Rühmann
- VI. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Rolle von Unterhaltungsfilmen im Nationalsozialismus und untersucht, ob diese eine versteckte propagandistische Funktion hatten. Sie fokussiert auf die Komödie „Die Feuerzangenbowle“ als Beispiel für den Einsatz unterschwelliger Propaganda im Kontext der nationalsozialistischen Filmpoltik.
- Analyse der nationalsozialistischen Filmpoltik
- Untersuchung der Funktion und Bedeutung von Unterhaltungsfilmen im Dritten Reich
- Erforschung der Verwendung unterschwelliger Propaganda in „Die Feuerzangenbowle“
- Bedeutung des Mediums Film für die Menschen im Alltag
- Analyse des Starkults im Nationalsozialismus am Beispiel von Heinz Rühmann
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel gibt eine Einleitung in das Thema und stellt die Forschungsfrage, ob es im Nationalsozialismus tatsächlich reine Unterhaltungsfilme gab. Kapitel II beleuchtet den Begriff „Propaganda“ in seinem historischen Kontext. Kapitel III widmet sich der nationalsozialistischen Filmpoltik und der Funktion von Unterhaltungsfilmen im Dritten Reich. Kapitel IV untersucht die Komödie „Die Feuerzangenbowle“ und analysiert die darin versteckte Propaganda. Kapitel V beleuchtet den Starkult im Nationalsozialismus am Beispiel von Heinz Rühmann.
Schlüsselwörter
Nationalsozialismus, Filmpoltik, Unterhaltungsfilme, Propaganda, „Die Feuerzangenbowle“, Heinz Rühmann, Starkult.
Häufig gestellte Fragen
War "Die Feuerzangenbowle" ein Propagandafilm?
Obwohl es eine Komödie ist, diente sie im Nationalsozialismus als "Heitere Ideologie" zur Ablenkung von den Kriegsereignissen und zur Stärkung der Moral.
Welche Rolle spielte Heinz Rühmann im Dritten Reich?
Rühmann war der populärste Star des deutschen Kinos und ein wichtiges Aushängeschild der nationalsozialistischen Unterhaltungsindustrie.
Warum wurde der Film erst 1944 veröffentlicht?
Trotz Bedenken wegen der Darstellung von Autoritätspersonen wurde der Film freigegeben, um dem Volk in der Endphase des Krieges Ablenkung zu bieten.
Was versteht man unter "unterschwelliger Propaganda"?
Botschaften, die nicht direkt politisch sind, aber Werte wie Gehorsam, Gemeinschaft oder eine idealisierte Vergangenheit vermitteln.
Warum ist der Film heute noch ein Kultklassiker?
Wegen seines zeitlosen Humors und der studentischen Traditionen, oft wird dabei jedoch der historisch-politische Entstehungskontext ausgeblendet.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, Heitere Ideologie? Unterhaltungsfilme im Nationalsozialismus am Beispiel von "Die Feuerzangenbowle", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/489844