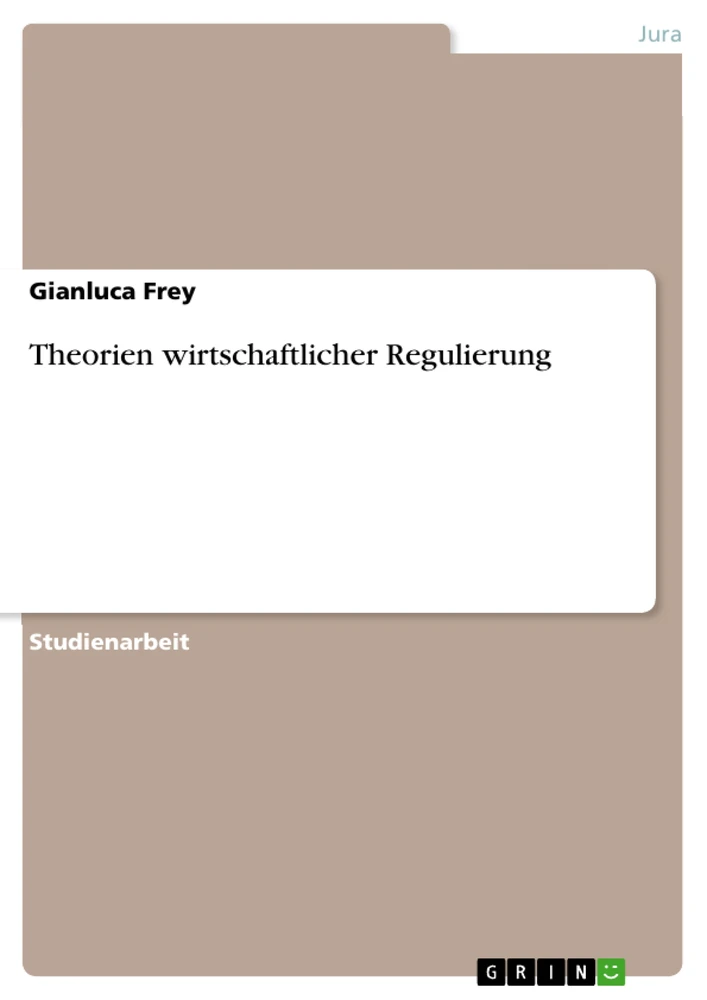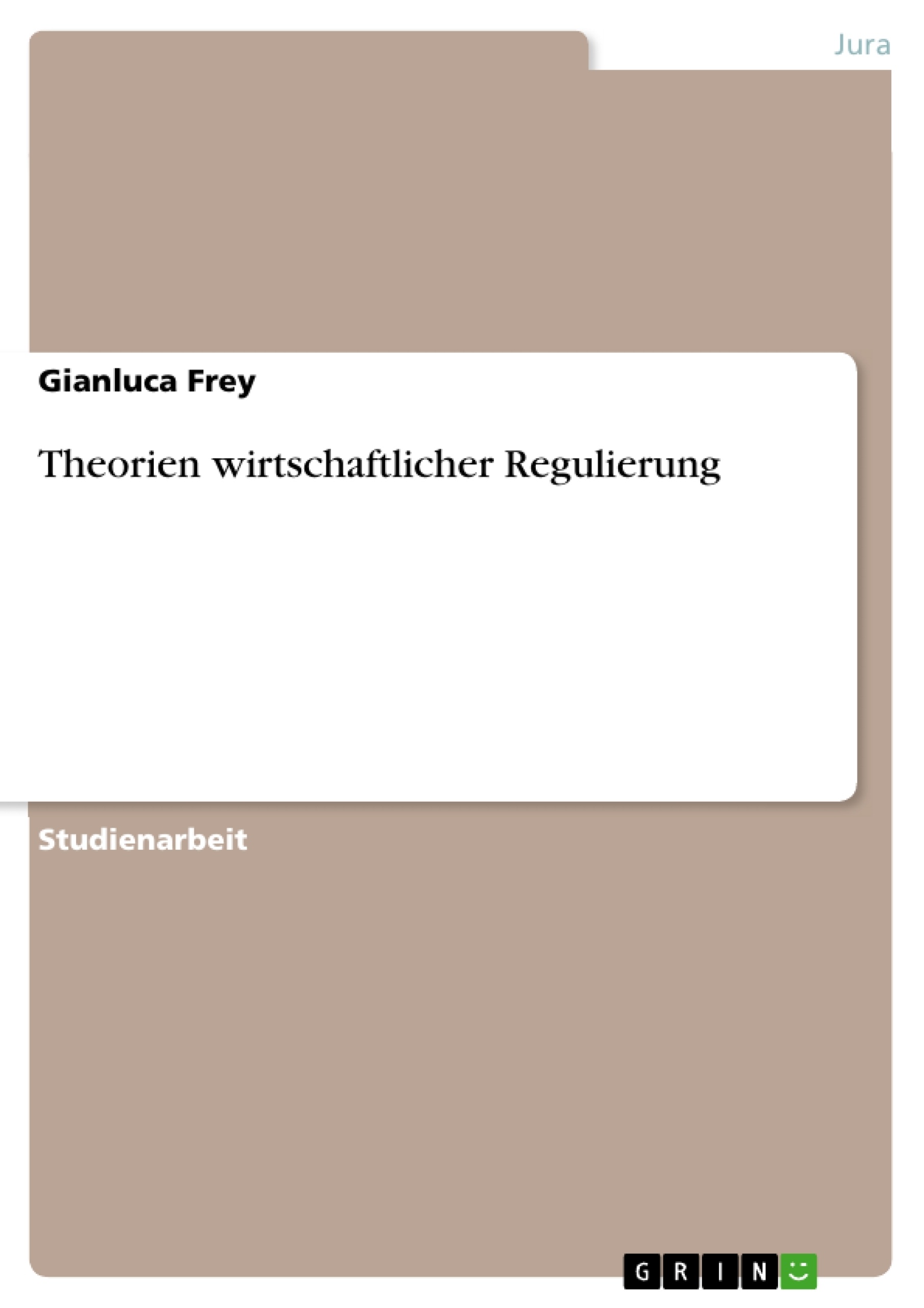Betrachtet man das Thema staatliche Regulierung, gehen die Gemüter auseinander. Die einen halten es für einen unerträglichen Eingriff in die freie Marktwirtschaft, die anderen sehen es als ein essentielles Werkzeug die Imperfektion des Marktes auszugleichen. Dabei betrifft das Thema nicht nur die Frage, ob man regulieren sollte, sondern es gilt zunächst zu klären, was hinter dem Begriff der Regulierung steckt. Erst dann kann geklärt werden, welche Beweggründe mit Regulierungen einhergehen, um das Thema verstehen zu können. In der Wissenschaft ist kein einheitlicher Regulierungsbegriff anerkannt, vielmehr sehen verschiedene Strömungen in der Wissenschaft den Begriff unterschiedlich. Außerdem wird dieser je nach Wirtschaftsraum unterschiedlich definiert. Ähnlich zahlreich wie die Definitionsansätze bei dem Regulierungsbegriff auftauchen sieht es bei den Regulierungstheorien aus, die zu erklären versuchen wieso reguliert wird und wann Regulierungen notwendig werden. Dabei soll der Fokus dieser Arbeit gerade auf den Regulierungstheorien liegen und versucht werden die theoretischen Ansätze auf aktuelle regulierungspolitische Maßnahmen, die im Rahmen der Digitalisierung des Finanzsektors stattfinden, zu übertragen und dessen Hintergründe zu analysieren.
Zunächst sei jedoch auf Geschichte von Regulierung zu verweisen, um die Idee der Notwendigkeit von staatlichen Eingriffen in den Markt überhaupt nachvollziehen zu können. Die Ansicht, dass Regulierungen notwendig sind, ist spätestens seit der Wirtschaftskrise ab 2007 allgegenwärtig, da unter anderem schwache Regulierungen des Bankensektors zum Auslöser der Krise wurden. Jedoch reichen die Anfänge staatlicher Eingriffe, um Marktverhältnisse zu regeln weiter zurück. Das Konzept der Regulierung lässt sich im Ursprung in den USA finden. Dort wurden früh unabhängige Regulierungsbehörden gebildet, um verschiedene Wirtschaftssektoren zu lenken. Diese galten als „arms of congress“ und wurden unabhängig von der präsidentiellen Exekutive aufgestellt, woraufhin sich dieses Konzept zum institutionellen Regelfall entwickelt hat. Die Idee war es ökonomische Missstände auszugleichen. Die „Trustbewegung“ in den USA führte im Rahmen des Eisenbahnverkehrs zu einer Machtkonzentration bestimmter Unternehmen, die die wichtigsten Schienennetze bedient haben.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Regulierungsbegriff
- I. Enger und weiter Regulierungsbegriff
- II. Entwicklung des amerikanischen Regulierungsbegriffs
- III. Entwicklung des Regulierungsbegriffs in Deutschland
- IV. Differenzierter Regulierungsbegriff
- C. Beispiele wirtschaftlicher Regulierungstheorien
- I. Die Normative Theorie
- 1. Regulierung in Monopolmärkten
- 2. Preis- und Marktzutrittsregulierung in Wettbewerbsbranchen
- 3. Verhaltens- und Qualitätsregulierung
- 4. Public-Interest-Theorie
- 5. Kritik an der normativen Regulierungstheorie
- II. Die positive Regulierungstheorie
- 1. Verhaltensweisentheorie
- 2. Capture-Theorie
- a. Grundaussage
- b. Kritik an der Capture-Theorie
- 3. Chicago-Theorie
- a. Stigler
- b. Posner
- c. Peltzman
- d. Becker
- e. Kritik an der Chicago-Theorie
- III. Credible-Commitment-Theorie
- 1. Grundaussage
- 2. Unterschiedliche Ansatzpunkte
- 3. Kritische Bewertung
- D. Konsequenzen staatlicher Regulierung
- E. Regulierungstheorien im Zuge der Digitalisierung des Finanzmarkts
- I. „MiFID II”
- 1. Gründe im Sinne der normativen Theorie
- 2. Gründe im Sinne der positiven Theorie
- II. Maßnahmen der Regulierungsbehörden BaFin und EBA
- III. Digitale Lösung interessengeleiteter Regulierungspolitik
- F. Stellungnahme
- Entwicklung des Regulierungsbegriffs
- Normative und positive Regulierungstheorien
- Kritik an den verschiedenen Regulierungstheorien
- Konsequenzen staatlicher Regulierung
- Regulierung im digitalen Finanzmarkt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Regulierungsbegriff und den verschiedenen Regulierungstheorien. Sie analysiert die Entwicklung des Regulierungsbegriffs in den USA und Deutschland und stellt die wichtigsten Vertreter der normativen und positiven Regulierungstheorie vor.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Regulierungstheorie ein und erläutert die Relevanz der Thematik. Das zweite Kapitel behandelt den Regulierungsbegriff, seine Entwicklung in den USA und Deutschland sowie die verschiedenen Definitionen des Begriffs. Das dritte Kapitel stellt die wichtigsten Vertreter der normativen und positiven Regulierungstheorie vor, darunter die Public-Interest-Theorie, die Capture-Theorie und die Chicago-Theorie.
Kapitel vier beschäftigt sich mit den Konsequenzen staatlicher Regulierung. Das fünfte Kapitel widmet sich der Regulierungstheorie im Zuge der Digitalisierung des Finanzmarktes. Der Fokus liegt dabei auf der „MiFID II“ und den Maßnahmen der Regulierungsbehörden BaFin und EBA.
Schlüsselwörter
Regulierungstheorie, normativer Ansatz, positiver Ansatz, Public-Interest-Theorie, Capture-Theorie, Chicago-Theorie, Credible-Commitment-Theorie, Digitalisierung, Finanzmarkt, „MiFID II“, BaFin, EBA
- Citation du texte
- Gianluca Frey (Auteur), 2019, Theorien wirtschaftlicher Regulierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/489993