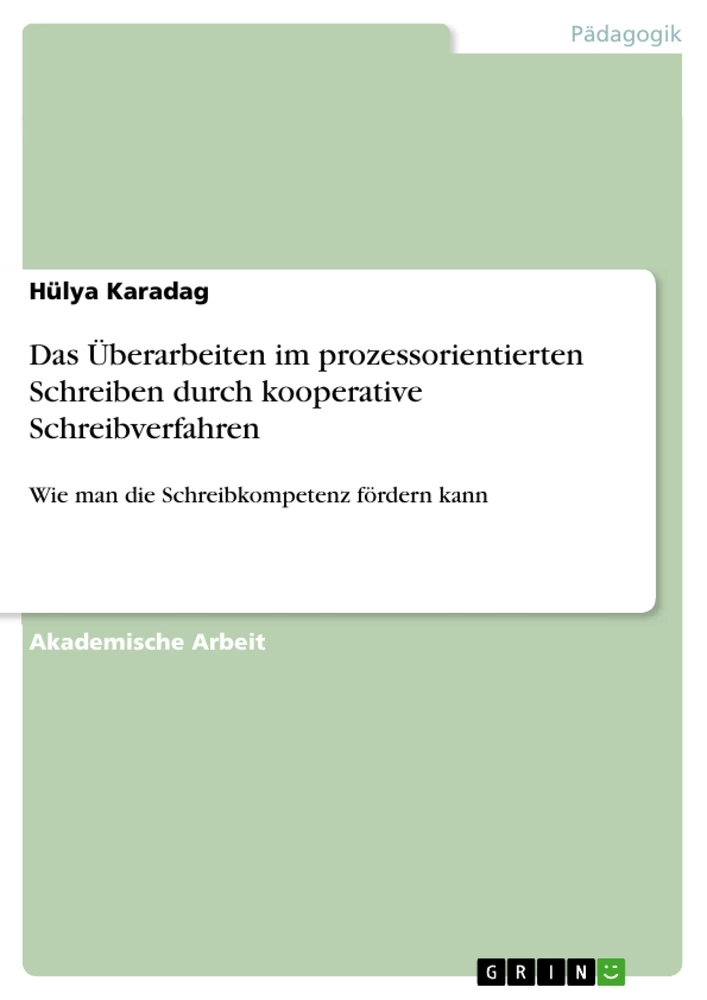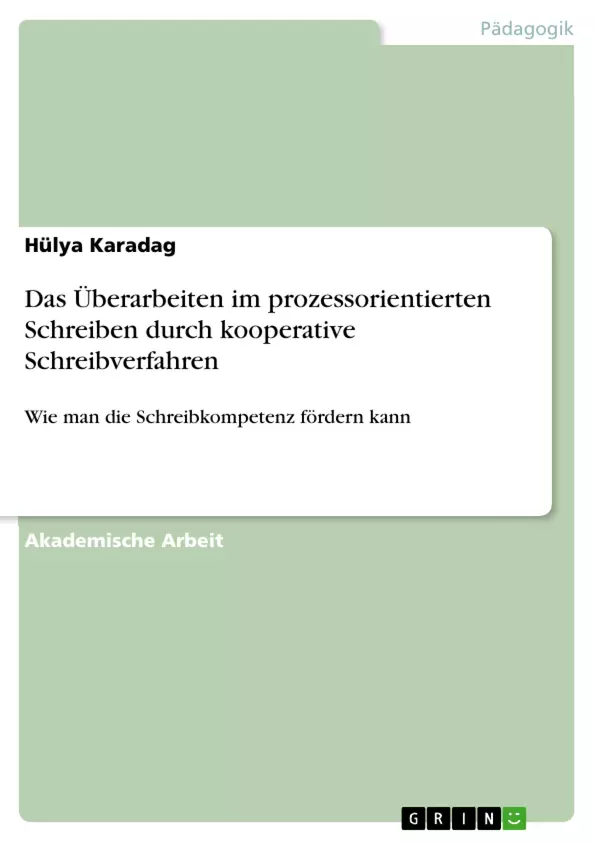Gegenstand dieser Arbeit ist das Überarbeiten im prozessorientierten Schreiben durch kooperative Schreibverfahren zur Förderung der Schreibkompetenz. Zunächst sollen Merkmale des Schreibens in Betracht gezogen werden, um anschließend den Begriff der Schreibkompetenz zu verstehen. Dann soll die Entwicklung der schreibdidaktischen Konzepte beleuchtet werden, um im Anschluss näher auf die prozessorientierte Schreibdidaktik überzuleiten. Daraufhin soll ein im Rahmen der prozessorientierten Schreibdidaktik bekanntes Schreibmodell aufgezeigt werden. Auf der Basis dieses Modells soll in Bezug auf den Prozess des Überarbeitens auf das kooperative Schreiben eingegangen werden.
Lesen und Schreiben sind voneinander abhängige Fähigkeiten und gehören zu den wichtigen Schlüsselkompetenzen für die Lebens- und Daseinsgestaltung in der Gesellschaft. Gute leserliche Texte entstehen durch einen planvollen Schreibprozess, der Zeit erfordert, um einen Text situations- und adressatengerecht zu produzieren. Unterschiedliche Studien und Befunde liegen vor, dass gerade bei Hauptschülerinnen und -schülern die Textproduktion Schwierigkeiten mit sich bringt, weshalb sie effektiver gefördert werden sollten, damit sie zukünftige Schreibsituationen adäquater bewältigen. Im Gegensatz zum Gymnasium ist der Anteil von Schülerinnen und Schülern (SuS) mit Migrationshintergrund in den Hauptschulen höher, weswegen im Deutschunterricht die Fähigkeiten im Schreiben vermittelt werden sollten, damit diese SuS nicht durch ein schlechteres Selbstkonzept im Fach Deutsch charakterisiert werden, was auch zu unmittelbar negativen Auswirkungen auf die schulischen Leistungen führt.
Die Fähigkeit zum Schreiben entwickelt sich in einem langen Prozess, der vom Schreibalter abhängt und durch den Schreibkontext beeinflusst wird. Im schulischen Schreiben dient das Schreiben dazu, individuelle Lernleistungen zu bewerten, den Lernerfolg aufzuzeigen und eine Lernkontrolle durchzuführen. Die Zielsetzungen zwischen dem Schreibunterricht und den anderen Fächern unterscheiden sich dadurch, dass beim erstgenannten das Schreiben als Lerngegenstand und beim letztgenannten als Lernmedium fungiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schreiben
- Schreibkompetenz - Definition
- Überarbeiten
- Kooperatives Schreiben
- Schreibkonferenz
- Textlupe
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Bedeutung des Überarbeitens im prozessorientierten Schreiben durch kooperative Schreibverfahren zur Förderung der Schreibkompetenz. Ziel ist es, die verschiedenen Aspekte des Schreibprozesses, insbesondere des Überarbeitens, im Kontext der Schreibdidaktik zu beleuchten. Dabei werden die Vorteile und Nachteile kooperativer Schreibverfahren wie Schreibkonferenz und Textlupe im Hinblick auf ihren Einsatz im Schulunterricht untersucht.
- Schreibkompetenz und ihre Entwicklung
- Prozessorientierte Schreibdidaktik
- Kooperatives Schreiben als Werkzeug zur Förderung der Schreibkompetenz
- Analyse von Schreibkonferenz und Textlupe
- Die Bedeutung des Überarbeitens im Schreibprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Diese Einleitung führt in das Thema der vorliegenden Arbeit ein und stellt die Relevanz des Schreibens als Schlüsselkompetenz in der Gesellschaft dar. Sie beleuchtet die Herausforderungen, die Schülerinnen und Schüler im Schreibprozess erleben können, insbesondere im Kontext der Hauptschule.
Schreiben
Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklung der Schreibfähigkeit im Kontext des schulischen Schreibens. Es untersucht die unterschiedlichen Anforderungen an das Schreiben im Deutschunterricht im Vergleich zu anderen Fächern und betont die Bedeutung der Schreibkompetenz als kulturelle Tätigkeit.
Schreibkompetenz - Definition
Das Kapitel definiert den Kompetenzbegriff im Allgemeinen und zeigt, wie er sich auf die Schreibkompetenz übertragen lässt. Es beleuchtet die verschiedenen Teilkompetenzen, die zur Schreibkompetenz beitragen, und verdeutlicht die Notwendigkeit der Integration von Wissen, Sprache und Kommunikation im Schreibprozess.
Häufig gestellte Fragen
Was ist prozessorientierte Schreibdidaktik?
Dieser Ansatz betrachtet Schreiben nicht als einmaliges Produkt, sondern als Prozess aus Planung, Formulierung und Überarbeitung.
Was versteht man unter kooperativem Schreiben?
Beim kooperativen Schreiben arbeiten Schüler zusammen, um Texte durch gegenseitiges Feedback und gemeinsame Überarbeitung zu verbessern.
Was ist eine Schreibkonferenz?
Eine Methode, bei der sich Schüler in kleinen Gruppen über ihre Textentwürfe austauschen und gezielte Hinweise zur Optimierung geben.
Wie funktioniert die "Textlupe"?
Die Textlupe ist ein kooperatives Verfahren, bei dem Mitschüler einen Text nach festgelegten Kriterien untersuchen und schriftliche Rückmeldungen geben.
Warum ist Überarbeiten für die Schreibkompetenz wichtig?
Durch das Überarbeiten lernen Schüler, ihren Text aus der Sicht eines Lesers zu sehen und sprachliche sowie inhaltliche Mängel selbstständig zu beheben.
- Quote paper
- Hülya Karadag (Author), 2016, Das Überarbeiten im prozessorientierten Schreiben durch kooperative Schreibverfahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/490918