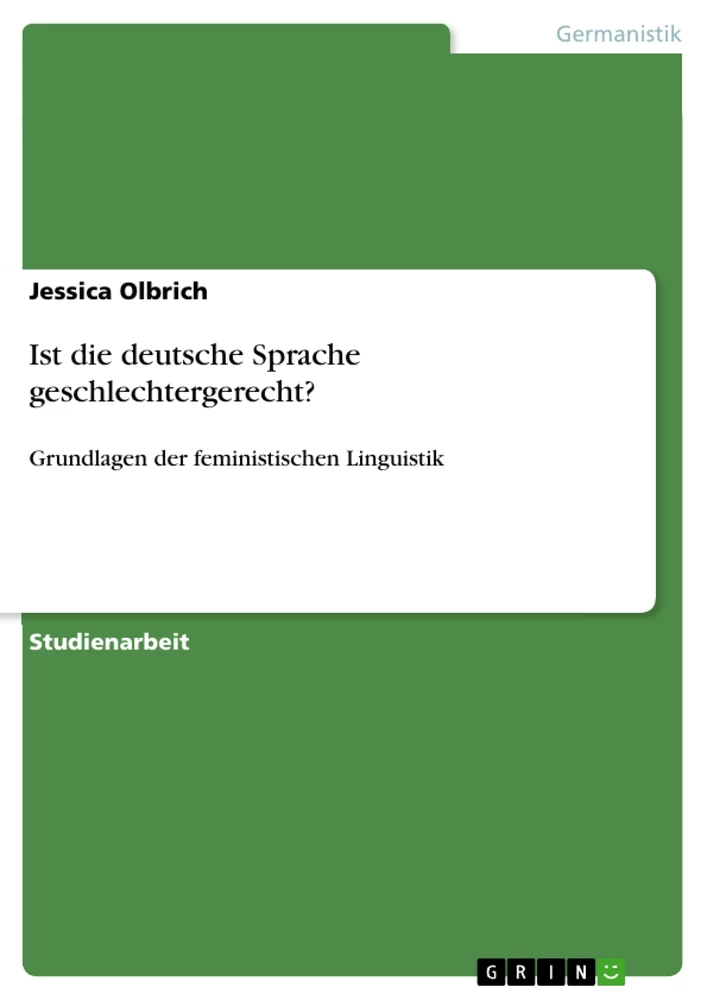Diese Arbeit wird sich im weiteren Verlauf mit der feministischen Sprachwissenschaft und verfolgt das Ziel, verschieden vertretenen Auffassungen im Hinblick auf eine geschlechtergerechte Sprache und die unterschiedliche Verbesserungsformen darzulegen.
Nicht nur in linguistischen Fachkreisen wird sich die Frage gestellt, ob die deutsche Sprache „frauenfeindlich“ ist beziehungsweise, ob Frauen in ihr gleichermaßen berücksichtigt werden. Es wird schon seit längerer Zeit über sprachliche Gleichstellung der Geschlechter diskutiert, geforscht und versucht, dafür Lösungen zu finden. Mit der UNESCO- Resolution von 1987 zur Sichtbarmachung von Frauen in der Sprache wird deutlich, dass bei genauerer Betrachtung unserer Sprache problematische Erkenntnisse entstehen. Die Thematik ist mit der Frage eng verknüpft, ob Sprache das Denken beeinflussen kann. Vertreter der geschlechtergerechten Sprache sind der Ansicht, dass Sprache ein Spiegelbild des Zusammenlebens darstellt. Durch sie werden Werte, Normen und Kultur weitergegeben. Somit gestaltet Sprache die Gesellschaft aktiv mit.
Ein oft genanntes Beispiel hierfür sind die Berufsbezeichnungen aus früheren Zeiten, welche überwiegend aus maskulinen Formen bestanden. Sie stellen ein Indiz für die damalige Gesamtsituation in der Gesellschaft dar, da diese Berufe oftmals nur von Männern ausgeübt wurden. Vor allem die feministische Sprachwissenschaft beschäftigt sich mit dieser Thematik. Sie bildete sich in den siebziger Jahren, beginnend in den USA, ab 1978 auch in Deutschland und beschäftigt sich mit dem sexistischen Sprachgebrauch sowie dem geschlechtsspezifischen Sprechen. Auch im Alltag lässt sich die Thematik immer häufiger antreffen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen geschlechtergerechter Sprache
- Gegenpositionen zur feministischen Sprachkritik
- Vorschläge für ein geschlechtergerechtes Deutsch
- Die Beidbenennung
- Die Neutralisation
- Das generische Femininum
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Frage, ob die deutsche Sprache geschlechtergerecht ist und welche Ansätze es für eine gleichberechtigte Sprachverwendung gibt. Er beleuchtet die Grundlagen der feministischen Linguistik und stellt die Kritik an der Verwendung generischer Maskulina sowie an Asymmetrien in der Anredeform dar.
- Kritik an der Verwendung generischer Maskulina
- Feministische Sprachkritik und die Sprachsystematik
- Asymmetrien in der Anredeform
- Männliche Interpretation in der Sprache
- Sprachliche Gleichbehandlung von Frauen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der geschlechtergerechten Sprache ein und beleuchtet die Relevanz der Debatte. Sie stellt den Zusammenhang zwischen Sprache und gesellschaftlicher Realität dar und geht auf die Entstehung und die Zielsetzungen der feministischen Sprachwissenschaft ein.
Das zweite Kapitel widmet sich den Grundlagen geschlechtergerechter Sprache. Es erläutert die Kritik der feministischen Linguistik am Gebrauch generischer Maskulina und den daraus resultierenden Folgen für die Sichtbarkeit von Frauen in der Sprache.
Schlüsselwörter
Generische Maskulina, feministische Sprachkritik, Sprachsystematik, Geschlechtergerechtigkeit, Anredeformen, Sprachveränderung, Identifikation, gesellschaftliche Realität, sprachliche Gleichstellung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das generische Maskulinum?
Die Verwendung männlicher Formen (z. B. „die Lehrer“), um Personen aller Geschlechter zu bezeichnen. Feministisch Sprachkritik bemängelt, dass Frauen hierbei oft nur „mitgemeint“ sind.
Beeinflusst Sprache unser Denken?
Vertreter der geschlechtergerechten Sprache argumentieren, dass Sprache ein Spiegelbild der Gesellschaft ist und durch Sichtbarkeit von Frauen in der Sprache auch deren gesellschaftliche Wahrnehmung gestärkt wird.
Was sind Vorschläge für ein geschlechtergerechtes Deutsch?
Dazu gehören die Beidbenennung (z. B. Schülerinnen und Schüler), Neutralisation (z. B. Studierende) oder das generische Femininum.
Was ist feministische Sprachwissenschaft?
Ein Teilbereich der Linguistik, der sich seit den 70er Jahren mit sexistischem Sprachgebrauch und der sprachlichen Gleichstellung der Geschlechter befasst.
Gibt es Gegenpositionen zur feministischen Sprachkritik?
Ja, Kritiker führen oft die Sprachökonomie, historische Sprachsystematik oder ästhetische Gründe gegen eine radikale Veränderung der Sprache an.
- Citar trabajo
- Jessica Olbrich (Autor), 2015, Ist die deutsche Sprache geschlechtergerecht?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/491922