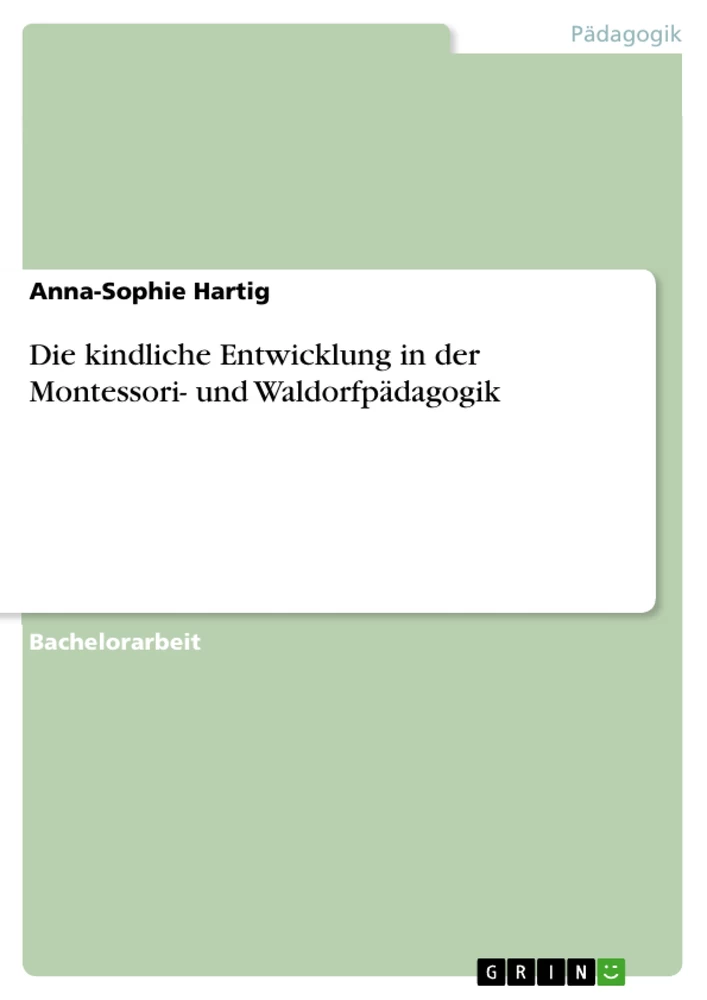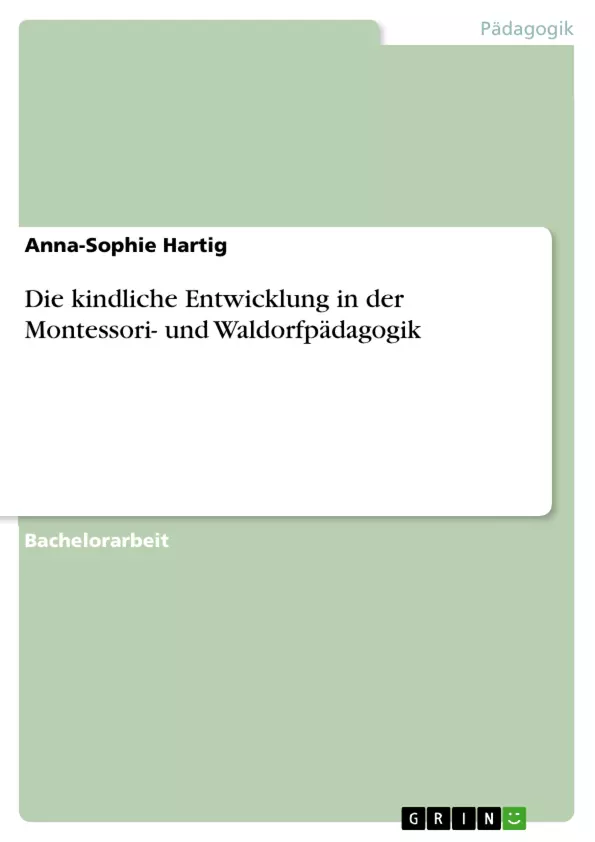In dieser Bachelorarbeit wird das Thema "Die kindliche Entwicklung in der Montessori- und Waldorfpädagogik" bearbeitet. Die beiden pädagogischen Konzepte werden stark diskutiert und spielen häufig eine Rolle in Veranstaltungen der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Damit wird deutlich, welche bedeutende Rolle Maria Montessoris Pädagogik spielt und in welchem Ausmaß diese Lehre praktiziert wird. Auch die Waldorfpädagogik wird häufig als eine besondere Pädagogik beschrieben, deren Motive und Ziele den Kindern gerecht werden wollen.
Aktuell gibt es rund 600 Kindertagesstätten beziehungsweise Kinderhäuser und 400 Schulen in Deutschland, die nach den Prinzipien der Montessoripädagogik arbeiten. Die Schulen gliedern sich in etwa 300 Primarschulen und etwa 100 weiterführende Schulen. Waldorfschulen gibt es 244 in Deutschland und Waldorfkindergärten gibt es 1900 weltweit. Damit wird noch einmal deutlich, wie bedeutend die Konzepte von Maria Montessori und Rudolf Steiner sind und wie viele Bildungseinrichtungen nach deren pädagogischen Prinzipien arbeiten.
Das Themengebiet, mit dem sich diese Bachelorarbeit beschäftigt, ist Gegenstandsbereich der Reformpädagogik, weshalb darauf nun kurz eingegangen wird. Zur Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wurde die autoritäre Struktur, der zu dieser Zeit herkömmlichen Schule, immer wieder stark kritisiert. Diese Kritik führte unzählige neue Schulgestalten und methodische Ansichten mit sich. Noch heute bestehen einige der damals entwickelten Alternativen. Damit nahm die Reformpädagogik oder auch "Neue Erziehung" oder "Education Vouvelle" ihren Lauf. Neue methodische Richtungen wie der Erlebnisunterricht oder die Kunsterziehungsbewegung und neue Schulgestalten wie die Montessori-, Waldorf- und Freinetpädagogik entwickelten sich.
Die einzelnen Schulformen und Reformlinien weisen zwar Unterschiede auf, aber in den pädagogischen Grundmotiven gibt es einige Gemeinsamkeiten, da diese die „Alte Erziehung“ beziehungsweise die „Alte Schule“ mit den zahlreichen Momenten des ängstlichen Zwanges als gemeinsamen Feind sehen und diesen überwinden wollen. Zu den Gemeinsamkeiten der Reformlinien gehört, dass die Pädagogik von den Kindern ausgeht. Gegen die rigide Herrschaft des Lehrplans stehen die Kinder im Mittelpunkt und damit de-ren Bedürfnisse, Fragen und Interessen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Montessoripädagogik
- Kurzbiografie von Maria Montessori
- Grundgedanken der Montessoripädagogik
- Ziele der Montessoripädagogik
- Das Kind in der Montessoripädagogik
- Besonderheiten der Montessoripädagogik
- Die Kosmische Erziehung
- Die Materialien
- Kritik an der Montessoripädagogik
- Die Waldorfpädagogik
- Kurzbiografie Rudolf Steiner
- Grundgedanken der Waldorfpädagogik
- Ziele der Waldorfpädagogik
- Das Kind in der Waldorfpädagogik
- Besonderheiten in der Waldorfpädagogik
- Die Eurythmie
- Die vier Temperamente
- Kritik an der Waldorfpädagogik
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der kindlichen Entwicklung in der Montessori- und Waldorfpädagogik. Sie analysiert die beiden pädagogischen Konzepte und zeigt deren Bedeutung in der Bildungspraxis auf. Die Arbeit konzentriert sich auf die Philosophien und Grundgedanken der beiden Pädagogen, Maria Montessori und Rudolf Steiner, und untersucht, inwieweit deren Ansätze die Individualität des Kindes fördern.
- Die Philosophien von Maria Montessori und Rudolf Steiner
- Die Rolle der Individualität in der Montessoripädagogik und Waldorfpädagogik
- Die Entwicklungsstufen des Kindes in beiden pädagogischen Konzepten
- Besonderheiten und Kritikpunkte der beiden Pädagogiken
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Montessoripädagogik. Sie beleuchtet die Biografie von Maria Montessori und zeigt, wie ihre Lebenserfahrungen ihre pädagogischen Ideen beeinflusst haben. Anschließend werden die wichtigsten Grundgedanken der Montessoripädagogik dargestellt, darunter die Bedeutung der vorbereitenden Umgebung und die Betonung der individuellen Entwicklung des Kindes. Des Weiteren werden die Ziele der Montessoripädagogik erläutert, um zu verstehen, wie sie die Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit fördern möchte. Schließlich werden die Besonderheiten der Montessoripädagogik, wie die Kosmische Erziehung und die Verwendung von speziellen Materialien, sowie die Kritikpunkte an der Pädagogik behandelt.
Der zweite Teil der Arbeit befasst sich mit der Waldorfpädagogik. Auch hier wird zunächst die Biografie von Rudolf Steiner beleuchtet, um seinen Einfluss auf die Entwicklung der Waldorfpädagogik zu verstehen. Anschließend werden die Grundgedanken der Waldorfpädagogik, insbesondere die Anthroposophie, vorgestellt. Die Arbeit geht dann auf die Ziele der Waldorfpädagogik ein, wobei die Förderung der Individualität und die ganzheitliche Bildung des Kindes im Mittelpunkt stehen. Schließlich werden die Besonderheiten der Waldorfpädagogik, wie die Eurythmie und die Lehre der vier Temperamente, sowie die Kritikpunkte an der Pädagogik behandelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt wichtige Themen wie die Reformpädagogik, Montessoripädagogik, Waldorfpädagogik, kindliche Entwicklung, Individualität, vorbereitende Umgebung, Anthroposophie, Kosmische Erziehung, Eurythmie, und die Kritik an beiden Pädagogiken. Die Arbeit stützt sich auf die Primärliteratur von Maria Montessori und Rudolf Steiner sowie auf Sekundärliteratur, die sich mit den beiden Pädagogiken auseinandersetzt.
- Citation du texte
- Anna-Sophie Hartig (Auteur), 2018, Die kindliche Entwicklung in der Montessori- und Waldorfpädagogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/492652