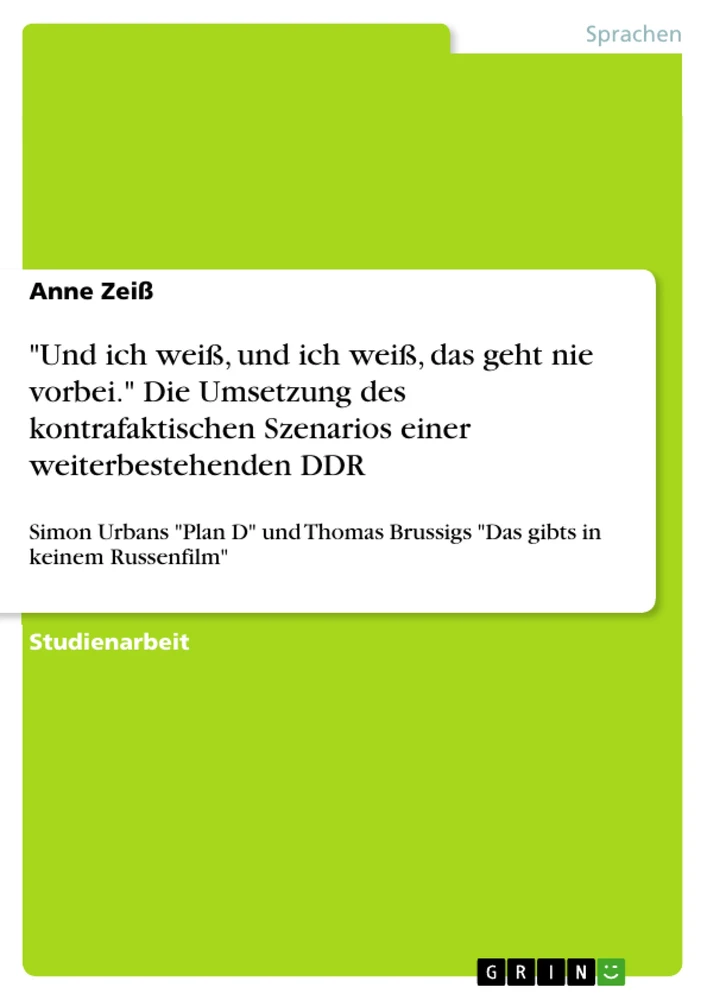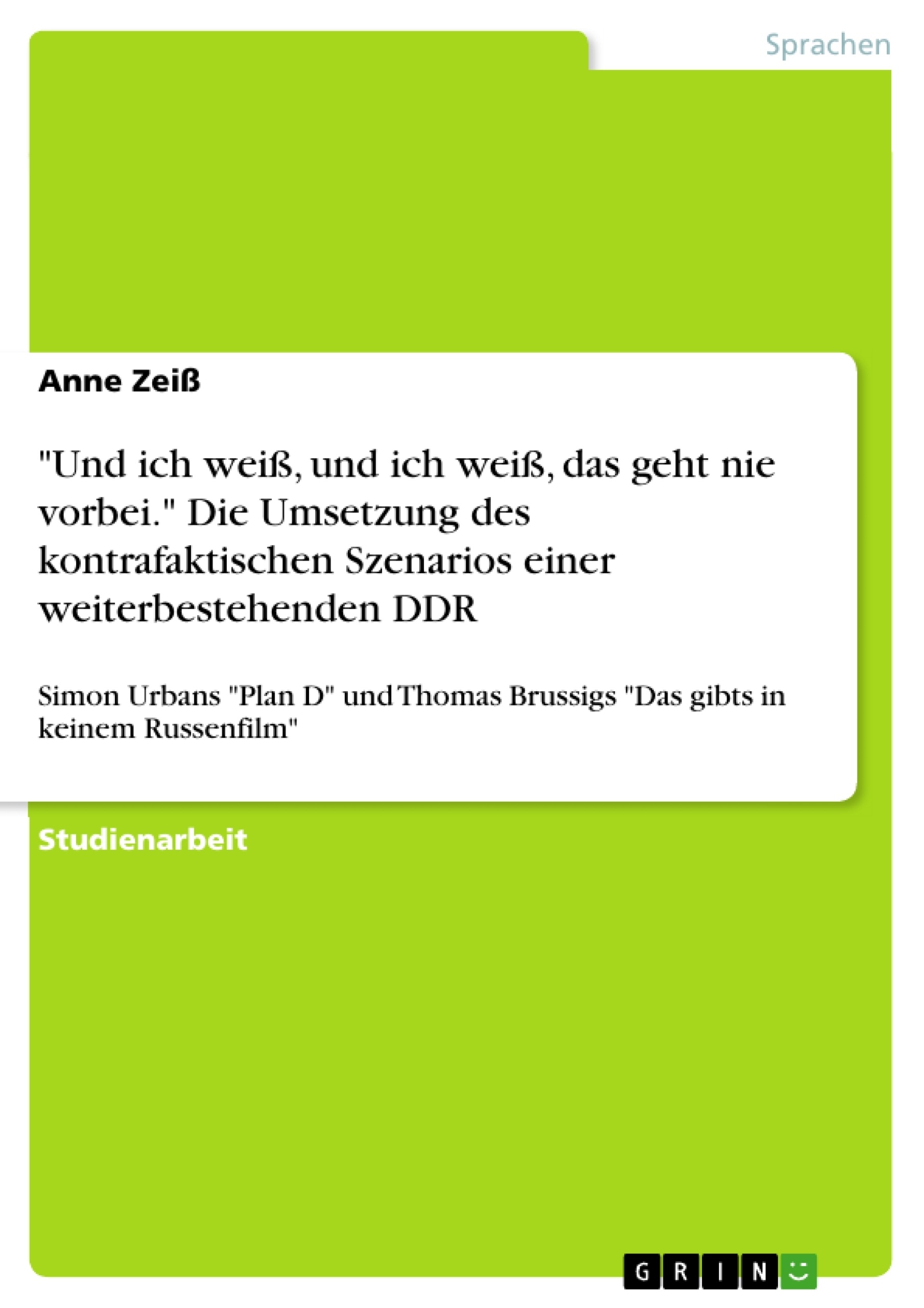"[N]o major event in modern history was less predicted than the fall of the Berlin wall in 1989 or the hauling down of the red flag for the last time from the Kremlin in 1991”, schreibt der Historiker Mark Almond. In Anbetracht dessen liegt es nahe, sich Gedanken darüber zu machen, wie eine Welt aussehen könnte, in der diese Ereignisse nie stattgefunden haben. Eine solche entwirft sowohl Simon Urban in seinem 2011 erschienen Roman "Plan D" als auch Thomas Brussig in seinem Roman "Das gibts in keinem Russenfilm" aus dem Jahr 2015.
In der Geschichtswissenschaft ist umstritten, ob das Entwerfen kontrafaktischer Szenarien ein sinnvolles Werkzeug ist, um Erkenntnisse über die reale Geschichte zu gewinnen, oder eine unwissenschaftliche Spielerei. Geschichtswissenschaftliche kontrafaktische Texte unterliegen einer Reihe von Kriterien, während es Hermann Ritter zufolge für die Literatur keine Regeln für das Spiel mit der Geschichte gibt. Seiner Meinung nach können kontrafaktische Romane keine Fragen über die faktuale Geschichte beantworten. Dies ist Jörg Helbig zufolge aber auch nicht das primäre Interesse von Autoren kontrafaktischer literarischer Werke. Sowohl Ritter als auch Helbig sehen die Unterhaltung der Leser als Hauptanliegen kontrafaktischer Romane. Helbig spricht jedoch auch von anderen Wirkungsabsichten neben dem Aspekt der Unterhaltung.
Im Rahmen des Vergleichs von "Plan D" und "Russenfilm" soll zudem diskutiert werden, welche Wirkungsabsichten möglicherweise damit verbunden sind, die DDR in den beiden Romanen wiederauferstehen zu lassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gestalterische Rahmenbedingungen
- Erzählzeitraum
- Erzählperspektive
- Ursachen des Fortbestehens der DDR
- Das Nicht-Stattfinden historischer Ereignisse in Das gibts in keinem Russenfilm
- Einführung eines Spielmachers in Plan D
- Veränderung der außenpolitischen Umstände in beiden Romanen
- Entwicklung des geteilten Deutschlands
- Entwicklung der DDR
- Die Gegenüberstellung von Ost und West
- Bekannte Persönlichkeiten
- Weltgeschichtliche Ereignisse
- Verflechtung mit privaten Ereignissen
- Hätte sich nichts geändert?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die kontrafaktischen Romane „Plan D“ von Simon Urban und „Das gibts in keinem Russenfilm“ von Thomas Brussig, die beide das Fortbestehen der DDR nach 1990 thematisieren. Ziel ist der Vergleich der jeweiligen Umsetzung dieses Szenarios anhand verschiedener gestalterischer und inhaltlicher Aspekte.
- Kontrafaktische Geschichtsdarstellung in der Literatur
- Vergleich der erzählerischen Strategien in beiden Romanen
- Darstellung der Ursachen für das Fortbestehen der DDR in den fiktiven Welten
- Entwicklung des geteilten Deutschlands in den kontrafaktischen Szenarien
- Einbettung weltgeschichtlicher Ereignisse in private Lebensläufe
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die beiden Romane „Plan D“ und „Das gibts in keinem Russenfilm“ vor, die beide ein kontrafaktisches Szenario einer weiterhin existierenden DDR nach 1990 entwerfen. Sie diskutiert die Definition und Einordnung des Genres „kontrafaktischer Roman“ und führt in die Fragestellung der Arbeit ein: wie die Autoren Urban und Brussig dieses Szenario umsetzen und welche Wirkungsabsichten damit verbunden sein könnten. Die Einleitung verweist auf die wissenschaftliche Debatte um den Wert kontrafaktischer Szenarien in der Geschichtswissenschaft und stellt die unterschiedlichen Positionen von Ritter und Helbig bezüglich der literarischen Umsetzung dar.
Gestalterische Rahmenbedingungen: Dieses Kapitel analysiert die erzählerischen Gestaltungsmittel in beiden Romanen. Es vergleicht den Erzählzeitraum (zehn Tage in Plan D versus ein ganzes Leben in Russenfilm), die Erzählperspektive (heterodiegetisch in Plan D, autodiegetisch in Russenfilm) und die Fokalisierung. Besonderes Augenmerk liegt auf der Rolle der Erzählstimme des Majors Früchtl in Plan D, die als innerer Kommentar die Ereignisse kommentiert und zu einer tiefergehenden Auseinandersetzung mit dem politischen System beiträgt. Die Ähnlichkeit der fiktiven Welt in den Romanen zum Entstehungszeitpunkt wird auch hervorgehoben.
Ursachen des Fortbestehens der DDR: Dieses Kapitel untersucht die unterschiedlichen Ansätze in beiden Romanen, die Ursachen für das Fortbestehen der DDR darzustellen. Es analysiert die Darstellung des "Nicht-Stattfindens" historischer Ereignisse in „Das gibts in keinem Russenfilm“ und die Einführung eines „Spielmachers“ in „Plan D“. Darüber hinaus beleuchtet es die Veränderungen der außenpolitischen Umstände, die in beiden Romanen zum Weiterbestehen der DDR beitragen.
Entwicklung des geteilten Deutschlands: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung der Entwicklung der DDR und der Gegenüberstellung von Ost und West in den beiden Romanen. Es betrachtet die Rolle bekannter Persönlichkeiten in den fiktiven Welten und zeigt auf, wie die Autoren die Kontraste und die Entwicklungen im geteilten Deutschland in ihren kontrafaktischen Szenarien gestalten.
Weltgeschichtliche Ereignisse: Dieses Kapitel befasst sich mit der Verflechtung von weltgeschichtlichen Ereignissen mit privaten Ereignissen in den Romanen. Es untersucht, wie die Autoren die Auswirkungen des ausbleibenden Mauerfalls auf das private Leben der Protagonisten darstellen und welche Überlegungen zu einem „alternativen Verlauf der Geschichte“ angestellt werden.
Schlüsselwörter
Kontrafaktischer Roman, DDR, Alternative Geschichte, Uchronie, Simon Urban, Thomas Brussig, Plan D, Das gibts in keinem Russenfilm, Erzählperspektive, Erzählzeitraum, Außenpolitik, Identität, Erinnerung.
Häufig gestellte Fragen zu "Plan D" und "Das gibts in keinem Russenfilm"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die kontrafaktischen Romane „Plan D“ von Simon Urban und „Das gibts in keinem Russenfilm“ von Thomas Brussig. Beide Romane thematisieren ein Fortbestehen der DDR nach 1990. Die Arbeit vergleicht die Umsetzung dieses Szenarios anhand gestalterischer und inhaltlicher Aspekte.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die kontrafaktische Geschichtsdarstellung in der Literatur, vergleicht die erzählerischen Strategien der beiden Romane, untersucht die Ursachen für das Fortbestehen der DDR in den fiktiven Welten, analysiert die Entwicklung des geteilten Deutschlands in den kontrafaktischen Szenarien und betrachtet die Einbettung weltgeschichtlicher Ereignisse in private Lebensläufe.
Welche Aspekte der Romane werden verglichen?
Der Vergleich umfasst den Erzählzeitraum, die Erzählperspektive (heterodiegetisch in "Plan D", autodiegetisch in "Das gibts in keinem Russenfilm"), die Fokalisierung und die Darstellung der Ursachen für das Fortbestehen der DDR. Die Rolle der Erzählstimme in "Plan D" und die Darstellung des "Nicht-Stattfindens" historischer Ereignisse in "Das gibts in keinem Russenfilm" werden ebenso untersucht wie die Veränderungen der außenpolitischen Umstände in beiden Romanen.
Wie werden die Ursachen für das Fortbestehen der DDR dargestellt?
In "Das gibts in keinem Russenfilm" wird das "Nicht-Stattfinden" historischer Ereignisse als Ursache dargestellt, während "Plan D" die Einführung eines "Spielmachers" in den Mittelpunkt stellt. Beide Romane beleuchten zudem die veränderten außenpolitischen Umstände als Beitrag zum Weiterbestehen der DDR.
Wie wird die Entwicklung des geteilten Deutschlands dargestellt?
Die Arbeit analysiert die Darstellung der Entwicklung der DDR, die Gegenüberstellung von Ost und West, und die Rolle bekannter Persönlichkeiten in den fiktiven Welten beider Romane. Sie zeigt auf, wie die Autoren die Kontraste und Entwicklungen im geteilten Deutschland gestalten.
Wie werden weltgeschichtliche Ereignisse in die Romane eingebunden?
Die Arbeit untersucht die Verflechtung von weltgeschichtlichen Ereignissen mit privaten Ereignissen. Sie analysiert die Auswirkungen des ausbleibenden Mauerfalls auf das private Leben der Protagonisten und die Überlegungen zu einem "alternativen Verlauf der Geschichte".
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kontrafaktischer Roman, DDR, Alternative Geschichte, Uchronie, Simon Urban, Thomas Brussig, Plan D, Das gibts in keinem Russenfilm, Erzählperspektive, Erzählzeitraum, Außenpolitik, Identität, Erinnerung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zu den gestalterischen Rahmenbedingungen, ein Kapitel zu den Ursachen des Fortbestehens der DDR, ein Kapitel zur Entwicklung des geteilten Deutschlands, ein Kapitel zu weltgeschichtlichen Ereignissen und ein Fazit.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist der Vergleich der Umsetzung des Szenarios eines Fortbestehens der DDR nach 1990 in den Romanen "Plan D" und "Das gibts in keinem Russenfilm" anhand verschiedener gestalterischer und inhaltlicher Aspekte.
- Quote paper
- Anne Zeiß (Author), 2019, "Und ich weiß, und ich weiß, das geht nie vorbei." Die Umsetzung des kontrafaktischen Szenarios einer weiterbestehenden DDR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/492837