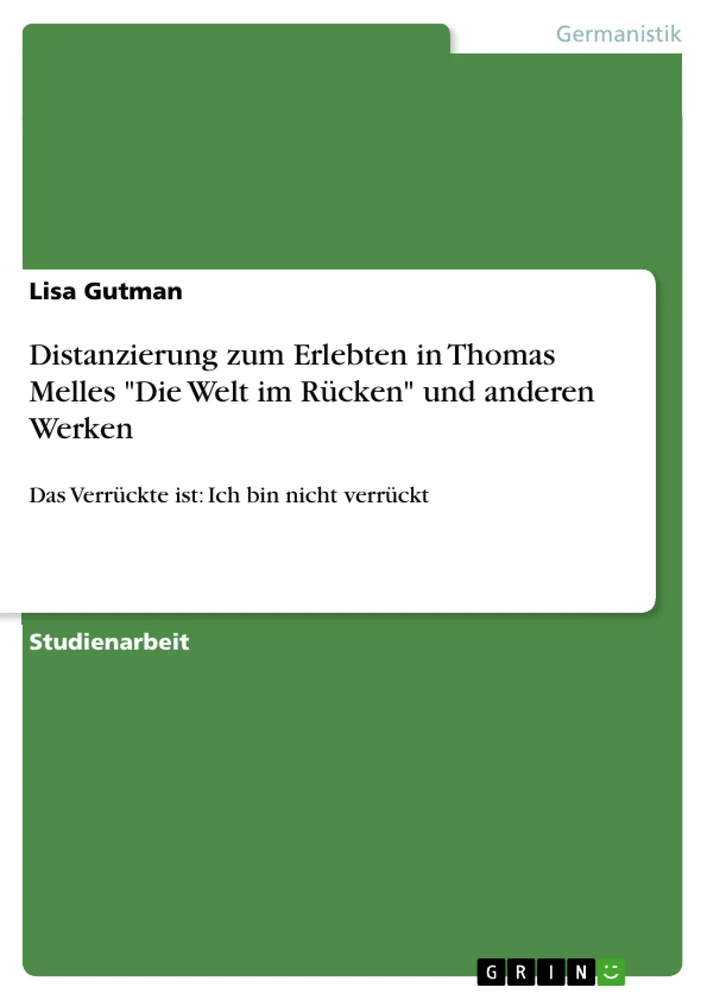Die Perspektive des "momentan Gesunden", der über den "überspitzten Irren" und den "Depressiven" schreibt, ermöglicht eine Distanzierung vom Selbst und damit einen Text, der als Plädoyer, Erklärungsversuch, ja Entschuldigung gelesen werden kann. Der Erzähler verortet sich in der Gegenwart und im "momentan gesunden Geisteszustand", Rückbezüge hierauf dienen als Anker der Realität – auch im Paratext, indem die Voranstellung der Jahreszahl bei einzelnen Episoden eine Chronologie und eine Verknüpfung mit medial dokumentierten Auftritten des Autors ermöglichen.
Auch in Melles explizit formulierten Anspruch einer möglichst realistischen Darstellungsweise wird das Bemühen um eine Festschreibung der Wahrheit, der Normalität, deutlich. Diese Autoreflexion des Schreibens und der Literarisierung des Erlebten ist ein weiterer Distanzierungsmechanismus, dessen sich Melle im vorliegenden Text bedient.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Perspektive des Erzählers
- Zeichen der Zuverlässigkeit
- Das erzählte Ich und das erzählende Ich
- ‚Free Indirect Style‘
- Die selbstreflexive Literarisierung des Erlebten
- In Werken vor Die Welt im Rücken
- Raumforderung (2007)
- Sickster (2011)
- 3000 EURO (2014)
- In Die Welt im Rücken
- In Werken vor Die Welt im Rücken
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Distanzierung vom Selbst und der Literarisierung des Erlebten im Werk „Die Welt im Rücken“ von Thomas Melle. Sie analysiert die Perspektive des Erzählers und die verschiedenen narrative Techniken, die er einsetzt, um seine manisch-depressive Erkrankung darzustellen.
- Die Rolle des Erzählers in der Konstruktion des Selbst und der Krankheitsgeschichte
- Die narrative Funktion des „Free Indirect Style“
- Die Bedeutung der Autoreflexion und der Distanzierung vom Erlebten
- Der Vergleich mit anderen Werken von Thomas Melle
- Die Auseinandersetzung mit der psychotisch-autobiographischen Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der autobiographischen „Chronik einer manisch-depressiven Erkrankung“ ein und stellt den Vergleich mit Daniel Schrebers „Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken“ her. Es wird hervorgehoben, dass Melle seine Erlebnisse aus der Perspektive des „momentan Gesunden“ beschreibt und dabei eine Distanzierung vom Selbst anstrebt.
Die Perspektive des Erzählers
Dieses Kapitel untersucht die Perspektive des Erzählers in „Die Welt im Rücken“ im Kontext der Autobiographie. Es werden die Theorien von Peter Goldie zur Rolle der Narrative im autobiographischen Denken und der Suche nach „closure“ herangezogen. Der Fokus liegt auf der Frage, wie Melle die „verdrehte Logik und […] wirklichkeitsferne[r] Fantastik“ seiner manischen Phase darzustellen versucht.
Zeichen der Zuverlässigkeit
Dieser Abschnitt behandelt die Frage der Zuverlässigkeit des Erzählers und die Ambivalenz seiner Aussagen. Der Satz „Ich weiß jetzt, dass das nur der Wahn ist“ wird als ein Schlüssel zur Interpretation der Erzählweise verstanden.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der literarischen Verarbeitung von psychischen Erkrankungen, insbesondere mit der manisch-depressiven Erkrankung. Die Analyse konzentriert sich auf die Perspektive des Erzählers, narrative Strategien wie den „Free Indirect Style“ und die Frage der Autoreflexion in autobiographischen Texten. Wichtige Begriffe sind Distanzierung, Selbstliterarisierung, Zuverlässigkeit des Erzählers, psychotisch-autobiographische Literatur und die Theorie des „closure“ nach Peter Goldie.
Häufig gestellte Fragen
Wovon handelt Thomas Melles Werk „Die Welt im Rücken“?
Es ist eine autobiographische Chronik einer manisch-depressiven Erkrankung, in der der Autor seine Erlebnisse und den Verlust der Realität während seiner manischen Phasen beschreibt.
Wie schafft der Erzähler Distanz zu seinem Erlebten?
Melle nutzt die Perspektive des „momentan Gesunden“, der über sein „krankes Ich“ schreibt. Er verwendet Techniken wie den ‚Free Indirect Style‘ und reflektiert den Schreibprozess selbst als Distanzierungsmittel.
Was ist die Funktion von Jahreszahlen in dem Buch?
Die Voranstellung von Jahreszahlen dient als „Anker der Realität“. Sie ermöglicht eine Chronologie und verknüpft die privaten Episoden mit medial dokumentierten Auftritten des Autors.
Was bedeutet „Literarisierung des Erlebten“?
Es beschreibt den Versuch, die eigene Krankheitsgeschichte in eine literarische Form zu bringen, um Wahrheit und Normalität festzuschreiben und das Unbegreifliche erklärbar zu machen.
Wie zuverlässig ist der Erzähler in diesem Werk?
Die Arbeit untersucht die Ambivalenz des Erzählers. Durch Aussagen wie „Ich weiß jetzt, dass das nur der Wahn ist“ signalisiert er dem Leser seine heutige Zuverlässigkeit im Rückblick auf die unzuverlässigen Zustände der Vergangenheit.
- Quote paper
- Lisa Gutman (Author), 2017, Distanzierung zum Erlebten in Thomas Melles "Die Welt im Rücken" und anderen Werken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/493593