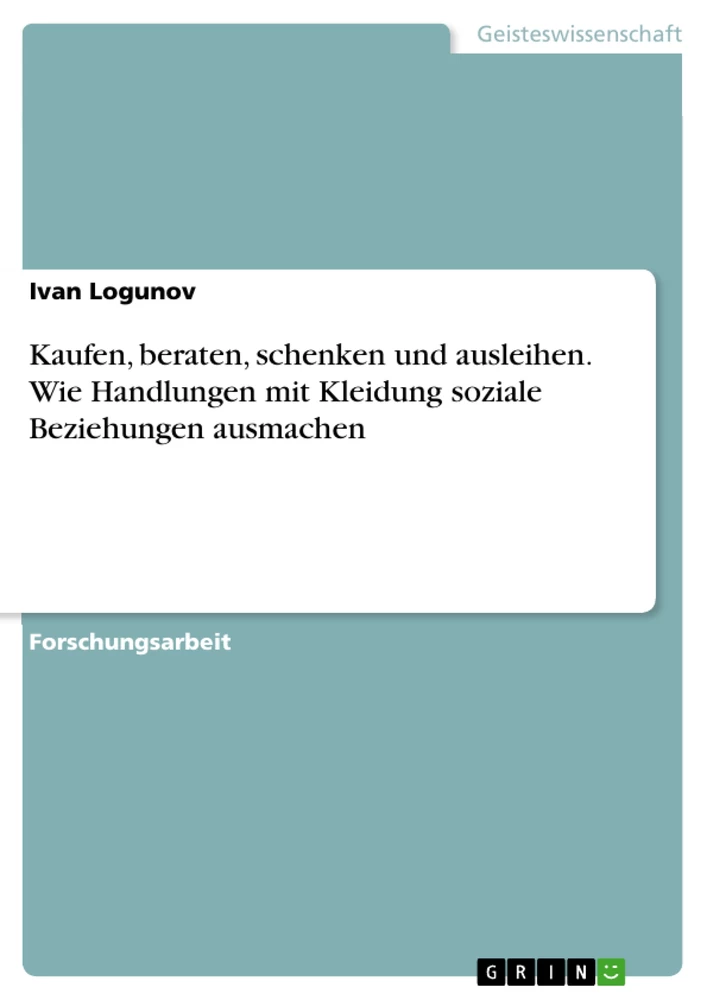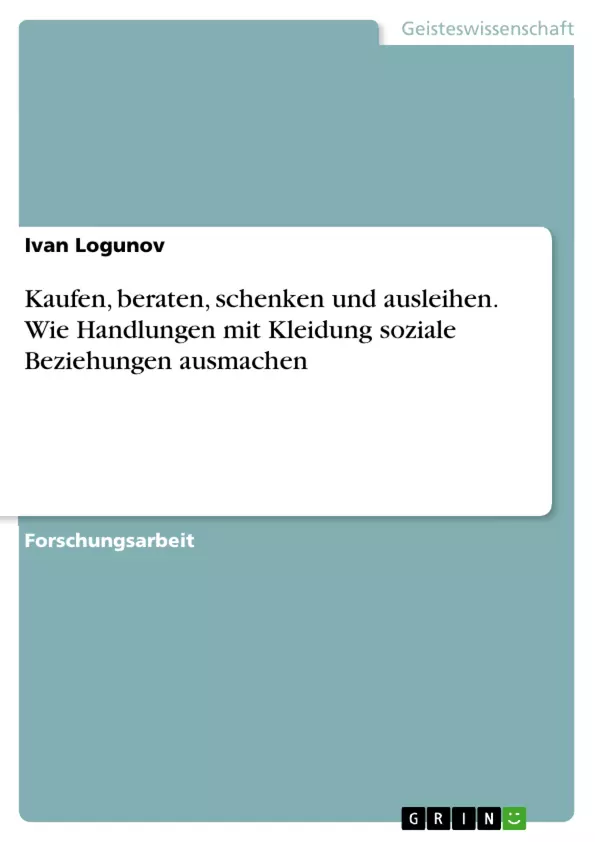Es ist keine neue Erkenntnis, dass soziale Beziehungen eine Basis für unser Handeln darstellen. Als kompetente Mitglieder der Gesellschaft, wissen wir, wie man mit Eltern, Verkäufern, Freunden et cetera umgeht und besitzen Erwartungen, wie wir von Eltern, Verkäufern, Freunden et cetera behandelt werden wollen. Das "Hände-Halten" ist zum Beispiel eine Umgangsform zwischen zwei Intimpartnern oder einem Elternteil und einem Kind, die eine bestimmte soziale Beziehung erwartbar macht. Es könnte dagegen irritierend wirken, wenn diese Umgangsform von zwei Freunden ausgeführt wird. Von Freunden erwarten wir andere Umgangsformen beziehungsweise Konventionen. Darüber hinaus wird das Thema der Konventionen in dieser Lehrforschung mit dem Thema Kleidung verknüpft. Damit wird die basale Frage gestellt, wie Menschen untereinander mit Kleidung umgehen und welche Aussagen sich aus diesem Umgang über die Beziehungsformen ableiten lassen?
Dazu wurde das episodische Interview als Methode ausgewählt, um verschiedene Situationen, in denen eine Handlung mit Kleidung passiert, von den Interviewpartnern in kurzen Geschichten erzählen zu lassen. Eine Handlung mit Kleidung meint, dass ein Kleidungsstück gekauft, nachgekauft, verschenkt, verliehen oder Beratung zur Kleidung geleistet wird. In dieser Lehrforschung liegt der Fokus auf den Rechtfertigungsformen für bestimmte Handlungen mit Kleidung und wie mit bestimmten Konventionen umgegangen wird.
Ich werde in dieser Lehrforschung den Forschungsprozess skizzieren, indem ich die Erarbeitung des Themas und die Methode vorstelle, und das Forschungsdesign in Abhängigkeit der Forschungsfrage erläutere. Des Weiteren werde ich das Thema theoretisch einbetten, den gesamten Forschungsprozess reflektieren und zum Schluss die Ergebnisse und Hypothesen zusammenfassen, um abschließend einen Ausblick für weitere Forschung zu geben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand
- Erarbeitung des Themas
- Methode
- Analyse
- Kaufen
- Nachkaufen
- Beraten
- Schenken
- Ausleihen
- Theoretische Einbettung
- Selbstreflexion / Methodenreflexion
- Schluss Erkenntnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Lehrforschung untersucht die sozialen Beziehungen, die durch Handlungen mit Kleidung geprägt werden. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse von Rechtfertigungsformen für bestimmte Handlungen mit Kleidung und dem Umgang mit Konventionen in diesem Bereich. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Verbindung zwischen der materiellen Seite von Kleidung und dem sozialen Umgang damit aufzuzeigen.
- Analyse von Konventionen und Rechtfertigungsformen im Umgang mit Kleidung
- Beziehung zwischen materiellen Eigenschaften von Kleidung und sozialen Interaktionen
- Untersuchung verschiedener Handlungen mit Kleidung (Kaufen, Nachkaufen, Beraten, Schenken, Ausleihen)
- Erarbeitung der Rolle von Kleidung bei der Gestaltung sozialer Beziehungen
- Verbindung zwischen sozialen Beziehungen und dem Umgang mit Kleidungsstücken
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Lehrforschung ein und skizziert die zentrale Forschungsfrage. Sie erläutert die Rolle sozialer Beziehungen und Konventionen im Kontext von Kleidung und stellt die Methode des episodischen Interviews vor.
- Forschungsstand: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Thema Mode und Bekleidung in der Soziologie. Es präsentiert verschiedene Perspektiven und Theorien, die sich mit der Bedeutung von Kleidung in sozialen Kontexten befassen.
- Erarbeitung des Themas: In diesem Kapitel wird der Prozess der Themenfindung und die Entstehung der Forschungsfrage dargestellt. Es werden verschiedene mögliche Themengebiete beleuchtet und der Weg zur Fokussierung auf den Umgang mit Kleidung in sozialen Beziehungen erläutert.
- Methode: Dieses Kapitel beschreibt die Methode des episodischen Interviews und erläutert, warum diese Methode für die Beantwortung der Forschungsfrage geeignet ist. Es werden die Unterschiede zwischen episodischem und semantischen Wissen sowie die Vorteile des episodischen Interviews für die Erforschung sozialer Interaktionen im Zusammenhang mit Kleidung hervorgehoben.
- Analyse: Dieser Abschnitt untersucht verschiedene Handlungen mit Kleidung, wie Kaufen, Nachkaufen, Beraten, Schenken und Ausleihen. Es werden die individuellen Erfahrungen und Interpretationen der Interviewpartner analysiert, um Einblicke in die sozialen Beziehungen und Konventionen, die mit diesen Handlungen verbunden sind, zu gewinnen.
Schlüsselwörter
Die Lehrforschung fokussiert auf die Themengebiete **Soziale Beziehungen**, **Kleidung**, **Konventionen**, **Rechtfertigungsformen**, **Handlungen**, **Materialität**, **Symbolische Wirklichkeit**, **Episodisches Interview**. Die Analyse betrachtet verschiedene Handlungen wie **Kaufen**, **Nachkaufen**, **Beraten**, **Schenken** und **Ausleihen** im Kontext sozialer Beziehungen.
Häufig gestellte Fragen
Wie prägt der Umgang mit Kleidung soziale Beziehungen?
Handlungen wie Schenken, Ausleihen oder Beraten schaffen Erwartungen und Konventionen, die die Art und Tiefe einer sozialen Beziehung (z.B. Freundschaft vs. Intimpartnerschaft) definieren.
Welche Methode wurde in dieser Lehrforschung verwendet?
Es wurde das episodische Interview gewählt, um durch kurze Geschichten der Interviewpartner Einblicke in reale Alltagssituationen mit Kleidung zu gewinnen.
Was versteht man unter „Rechtfertigungsformen“ bei Kleidung?
Es geht darum, wie Menschen begründen, warum sie bestimmte Kleidungsstücke kaufen, verschenken oder verleihen und welche sozialen Normen sie dabei befolgen.
Was ist der Unterschied zwischen episodischem und semantischem Wissen?
Episodisches Wissen bezieht sich auf konkrete erlebte Situationen und Geschichten, während semantisches Wissen allgemeine Fakten und Konzepte umfasst.
Welche Handlungen mit Kleidung wurden analysiert?
Die Untersuchung fokussierte auf die Handlungen Kaufen, Nachkaufen, Beraten, Schenken und Ausleihen.
- Quote paper
- Ivan Logunov (Author), 2017, Kaufen, beraten, schenken und ausleihen. Wie Handlungen mit Kleidung soziale Beziehungen ausmachen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/494460